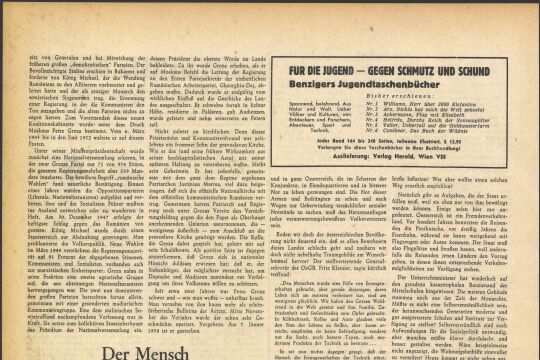Amerika — das Land des Kapitals, der Trusts, der Spitze modernster technischer Entwicklung, der Technisierung des menschlichen Lebens, des Triumphs der Materie, des materialistischen Geistes. So sehen viele Menschen heute das mächtigste Land der Welt und seine Menschen. Aber wer so die Vereinigten Staaten sieht, der urteilt nach aufdringlichen Teilerscheinungen und sieht nicht unter die Oberfläche.
„He earns 20.000 Dollars“ heißt als Maßstab der Wertung keineswegs: „er verdient 20.000 Dollars“, sondern: „er gehört in die gesellschaftliche Rangklasse, die einem Einkommen von 20.000 Dollars entspricht.“ Einkommen dient als Maßstab für sozialen Rang wie anderswo ein Titel, eine Beamtenrangklasse oder die Bezeichnung als Direktor oder Prokurist. Hier fehlen die Rangklassen und müssen ersetzt werden. Dazu wird der Dollar herangezogen, aber nur, wo man nichts Besseres findet. Bei einem Professor wird man nie das Einkommen, sondern nur die Werke, die er geschrieben, die Stellungen, die er bekleidet hat, erwähnen hören. Bei einem Arzt werden die Spitäler, die ihn zulassen, die Patienten, die ihm Vertrauen schenken, bei einem Anwalt die Klienten und Causen hervorgehoben — das Einkommen nur, insofern es einen Rückschluß auf jene zuläßt.
Idealismus ist. der Wille, Opfer an Zeit, Geld, Ruf, Ruhe für etwas zu bringen, das keinen materiellen Vorteil trägt. In keinem Lande ist dieser Wille verbreiteter. Nirgends sind Menschen, viele Men-echen, leichter bereit, für eine Idee, eine große, gute, dumme, verrückte oder böse Idee, einen erheblichen Teil vom Einkommen, vom Vermögen, von kostbarer Zeit zu opfern. Niemand, der dies Volk gut genug kennt, um seine Triebfedern beobachten zu können, und doch nicht gut genug, um gegen dessen Seltsamkeiten abgestumpft zu sein, kann das bestreiten. Untersuchen wir einige der charakteristischesten Prüfsteine des Idealismus.
In keinem Lande der Welt wird die Ehe weniger von der materiellen Stellung der Frau bestimmt. Mitgift ist unbekannt. Heiratet ein reiches Mädchen einen Mann von bescheidenem Einkommen, so bedeutet das nur einen Wechsel des ökonomischen Klimas. Auch ein relativ bescheidenes Einkommen ermöglicht hier die Teilnahme an der Fülle des Landes. Die Unterschiede zwischen den oberen und unteren Schichten sind mehr ausgeglichen als irgendwo. Abstieg aus der einen in die andere schmerzt und ächtet nicht so sehr wie in anderen Ländern. Er ist auch nicht endgültig, denn die Hoffnung baldigen Aufstieges ist größer. Wenn man den Leichtsinn bedenkt, mit dem Ehen geschlossen werden, die bei dem ungeheuren Mute dieses Volkes wie vieles andere auf „trial and error“ („Probieren geht über Studieren“) abgestellt werden, wundert man sich nicht über die Zahl der Scheidungen, sondern darüber, wie so viele auf seichtem Boden begründete Ehen starke Stürme durchhalten. Wenn Mann und Frau nur sonst miteinander zufrieden sind, gehen sie zusammen durch dick und dünn. Gemeinsame Arbeit ist ein ebenso starker Kitt wie gemeinsames Vergnügen, und die Amerikanerin ist eine gute, anspruchsvolle und leistungsfähige Partnerin in beiden. Haushilfe gibt es nur in den obersten Schichten. Das Streben nach der Waschmaschine, dem Auto, dem Radio ist nicht so sehr ein Streben nach materiellen Gütern, sondern nach Befreiung von Arbeit und Zeit für gesellschaftliche und geistige Genüsse. Die Arbeitsteilung zwischen Mann und Frau ist nicht die zwischen Büro oder Fabrik und Heim, sondern die Gatten teilen die Arbeit außerhalb und innerhalb des Heimes.
Die Kirche hat eine tiefere Bedeutung für das tägliche Leben als in den meisten weißen Ländern. Der Amerikaner, welcher Religion oder Sekte er angehören mag, ist mit ihr stärker verwachsen. Sie erfüllt nicht nur seine religiösen Bedürfnisse. Es mag befremden, daß es Kinoaufführungen und Tombolas in Gotteshäusern gibt, aber die Seelenhirten wissen, wie gemeinsame Freude bindet. Ihr Verhältnis zu den Gemeindemitgliedern ist unmittelbarer.
Erfreulich gut sind die Beziehungen zwischen den Konfessionen. Sie verstehen, daß das, was den einen trifft, dem anderen schaden würde. Es ist alltäglich, katholische, protestantische und jüdische Geistliche bei einer Veranstaltung gemeinsam auftreten und sprechen, einander gegenseitig loben zu hören. Sie kennen einander und sind oft miteinander befreundet. Brennt in einem kleinen Ort die Kirche ab, ist es selbstverständlich, daß der Tempel für den Gottesdienst zur Verfügung gestellt wird. Wird für eine katholische Kirche gesammelt, so fließen oft reiche Spenden von Protestanten und Juden. Die Religiösen der verschiedenen Konfessionen stehen nicht einander gegenüber, sondern es schlingt sich ein Band um sie, gegen die Irreligiösen und Gleichgültigen — aber kein Haß.
Die Schule, bis zur Hochschule hinauf, stellt größere Anforderungen an das Können als an das Wissen von Lehrern und Schülern. Hier soll nicht das faszinierend interessante Problem des amerikanischen Unterrichtswesens angeschnitten werden, etwa die Wirkung der bewußten Erziehung zur Eile auf Kosten der Güte, sondern nur dessen Einstellung zum Materialismus. Gewiß wird in erster Linie für den künftigen Erwerb studiert, aber das Studium bestimmt nicht den Erwerb. Im ganzen weiten Land findet man zahllose Farmer, Verkäufer, Mechaniker, Inhaber von Benzinstationen und Tourist Camps, die zwei oder vier Jahre College hinter sich haben. Das nützt ihnen auch in ihrem Beruf, aber vor allem haben sie eine andere Einstellung zu geistigen Dingen, sind bessere Wähler und Geschworene, als sie ohne das Studium, ohne das eigenartige Leben am Campus geworden wären. Sie haben meist nicht allzuviel Wissen aus der Schule gerettet, aber Bildung besteht in dem, was man weiß, wenn man vergessen hat, was man gelernt hat.
Vor allem lehrt die Schule Zusammenleben mit dem gleichen und mit dem anderen Geschlecht, Respekt vor dem Recht des anderen. Die Freundschaften und Ehen, die auf den Hochschulen entspringen, gehören zu den besten. Allerdings hat sich in die voreheliche Periode, die Zeit des „dating“, ein ungesunder, anscheinend materieller Zug eingeschlichen. Was die jungen Mädchen von ihren Verehrern erwarten, legt diesen bedenkliche finanzielle Lasten auf. Blumen, Autofahrten, teure Lokale können an einem Abend das beste Wocheneinkommen, das der junge Mann erhofft, verschlingen. Und doch wird der anscheinende Vorsprung der Reicheren bald ausgeglichen. Bei einer Debatte an einer Hochschule über die Reformbedürftigkeit dieses Systems verfochten einige junge Damen heftig ihr Recht auf diese Ausgaben, aber aus ihren Worten klang hervor, daß es sich ihnen vor allem um einen sehr plumpen Maßstab für die Zuneigung und die Opfer handle, die der Partner für sie zu bringen bereit sei. Es ermöglicht aber auch, frühzeitig gewisse Charaktereigenschaften zu erkennen, die in der Ehe Hilfe oder Last bedeuten können.
Das Rassen problem wird im Ausland gründlich mißverstanden. Gewiß ist die Lage der Farbigen, vor allem im Süden, ungerecht und beklagenswert, aber erstens: wo auf der Welt sind in bloß 80 Jahren größere Fortschritte gemacht worden (Südamerika hatte dazu 130 Jahre zur Verfügung)? Zweitens: wo ist der Wille zur Besserung stärker und kann die Wirkung täglich, beinahe stündlich verfolgt werden? Drittens: wo ist die Lage einer zurückgesetzten Minderheit besser? Neger und Mulatten machen ein Zehntel der Bevölkerung der Vereinigten Staaten aus. Eine Million davon ist nicht mehr zu erkennen und gilt für weiß (passing). Etwa ein Drittel, aber ein stets wachsender Prozentsatz der Weißen erfreut sich der gleichen materiellen Vorteile, ein erheblicher Teil ist wohlhabend, ein kleiner reich. Vor allem ist aber die Rassenfrage ein Prüfstein für den Idealismus der Amerikaner.
Uber dem Unrecht, das den Farbigen zugefügt wird, darf man nicht übersehen, welch großer Teil der weißen Bevölkerung ernstlich für eine Besserung kämpft und dafür gewaltige Opfer ohne eigenen Vorteil bringt. Ein deutliches Beispiel bot ein Fall schamlosester Negerverfolgung in Alabama, der Scottsboro Case, in dem eine Gruppe armer junger Neger, die sich auf einer Bahnfahrt gegen einen Überfall weißer Rowdies wehrten, wegen Notzucht an zwei Dirnen, die sie nie gesehen hatten, verurteilt wurden. Aber welche Reaktion löste der Fall aus? Millionen Weißer nahmen sich seiner an, Tausende spendeten große, kleine und winzige Beträge für die Opfer, der Kampf ums Recht wurde ein Kampf gegen Alabama, einige der größten Anwälte opferten Hunderttausende Dollars an Zeit und Geld, um die Angeklagten zu verteidigen, trotzten, ebenso wie einer der Richter, mit wahrem Heldenmut dem aufgehetzten Pöbel.
Daß in Amerika Geld überhaupt „keine Rolle spielt“, wenn es gilt, Menschenleben oder Menschenglieder zu retten, ist hier so selbstverständlich, daß darüber nicht zu reden ist. Hunderttausende, Millionen Dollars werden ohne eine Sekunde Bedenkens ausgegeben, wenn es sich um Hilfe für Menschen in Seenot oder Flugnot handelt. Es ist höchstens in dem Sinne zu bemerken, daß hier bedenkenlos viel Geld ausgegeben wird, um auch nur wenige Menschen zu retten, und anderswo bedenkenlos viele Menschen geopfert werden, um verhältnismäßig wenig Güter für einen „profitlosen“ Staat zu verdienen.
Schenken ist eine Lieblingsbeschäftigung geworden. Schon in den Schulen sammeln die Kinder, spontan, für irgendeinen Zweck, der ihr Herz gerührt hat; für ein Kind, das künstliche Gliedmaßen braucht, für arme Kinder in fremden Ländern, die sie kaum auf der Landkarte finden können, oder, mit oft rührend naiven Zuschriften, für einen „großen“ Zweck. Niemand drängt sie, wenn ein Kind nicht, oder für einen anderen Zweck geben will, gibt es keinen Vorwurf. Wem ein Unglück zustößt, der kann sicher sein, daß seine Nachbarn ihm helfen, mit Geld und Zeit. Es mag sich um einen Kirchenbau oder den Kampf gegen den Krebs, um eine Schule oder den Kampf für oder gegen Rassengleichheit, um ein Tierspital oder um einen neuen Propheten handeln — wer eine Idee vertritt, findet überall offene Herzen und, was anderswo schwerer zu finden ist, offene Taschen. Ohne diese Freigebigkeit müßte ein Drittel der Lehranstalten und die Hälfte der Heilanstalten geschlossen werden, würde die wissenschaftliche Forschung verdorren. Die Geschenke für öffentliche und private Zwecke erfassen oft einen großen Teil des Einkommens.
Diese Dinge muß man um sich sehen und miterleben, ehe man vom „Materialismus“ der Amerikaner sprechen darf. Sie verstehen nicht, für ihre geistigen Güter so Reklame zu machen wie für ihre materiellen, und nicht mit den richtigen Gründen. Gewiß ist bei einem Volke von 150 Millionen jedes Urteil auf große Gruppen nicht zutreffend. New York, das so oft mit den Vereinigten Staaten verwechselt wird, ist das wenig günstigste Beispiel. Ein Drittel der amerikanischen Bevölkerung lebt dicht gedrängt in einem Umkreis von 400 Kilometer von New York. Im weiten, leeren Westen sind die Menschen noch offener, aufgeschlossener, „ amerikanischer“. Auch kann ein bis in die tiefsten Schichten herab nicht reiches, aber güterreiches, wohlhabendes Volk, mit einer glücklichen Geschichte, sich Idealismus leichter leisten. Aber es leistet sich ihn. Auch in internationaler Beziehung, und das wird nur zu häufig mißdeutet, weil man dies Volk nicht kennt und versteht. Man kann es nicht glauben, daß ein noch dazu als materiell verschrieenes Volk so große Opfer aus anderen als egoistischen Gründen auf sich nimmt. Darin mißversteht man den Amerikaner. Freigebigkeit ohne Hintergedanken ist sein ausgeprägter Charakterzug geworden. Er würde vielleicht weniger mißdeutet werden, wenn er nicht schenken, sondern für sein Geld einen, wenn auch bescheidenen, Gegenwert eintauschen würde. Ihm würde das weniger Freude, aber vielleicht mehr Freunde machen, die nicht durch Mißtrauen entfremdet würden. Ein Blick schließlich auf die Milliarden der amerikanischen Nachkriegshilfe in jeder Form, die einem jeden einzelnen Bürger Amerikas persönliche Opfer auferlegt, läßt das gedankenlose Schlagwort vom „amerikanischen Materialismus“ mehr als problematisch erscheinen.