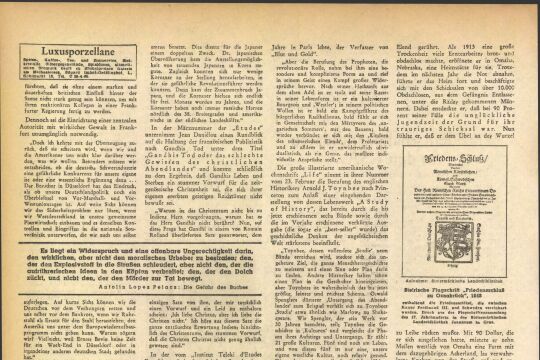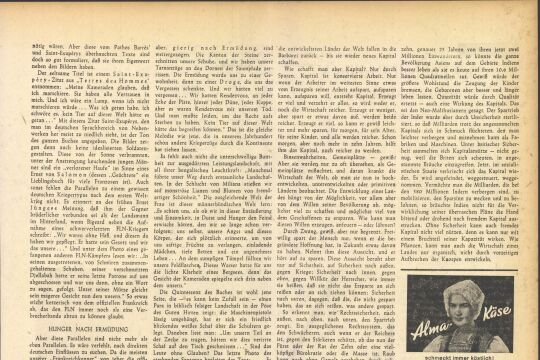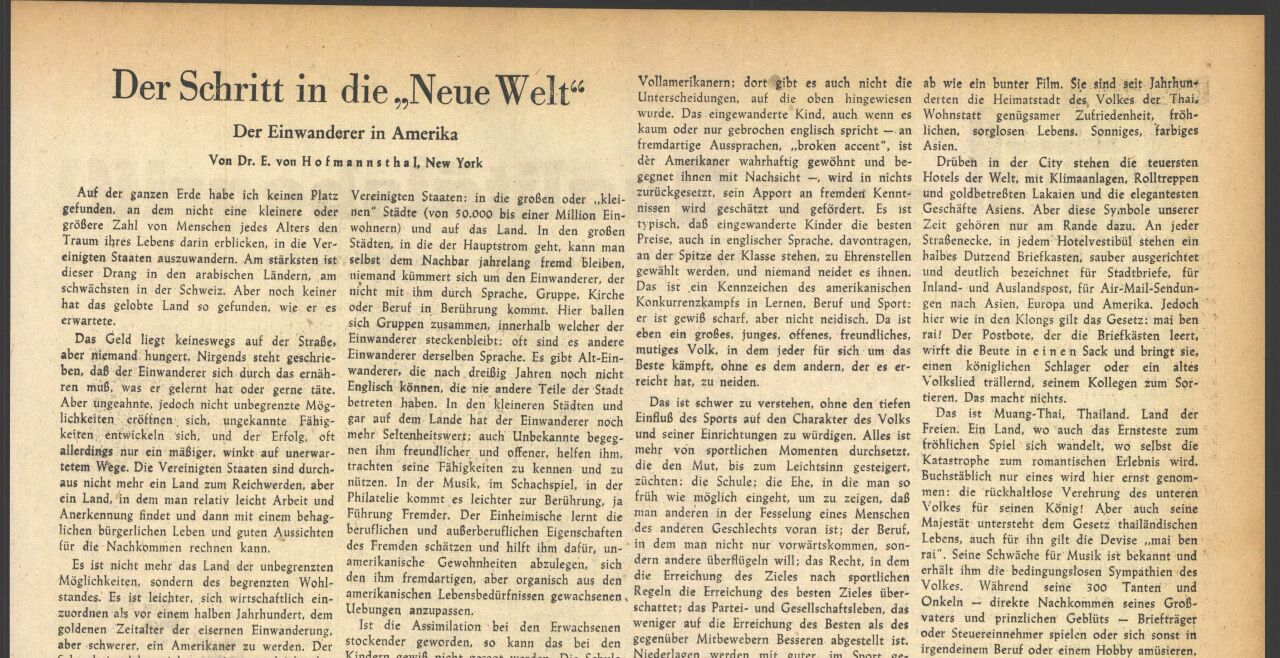
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Schritt in die „Neue Welt“
Auf der ganzen Erde habe ich keinen Platz gefunden, an dem nicht eine kleinere oder größere Zahl von Menschen jedes Alters den Traum ihres Lebens darin erblicken, in die Vereinigten Staaten auszuwandern. Am stärksten ist dieser Drang in den arabischen Ländern, am schwächsten in der Schweiz. Aber noch keiner hat das gelobte Land so gefunden, wie er es erwartete.
Das Geld liegt keineswegs auf der Straße, aber niemand hungert. Nirgends steht geschrieben, daß der Einwanderer sich durch das ernähren muß, was er gelernt hat oder gerne täte. Aber ungeahnte, jedoch nicht unbegrenzte Möglichkeiten eröffnen sich, ungekannte Fähigkeiten entwickeln sich, und der Erfolg, oft allerdings nur ein mäßiger, winkt auf unerwartetem Wege. Die Vereinigten Staaten sind durchaus nicht mehr ein Land zum Reichwerden, aber ein Land, in dem man relativ leicht Arbeit und Anerkennung findet und dann mit einem behaglichen bürgerlichen Leben und guten Aussichten für die Nachkommen rechnen kann.
Es ist nicht mehr das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sondern des begrenzten Wohlstandes. Es ist leichter, sich wirtschaftlich einzuordnen ah vor einem halben Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter der eisernen Einwanderung, aber schwerer, ein Amerikaner zu werden. Der Schmelztiegel hat viel von seiner ausgleichenden Glut verloren.
Diese Erscheinung zeigen die meisten Einwanderungsländer, von Kanada bis Chile, von Neuseeland bis Südafrika. Ihre Gründe sind mannigfaltig, aber der stärkste ist: man fragt zuviel und zu lange, woher der Einwanderer kam, statt nur, was er leistet. Es gibt zu viele kleine Dinge, die ihn daran erinnern, daß er ein Fremder war und noch kein Einheimischer ist: von der Fremdensteuer in Bolivien bis zu der Postkarte in den Vereinigten Staaten, die im Jänner jedes Jahres jeder Fremde mit Angabe seines Aufenthalts an die Behörde schreiben muß; von dem argentinischen Polizeibericht, der bei einem Dieb „aus Polen, aus Ungarn“ hinzufügt, bis zu der nordamerikanischen Gewerkschaft, die sich Fremden verschließt oder doch, wenn sie ihr Gewerbe ,,außerhalb der Vereinigten Staaten oder Kanadas“ gelernt haben, mit höheren Gebühren belegt; von der Annonce, die von einem Musiker „in Amerika geboren“ oder gar ,,seit zwei Generationen Bürger“ verlangt, bis zu den Staaten, in denen selbst der Installateur oder Friseur Bürger sein muß; von der Diskriminierung eingebürgerter Amerikaner, die sich bei Verlust ihrer Staatsbürgerschaft nicht fünf Jahre in einem fremden Lande und nicht drei Jahre in ihrer früheren Heimat aufhalten dürfen, bis zu der kennzeichnenden Erscheinung, daß vor 50 Jahren kein einziger Staat von einem Arzte, oder Anwalt die Staatsbürgerschaft verlangte und daß es jetzt alle tun - zeigt sich eine Verengerung der Straße nach dem Durchschreiten des Eingangstores.
Das ist gar nicht im Einklang mit dem berühmten „American way“, der amerikanischen Art. Es entspricht den neo-amerikanischen Einrichtungen, aber nicht dem amerikanischen Volkscharakter. Da zeigt sich ein Spalt, der zum Nachdenken anreet. Niemand ist offener, freundlicher, gastfreundlicher, hilfsbereiter gegen den Einwanderer als der Amerikaner — je weiter im Westen, d. h. je leerer das Land (ein Drittel der Bevölkerung der Vereinigten Staaten lebt in einem Umkreis von 400 km von New York), desto whr, Diese Beobachtung stimmt auf der ganzen Welt: ie dichter die Bevölkerung, desto leichter wird dem Fremden die Eingliederung in wirtschaftlicher, desto schwerer das Eindringen in gesellschaftlicher Hinsicht.
In einem unterscheiden sich die Vereinigten Staaten wesentlich von allen südlichen T.ändern fls Kontinent: in der Schätzung der Qualität. Leuchten und Lichter der ausländischen Intelligenz fanden offene Aufnahme an ihren Hochschulen und anderen Stellen, wo sie ihre Fähigkeiten entfalten konnten, und das Land ist dabei nicht schlecht gefahren. In den lateinamerikanischen Ländern begegneten sie oft einer Abnei-gune des Minderwertigkeitsbewußtseins. Reeein und Liebung beruhen dort auf dem verhüllten Grundsatz: in den unteren Schichten lassen wir gerne tüchtige Einwanderer herein, denn dort kann die Konkurrenz uns nur nützen; nicht aber in den oberen, die wir, die dazu gehören, für uns allein behalten wollen. Dabei mag mitspielen, daß in den Vereinigten Staaten die“ Grenze zwischen unten und oben leichter überschritten wird und daß man qualifizierte geistige Arbeit nicht wie in Lateinamerika, wo sie auch beim Einheimischen karc entlohnt wird, mehr mit Worten als mit Geld würdigt.
Uebrigens gibt es zwei voneinander wesentlich verschiedene Arten der Einwanderung in die
Vereinigten Staaten: in die großen oder „kleinen“ Städte (von 50.000 bis einer Million Einwohnern) und auf das Land. In den großen Städten, in die der Hauptstrom geht, kann man selbst dem Nachbar jahrelang fremd bleiben, niemand kümmert sich um den Einwanderer, der nicht mit ihm durch Sprache, Gruppe, Kirche oder Beruf in Berührung kommt. Hier ballen sich Gruppen zusammen, innerhalb welcher der Einwanderer steckenbleibt: oft sind es andere Einwanderer derselben Sprache. Es gibt Alt-Einwanderer, die nach dreißig Jahren noch nicht Englisch können, die nie andere Teile der Stadt betreten haben. In den kleineren Städten und gar auf dem Lande hat der Einwanderer noch mehr Seltenheitswert; auch Unbekannte begegnen ihm freundlicher und offener, helfen ihm, trachten seine Fähigkeiten zu kennen und zu nützen. In der Musik, im Schachspiel, in der Philatelie kommt es leichter zur Berührung, ja Führung Fremder. Der Einheimische lernt die beruflichen und außerberuflichen Eigenschaften des Fremden schätzen und hilft ihm dafür, un-amerikanische Gewohnheiten abzulegen, sich den ihm fremdartigen, aber organisch aus den amerikanischen Lebensbedürfnissen gewachsenen, Uebungen anzupassen.
Ist die Assimilation bei den Erwachsenen stockender geworden, so kann das bei den Kindern gewiß nicht gesagt werden. Die Schule ist ein besserer Schmelztiegel als je. Das Schulsystem, vom Kindergarten bis zur Hochschule, ist grundverschieden von dem anderer Länder. Es ist -weniger auf Vermittlung von Kenntnissen als von Urteilskraft und sozialen Fähigkeiten abgestellt, am stärksten am Beginn, aber immer noch stark fühlbar am Ende. Das verstehen ältere Einwanderer nicht und kritisieren es mit LTeberheblichkeit, aber ihre Kinder fühlen ' es sehr gut. Die Schule macht sie zu freudigen
Vollamerikanern; dort gibt es auch nicht die
Unterscheidungen, auf die oben hingewiesen wurde. Das eingewanderte Kind, auch wenn es kaum oder nur gebrochen englisch spricht — an fremdartige Aussprachen, „broken accent“, ist der Amerikaner wahrhaftig gewöhnt und begegnet ihnen mit Nachsicht —, wird in nichts zurückgesetzt, sein Apport an fremderi Kenntnissen wird geschätzt und gefördert. Es ist typisch, daß eingewanderte Kinder die besten Preise, auch in englischer Sprache, davontragen, an der Spitze der Klasse stehen, zu Ehrenstellen gewählt werden, und niemand neidet es ihnen. Das ist .ein Kennzeichen des amerikanischen Konkurrenzkampfs in Lernen, Beruf und Sport: er ist gewiß scharf, aber nicht neidisch. Da ist eben ein großes, junges, offenes, freundliches, mutiges Volk, in dem jeder für sich um das Beste kämpft, ohne es dem andern, der es erreicht hat, zu neiden.
Das ist schwer zu verstehen, ohne den tiefen Einfluß des Sports auf den Charakter des Volks und seiner Einrichtungen zu würdigen. Alles ist mehr von sportlichen Momenten durchsetzt, die den Mut, bis zum Leichtsinn gesteigert, züchten: die Schule; die Ehe, in die man so früh wie möglich eingeht, um zu zeigen, daß man anderen in der Fesselung eines Menschen des anderen Geschlechts voran ist; der Beruf, in dem man nicht nur vorwärtskommen, sondern andere überflügeln will; das Recht, in dem die Erreichung des Zieles nach sportlichen Regeln die Erreichung des besten Zieles überschattet; das Partei- und Gesellschaftsleben, das weniger auf die Erreichung des Besten als des gegenüber Mitbewebern Besseren abgestellt ist. Niederlagen werden mit guter, im Sport geschulter Laune hingenommen. Der Einfluß des Sports auf den Volkscharakter, im Besseren und im Schlechteren, ist nicht zu unterschätzen.
Der Engländer sagt: „Um Gentleman ?u w,crden, braucht man 36 Jahre College: 12 Jahre, die “man selbst, 12 Jahre, die der Vater, und 12 Jahre, die der Großvater im College verbracht hat.“ Um Amerikaner zu werden, braucht man zwei Generationen: eine, die einwandert, und eine, die hier in die Schule geht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!