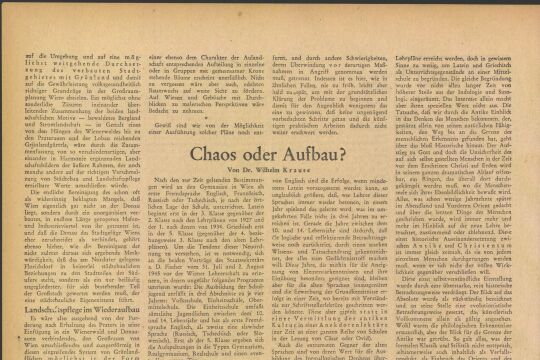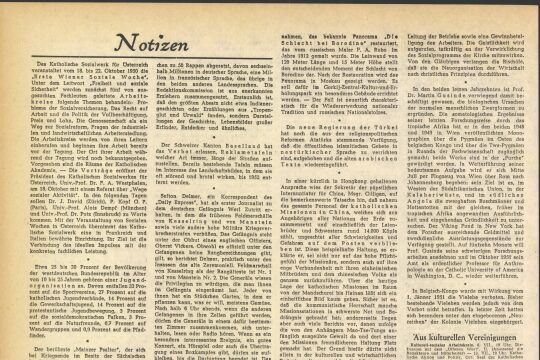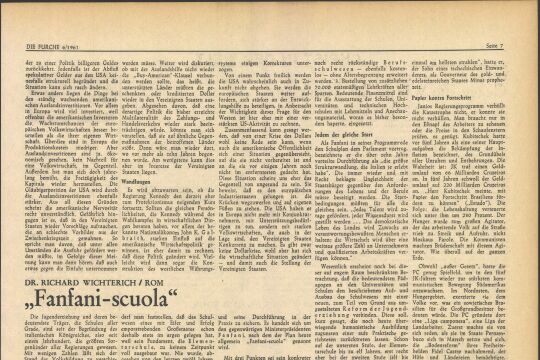Ein ungarischer Architekt, Revolutionsflüchtling von 1956, der sich hier in dem Fach ,,landscape-de-sign“ (Garten- und Landschaftsplanung) spezialisiert, berichtete von der tiefgreifenden psychologischen Wirkung des Sputnikerfolges auf die Gemüter seiner amerikanischen Kollegen. Nach dem gelungenen Abschuß des Sputniks seien seine amerikanischen Freunde tagelang mit betrübten Gesichtern und hängenden Schultern umhergegangen. Die unausgesprochenen Fragen hätte man an ihren Zügen ablesen können: Was haben wir falsch gemacht? Sind die Russen geistig leistungsfähiger als wir? Und warum? Gehört unser Schulsystem zum alten Eisen? Wo sollen die Reformen ansetzen?
Ein Europäer vergleicht
Der akademische Besucher aus Europa — als Austauschprofessor oder Austauschstudent meist nicht länger als ein Jahr im Land — stellt sich die
Lösung zunächst sehr einfach vor. Man verwandle den freundlichen, immer dem Schüler nachgebenden, gemein-schaftsfördernden Diskussionsbetrieb in der Schule in einen Lernbetrieb nach europäischem Muster, und der Erfolg wird sich von selbst einstellen. Oft folgt dann noch eine zweite schiefe Gegenüberstellung: der europäische Maturant wird mit dem amerikanischen High-school - Absolventen verglichen. Der Vergleich muß zuungunsten des Amerikaners ausfallen, denn er hat meist nur drei Jahre Fremdsprachenunterricht genossen, er hat vielleicht zwei Jahre Latein gelernt, aber sicher kein Griechisch. Seine Beherrschung der Muttersprache ist wahrscheinlich auch weniger gewandt, und seine Aufsätze erscheinen ungeschickter als die des europäischen Musterschülers...
Die anscheinend auf der Hand liegende Conclusio ist falsch, da die Prämissen nicht stimmen. Die Aufgabe Nummer eins der amerikanischen High-school war und ist es noch immer, zunächst den Kindern, die oft nicht im Land geboren sind und oft auch aus einem nicht englisch sprechenden Elternhaus kommen, ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl zu geben. Amerika war der eigentliche Lehrgegenstand, weniger die jeweilige Disziplin. Die Mittelschule sollte für alle da sein, um jedem im Sinne der demokratischen Spielregel den gleichen Start im neuen Land zu geben. Diese Aufgabe hat die amerikanische Mittelschule erfüllt. Geringere Kenntnisse in einem Lernfach waren kein Problem, als es galt, einen Kontinent urbar zu machen. Diese lebenstüchtige Einstellung kann an einem scherzhaften und zugleich bildungsgegnerischen Slogan wie diesem abgelesen werden: ,,If you can't do it, teach it I“
Die in Österreich unbekannte Institution des College bildet die Brücke zu einem Universitätsstudium im euro-
päischen Sinn. Hier wird zunächst in den ersten zwei Jahren der Nachholbedarf an Kenntnissen gestillt (mit einer für europäische Beobachter fast unmenschlichen Arbeitswut). In den zwei folgenden Jahren wird der Bildungsstand in dem heute doch kommunizierenden Gefäß des europäischamerikanischen Bildungssystems oft ausgeglichen (man darf allerdings hier nur die Spitzencolleges in Betracht ziehen). In den graduate s c h o o 1 s der Universitäten, wo auf die Erwerbung des Doktorats (hier die dritte Stufe des akademischen Ehrgeizes nach B. A. =t Bakkalaureus und M. A. — Magister) hingearbeitet wird, manifestiert sich der Unterschied nur noch in der Einzelbegabung.
Meist übersieht der oberflächliche Beobachter auch die fast unglaublichen Unterschiede zwischen den Einzelschulen sowohl nach System als auch nach Güte. Der freiheitsliebende Pflanzer- und Puritanergeist verteidigt noch immer hartnäckig die ortsgebundene Schule, wenn sie auch oft durch
das Mißverhältnis zwischen Schülerzahl und Aufwandskosten die Finanzen eines Dorfes oder einer Kleinstadt ins Wanken bringt. Das demokratisch gewählte Schulkomitee kann den Lehrplan oft stärker beeinflussen als der Direktor oder der Inspektor. Man beschließt: „Wir wollen für unsere Kinder einen Bastelkurs 1“, und der Direktor muß sich fügen, denn er ist nicht Staats-, sondern Landesangestellter und wird also, überspitzt formuliert, eigentlich von seinem eigenen Schulkomitee bezahlt. Der Lehrplan in einer Farmerstadt des Mittelwestens wird sich demgemäß wesentlich von dem einer Universitätsstadt, wie Cambridge oder Princeton, unterscheiden, wo das Schulkomitee mit Universitätsprofessoren durchsetzt ist. Aber die eigentlichen Eliteschulen sind noch immer die ganz wenigen teuren Privatschulen (Jahreskosten bis zu 2000 Dollar), die in ihren Prospekten stolz darauf hinweisen, daß der Großteil ihrer Schüler die Aufnahmebedingungen (Ausleseprinzip) für die Prestigeuniversitäten, wie Harvard, Yale oder Princeton, erfülle und meist auch an diesen Anstalten studiere. Diese Privatschulen allerdings halten den Vergleich mit jedem guten europäischen Gymnasium aus.
Der kritisch gesinnte Europäer sollte daher nicht die verschiedenen Systeme gegeneinander ausspielen, sondern Schwächen innerhalb des fremden Systems aufdecken helfen. Der allzu große Einfluß der Elternausschüsse auf den Lehrplan wurde schon genannt. Dazu kommt eine Überschätzung psychologischer Testmethoden (Zeitungsannonce: Wie hebe ich den I. Q. [Intelligenzquotienten] meines Kindes in 30 Tagen? Die Broschüre zu 2.95 Dollar plus Postgebühr) und technischer Unterrichtsbehelfe, die man als „Bildungsapparate“ bezeichnen könnte, zum Beispiel sogenannte „Sprachenlaboratorien“, wo der Lehrer nur noch ein Magnetophonband einlegt, das von den Schülern mit Kopfhörern über-
nommen wird. Bei Durchlesen der Annonce für den „Schnelleseapparat“ in der „New York Times“ findet man etwa folgendes: Eine elektrische Uhr mit verschiedenen Geschwindigkeitseinstellungen wird mit einem Schwenkarm verbunden, der in der jeweils gewünschten Geschwindigkeit über die Seite gejagt wird. Das Auge folgt der jeweils fixierten beziehungsweise unterstrichenen Zeile, und der Geist gewöhnt sich angeblich (laut Anleitung) an immer größere Lesegeschwindigkeiten. „Lies schneller, Bürger“ als westliche Variation des sowjetischen Persiflageimperativs „Schlaf schneller, Genosse!“.
Selbstkritik und Besinnung
In einem Land mit einer fast maso-chistischen Lust an Selbstkritik wird ein Ereignis wie der Sputnik nicht nach einer verdrossenen Woche ad acta gelegt. Bereits am 8. November 1958 hatte James Bryant Conan t, der ehemalige Harvard-Präsident und spätere amerikanische Hochkommissar in Deutschland, im Auftrag der Carnegie-Stiftung seinen Untersuchungsbericht (The Conant Report) über das heikle Thema unter dem Titel beendet: „The American High School Today — a first report to interested 'Citizens.“ Schon in dem Vorwort zu diesem Bericht werden die Probleme mit schonungsloser Offenheit in exemplarischen Sätzen zusammengefaßt (hier als Gegensatzpaare Europa = A und Amerika = B angeführt):
A.: „Nicht mehr als 20 Prozent einer Altersgruppe werden aus den Volksschulen in die Mittelschulen übernommen.“
B.: „Die amerikanische öffentliche Mittelschule kann mit keiner Institution in irgendeinem anderen Land verglichen werden. Von einigen Ausnahmen abgesehen .... erwartet man vom |Jer, iperjku.iscken- Mitftj|<*u1e. daß sie die Bildung für alle Jugendlichen einer Groß- oder Provinzstadt oder eines Schulbezirkes bereitstellt.
A.: „Europäische Universitäten sind im wesentlichen eine Vereinigung von Fakultäten zur Heranbildung der zukünftigen Mitglieder akademischer Berufe.“
B.: ..... ungeheuer war die Kraft
des Doppelideals: Standesgleichheit und gleiche Möglichkeiten für alle.“
A.: „____aber jene, die durchkommen, beenden die Mittelschule mit der Kenntnis von zwei Fremdsprachen, der Mathematik, eingeschlossenen Integral, und von Physik und Chemie auf der Stufe unseres zweiten College-Jahres.“
B.: „Noch nie wurde in der Bildungsgeschichte dieses Landes die Beherrschung einer Fremdsprache als Zeichen eines gebildeten Menschen
betrachtet.“
Am Ende des ersten Hauptkapitels faßt Conant die Vorschläge für Änderungen im großen zusammen: Die Zersplitterung soll durch die Zusammenfassung kleiner Mittelschulen zu Distriktsschulen aufgehoben werden, die zum Studium begabten Schüler sollen nicht mehr auf dem unteren „Gesamtniveau“ gehalten werden, aber ihre Spezialisierung soll auch nicht einseitig geschahen (zum Beispiel Mathematik und Naturwissenschaft unter Ausschluß von Fremdsprache?*), .^“f*
Eine klug kommentierte Liste von 21 Verbesserungsvorschlägen gibt ein aufschlußreiches Bild von den typisch amerikanischen Schul- und Bildungsproblemen, die in Europa durch die Zwei- oder Dreigeleisigkeit des Bildungsweges nicht existieren. Hier einige Beispiele:
Der Vorschlag Nr. 3 befaßt sich mit dem geforderten Lehrplan für alle (das heißt, daß dieser Lehrplan natürlich auch für jene Gruppe gelten muß, die den österreichischen Volks- und. Hauptschülern entspricht) und verlangt: vier Jahre Englisch, drei oder vier Jahre Sozialstudien (darunter zwei Jahre Geschichte, davon ein Jahr amerikanische Geschichte), ein Jahr Mathematik (Algebra) und ein Jahr Naturwissenschaft (Biologie oder Chemie). Das erscheint wenig, aber daneben hat jeder Schüler sein Spezialgebiet, das er sich selbst wählt:
Fremdsprachen, Mathematik oder Naturwissenschaften. Sehr wesentlich erscheint auch der Zusatzvorschlag, daß man jedem Schüler, der in den geforderten Basisfächern fleißig war, aber trotzdem innerhalb der Grenzen seiner schwachen Begabung bleibt und so das Lehrziel nicht erreichen konnte, ein „passing grade“ (Durchlaßnote) geben soll. Der Vorschlag Nr. 9 diskutiert den 'Zusatzlehrplawftir die um Studitim 'Begabten Und1 schrägt vor: WiF *fthf^<Matherrffert&, M ep' Jahre Fremdsprache, drei Jahre Naturwissen- schaff, immer als Zusatz zu dem Lehrplan für a 11 e. Außerdem die Möglichkeit zum Studium einer zweiten Fremdsprache. Trotzdem wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß die Bezeichnung „Universitäts- (bzw. College-) Vorbereitung“ vermieden wurde.
Als Grund wird die unübersehbare Vielfalt der College-Typen angeführt, auf die man eben nicht nach einem genau fixierbaren Schema vorbereiten könne. Es handelt sich aber eher um eine Scheu vor der Durchbrechung des „demokratischen Glejchheitsprinzips“ durch „Exklusivitätsansprüche“. Im Vorschlag Nr. 10 wird die Zusammenfassung der besonders begabten Schüler (drei Prozent der Schülerzahl) gefordert, ferner die Organisierung ihres Unterrichts, teilweise bereits auf College-Niveau. Der Vorschlag Nr. 18 behandelt das Fremdsprachenproblem. Die Schulen sollten ein drittes oder viertes Fremdsprachenjahr ermöglichen, selbst wenn nur wenige Schüler die gebotene Gelegenheit ergreifen. Lehrziel sollte „mastery in that 1 a n g u a g e“ (Konversation und Lesefähigkeit) sein, Mit den bisherigen zwei Fremdsprachenjahren konnte weder das eine noch das andere erreicht werden.
Der europäische Leser könnte nach diesen ausgewählten Vorschlägen ein Überwertigkeitsgefühl seinem eigenen System gegenüber bekommen, das nur teilweise berechtigt wäre. Denn diese Vorschläge sollen eben für das Ausbildungssystem des zukünftigen Arbeiters wie für das des späteren Universitätsprofessors gültig sein. Die Bildungsmöglichkeiten für die Allgemeinheit sind vermutlich hier weitaus vielfältiger, auf alle Fälle aber leichter zugänglich als in den meisten europäischen Ländern.
Ein „revolutionärer“ Schultypus
Die Elitenbildung allerdings stellt ein Kapitel dar, das in dem Buch Conants nur gestreift wird. Die „pre-paratory-school“ (die teuer bezahlte Universitätsvorbereitungs-schule) kann dem Odium des Klassenprestiges nicht entgehen. Das heißt: erst reich und gescheit ermöglicht hier einen Studententypus, der dem europäi-
sehen Gymnasiasten (auch dem nichtwohlhabenden) gleichkommt. Das kt die gerne verschwiegene Kehrseite des Kernspruches „Equality of opportunity“ (frei übersetzt: Gleicher Start für alle). Es ist aber wahrscheinlich, daß in zehn oder zwanzig Jahren auch dieser Schönheitsfehler überwunden sein wird. Man wird sich dann eben entschlossen haben, eigene Schulen auch für die „zukünftigen Studierenden“ aus weniger wohlhabenden Familien zu errichten. Schon jetzt hat ein in diesem Sinne „revolutionärer Schultypus“, der von einem jugoslawischen Emigranten zunächst in den Gebieten der Westküste ausprobiert wurde, große Begeisterung hervorgerufen. Dieser Mann hat aber nichts anderes getan, als den alten europäischen Mittelschultypus importiert und als „Lernschule“ im Gegensatz zur „Diskussions- und Lebens-chule“ propagiert.
Der piepsende Sputnik hat auch einen Spähtrupp amerikanischer Er-.
zieher auf die Beine gebracht, die seither eifrig das russische mit dem amerikanischen Schulsystem vergleichen. In einem 209 Seiten langen Bericht unter dem offenherzigen, selbstanklagenden Titel „Was Iwan weiß und Johnny nicht“ werden Textbücher und vorgeschriebene Lesestoffe einander gegenübergestellt. Dort erfährt man, daß sich Johnny noch mit einfachen Geschichten unbekannter Autoren begnügen muß, während Iwan auf derselben Schulstufe schon Puschkin, Tol-stoj und Tschechow lesen kann. Russische Kinder verarbeiten bereits Textbücher mit einem Vokabelschatz von 10.000 Wörtern, während die gleichaltrigen Amerikaner noch mit etwa 1800 Wörtern haushalten. Der Autor des Berichts, Dr. Arthur S. T r a c e, Englischprofessor an der John C a-roll University in Cleveland, macht dafür hauptsächlich den Elementarunterricht verantwortlich. Man lehrt nicht buchstabieren, sondern in einer von Bildern unterstützten Me-
thode, die das Einzelwort sofort als Gesamtheit erfassen will.
Noch beißender und sarkastischer wird die Kritik am Gipfel der Bildungspyramide. Dr. A. Whiteney G r i s w o I d, Präsident der Universität Yale, hat sich tapfer in die Reihe der Ankläger gestellt. Ihm geht es natürlich vor allem um die Idee der Universität, die, wie er sagt, noch immer unter der „Tankstellen-Auffassung“ (service Station coneept) leidet. Man füllt sich mit Spezial-wissen an und wird im Grunde „ungebildet“ entlassen. Die Kritik Gris-wolds gewinnfauch eminent politische Bedeutung, wenn er auf die gefährliche Abhängigkeitsmöglichkeit zwischen Geldgebern und Universität hinweist. Die alten und weltberühmten Universitäten, wie Harvard, Yale und Prince-ton, sind „privat“, das heißt, ihre Geldquellen sind a) Studiengelder (wie überall unzureichend), b) Geldgeschenke für bestimmte Zwecke (zum Beispiel Errichtung eines neuen Lehr-
stuhls in einem Spezialfach, der dann öfter nach dem Geldgeber benannt wird), c) Gelder von Stiftungen (Ford, Guggenheim usw.) für bestimmte Forschungsaufgaben und Bauten, d) Geldgeschenke der Industrie. Vor allem hat Punkt c) einen Pferdefuß. In dem Kommentar zu Griswolds Interview über die Zahl der Universitäten wird ein Paradefall einer solchen „Industrieprostitution“ beschrieben. Michigan State University nahm einen Vierjahreskurs in „Fertighauskunde“ mit B.-A.- (Bakkalaureus-) Abschluß in ihr Programm auf. Der Kurs wurde auf Verlangen und mit finanzieller Unterstützung (Umschreibung für die Zahlung) der Industrie eingerichtet. Aber gerade gegen solche Projekte richten sich Griswolds Angriffe. „Fertighauskunde“ ist an sich schon ein fragwürdiges akademisches Lehrfach. Wesentlich aber ist, daß eine derart von außen materiell und propagandistisch gesteuerte Vorlesung nur sehr schwer aus der Fertighauskunde
eine „Fertighauskritik“ entwickeln kann. „Jede Institution muß ihren Mäzenen klarmachen, daß die Universität mit ihren Prinzipien keine Kompromisse schließen kann und daß man ihr das weder vorschlagen soll noch sie dazu zwingen darf“ (Gris-wold).
Mit diesem idealistischen Aufruf schließt der Lagebericht über die „amerikanische Erziehung im Umbruch“. Die Grunddiskussion scheint fast abgeschlossen, und man kann überzeugt sein, daß die Früchte nicht ausbleiben werden. Eine Rückbesinnung auf die Situation im eigenen Haus wäre im Anschluß daran sicher heilsam. Es steht nirgends geschrieben, daß das europäische System — um einige hundert Jahre älter und an erstklassigen Ergebnissen reich — auch in Zukunft seinen Stand halten wird. Vor allem dann nicht, wenn gewisse Traditionen unangepaßt und kritiklos so lange weitergegeben werden, bis sie zu leeren Hülsen geworden sind.