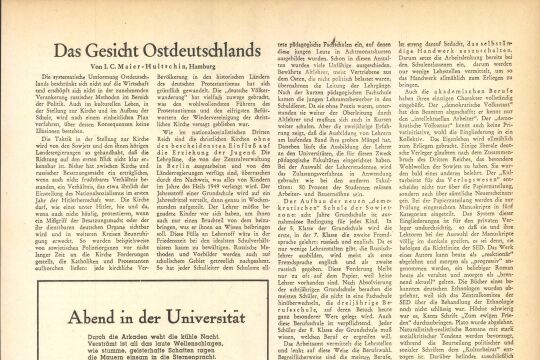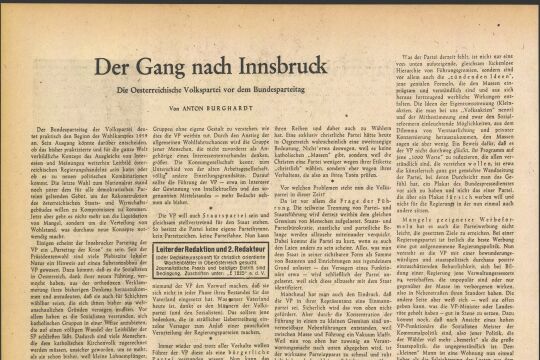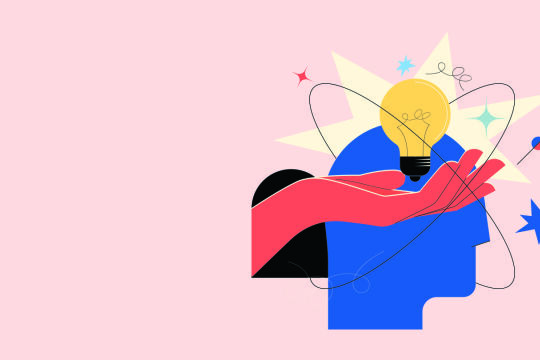Ende November 1996 hätte es endgültig präsentiert werden sollen, das Lehrerleitbild. Das Selbstverständnis der Profession soll darin unmißverständlich formuliert werden und solcherart dem Ijehrer-stand neues Selbstbewußtsein geben.
Darauf müssen Öffentlichkeit und Lehrer nun noch länger warten. Denn die bisherige Diskussion des Entwurfes erwies sich als wesentlich schwieriger als das von Lehrergewerkschaften mit der Erstellung beauftragte Personalberatungsbüro erwartet hatte. In Österreich hoffte man, in ein paar Monaten das diskutieren zu können, wofür sich die Schweizer Lehrer mehrere Jahre Zeit genommen hatten. So gab es denn auch von Anfang an massive Auffassungsunterschiede zwischen Lehrern an Pflichtschulen und jenen an AHS. Deren Kollegen an Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen erarbeiten sicherheitshalber gleich ihren eigenen Entwurf.
Zweifellos sind die Lehrer unterwegs. Nur: Wohin geht die Reise? Was soll in diesen Zeiten immer rascheren Wissensumschlags gelehrt werden? Längst ist der Konsens darüber zerbrochen, was zur wissensmäßigen Grundausstattung gehören soll. Und auch über das Wie, über die Methoden also, gehen die Meinungen weit auseinander. Denn Eltern, Schüler, Wirtschaftssprecher und Bischöfe, Politiker, Medienleute und Umweltschützer, einfach alle halten sich in Schulfragen für Experten.
Von „den Lehrern" zu reden trifft die Sache natürlich ungefähr so genau, als wollte man von „den Italienern", „den Frauen" oder „den Politikern" reden. Zu unterschiedlich ist die Arbeitssituation von Fall zu Fall: Da gibt es einerseits Megaschulen wie die Mödlinger Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt mit über 2.900 14- bis 20jährigen Schülern und über 300 Lehrern. Andererseits unterrichtet der einzige Lehrer der ein- bis achtklassigen Volksschule in Kristberg bei Schruns gerade fünf Schüler. Eine Lehrerin der Allgemeinen Sonderschule für leistungsbehinderte und lernschwache Kinder im Vorarlberger Lochau ist mit völlig anderen Verhältnissen konfrontiert als der Professor am Bundesoberstufenrealgymnasium an der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt, wo 218 Burschen in Uniform in elf Klassen sitzen (Zahlen für Schuljahr 94/95).
„Retter der Welt"
In ihrem Berufsalltag sind Lehrer ständig mit äußerst heterogenen Anforderungen konfrontiert. Das ist nicht neu. Schon im 19. Jahrhundert mokiert sich der deutsche Pädagoge Diesterweg: „Mit Recht wünscht man dem Lehrer die Gesundheit und Kraft eines Germanen, den Scharfsinn eines Lessing, das Gemüt eines Hebbel, die Begeisterung eines Pestalozzi, die Wahrheit eines Tillich, die Beredsamkeit eines Salzmann, die Kenntnis eines Leibniz, die Weisheit eines So-krates und die Liebe Jesu Christi."
Die Lehrer sollen über die Schule die Welt retten. Indem sie den Kleinen beibringen, wie man das wieder in Ordnung bringt, was die Erwachsenen konsequent zerstören. Die Umwelt zum Beispiel. Schließlich „muß man schon in der Schule anfangen ... , wie Ijehrer dauernd zu hören bekommen, wenn irgendwo etwas zum Problem wird.
Neuerdings kommt zu den bereits existierenden Aufgaben eine Vielzahl neuer Belastungen hinzu. Beispielsweise die Sorge um den Arbeitsplatz. Konnten vor Jahren viele Lehrer sich noch an reichlich lukrativen Überstunden erfreuen, gibt es heute Junglehrer, die mit Müh' und Not an insgesamt vier Schulen auf ihre Lehrverpflichtung kommen. Dennoch müssen sie von Jahr zu Jahr um die Verlängerung ihres Vertrages zittern. Lange vorbei sind die Zeiten, als junge Lehrer sozusagen automatisch nach vier, fünf Jahren Unterrichtstätigkeit in das sogenannte „definitive Dienstverhältnis" übernommen wurden. Heutzutage müssen sich Junglehrer höherdienen wie junge Arbeitnehmer in Wirtschaftsbetrieben. „Freiwillig" übernehmen sie dann eine der vielen zeitaufwendigen, unbezahlten Tätigkeiten: das Installieren neuer Software oder das nächtliche Beseitigen von Computerviren, Mitarbeit bei der Erstellung eines Jahresberichtes, bei der Betreuung der Schulbuchaktion oder bei der Durchführung von Projekten.
Jene, die voll angestellt sind, hetzen vormittags von der Gangaufsicht zum Kopierer, zum Telefon (Organisation eines Lehrausgangs), zu einem dringenden Gespräch mit einer Mutter (Nimmt die Tochter Drogen?), zu ei-ner'Besprechung mit den Fachkollegen (die Flüge für die Sprachintensivwoche in Irland müssen gebucht werden), in die Lehrmittelsammlung für audiovisuelle Medien (Sony, die Videokamera ist in Reparatur), zum Postfach (Info-Blatt zum Tag des Waldes) und zur Erlaßmappe („Wir Schülerinnen helfen Mostar", „Eishockey Weltmeisterschaft 1996 -Eintrittskarten-Sonderaktion für Schüler", und wieder ein Wettbewerb: „Kids in Fashion II"). Dazwischen wird unterrichtet. Nachmittags dann Konferenzen zum neuen Schulprofil oder zur Rechtschreibreform, Kontakte mit Sponsoren, Info-Gespräch mit dem Schularzt über sexuellen Mißbrauch. Dazwischen wird vorbereitet und korrigiert. Abends dann der Klassenelternabend.
Der Innsbrucker Erziehungswissenschafter Bernhard Rathmayr bemerkt treffend: „Die Schule ist zunehmend zu einer Art Wissensmuseum geworden." Die Spannung und Diskrepanz zur Lebenswelt außerhalb der Schule wird ständig größer. Das gilt sowohl für drastisch veränderte Sozialmuster wie für den technischen Fortschritt. Während in der Arbeitswelt ein Technologieschub auf den anderen folgt, ist in der Schule von diesen Entwicklungen immer noch kaum etwas zu bemerken. Daß Lehrer oder Schüler die riesigen Möglichkeiten multimedialer Info Technologie nutzen, ist immer noch die große Ausnahme. Zumal an vielen Schulen nicht einmal der Zugang zu einem Kopierer uneingeschränkt möglich ist.
Nicolas Negroponte, Berater von Regierungen wie Technologie-Mul-tis, schreibt in seinem Bestseller „Total Digital": „Wenn ein Lehrer aus der Mitte des 19. Jahrhunderts mit einer Zeitmaschine in einen Klassenraum von heute transportiert würde, könnte er - abgesehen von geringen fachspezifischen Details - die Arbeit seines Kollegen aus dem späten 20. Jahrhundert fortsetzen."
Zum Streß infolge fehlender Infrastruktur kommen die psychischen Belastungen aus dem Umgang mit mehr und mehr verhaltensauffälligen Kindern. Immer öfter werden Lehrer in die Rolle von Amateur-Sozialtherapeuten gedrängt. In Dänemark sind Lehrer der 1. Klasse der Grundschule verpflichtet, Hausbesuche bei den Eltern zu machen. Sie sollen genau sehen, unter welchen privaten Bedingungen ihre Schüler aufwachsen. Sie sollen sich auch dafür * zuständig fühlen, keineswegs nur für die Vermittlung gesicherten Wissens. So weit ist man hierzulande noch nicht. Dennoch ist der Trend, Schulen zu psy-chohygienischen Institutionen zu machen, auch an unseren Schulen deutlich erkennbar.
Dazu kommt neuerdings an vielen Schulen noch der Kampf um Ressourcen dazu. Denn im Gefolge der sogenannten Autonomie sind die Schulen aufgefordert, sich ihr eigenes Profil zu geben. Je nach Standort und Schülerpopulation sollen sie Ausbil dungsschwerpunkte bilden und so für Schüler und deren zukünftige Arbeitgeber gleichermaßen attraktiv sein. War das österreichische Bildungswesen bisher besonders obrigkeitsstäat-lich bis in kleinste Details reglementiert, wird nun den Schulen größere finanzielle, pädagogische, administrative und personelle Eigenständigkeit zugestanden. Von der Deregulierung und Dezentralisierung erwarten sich die Bildungsmanager so etwas wie lei-stungsstimulierende Konkurrenz.
Verordnete Autonomie
Denn Ministerin Gehrer wünscht sich selbständige Lehrer, die mit ihren Kollegen am Profil der Schule arbeiten. Die meisten tun das bereits, so wie die Lehrer an 21 von 22 Grazer Hauptschulen, die einen Schulversuch anbieten. Im Zuge dieser Schulversuche zum Sozialen lernen, zur Integration behinderter Kinder oder zum interkulturellen Lernen sind die Lehrer aufgefordert, entsprechende Schulprofile zu erstellen. Da wird dann mitunter krampfhaft die eigene von der Nachbarschule abgegrenzt. Für die Lehrer bedeutet dies, daß sie nun in zusätzlichen stundenlangen Besprechungen und Sitzungen Entscheidungen treffen sollen, die bisher an anderer Stelle getroffen wurden.
Die von oben verordnete Schulautonomie bewirkt jedenfalls, daß Lehrer sich immer öfter nicht mehr über Schüler und Klassen oder über den Unterricht verständigen, sondern über Fragen, die bisher von Schulpolitikern entschieden wurden. Pädagogische Gesichtspunkte bleiben dabei häufig auf der Strecke.
Was ursprünglich so schön nach Selbstbestimmung geklungen hat, erweist sich nunmehr immer öfter als höchst problematische Angelegenheit. Massive Konflikte in den Kollegien, Verunsicherung und Verschlechterung des Sozialklimas unter Lehrern sind die Folge. Plötzlich werden die Differenzen zwischen „engagierten" Idealisten einerseits und eher „joborientierten" Pragmatikern andererseits virulent.
Nach und nach werden die Schulen auf das Terrain des freien Marktes gedrängt. Ein ungewohntes Terrain für Direktoren und Lehrer. Vorbereitet wurden sie darauf nicht. So wird dann also bei der Suche nach Sponsoren di-lettiert. Oder man vermietet über einen neu gegründeten Schul verein Räumlichkeiten, wie am RG und ORG 23 in Liesing. Die Folge: Streit im Lehrkörper. Wenn der Schulverein dann den Schülern einen Tennis- oder Volleyballkurs gegen Kostenbeiträge anbietet, ist das für die einen völlig akzeptabel. Andere sehen darin bereits das Vordringen der Marktwirtschaft in den Schulbereich.
Schul-Management
Die Schulen werden zunehmend als Wirtschaftsbetriebe gesehen. Der schulische „Wirtschaftsliberalismus" mag zwar noch heftig umstritten sein, in der Sprache hat sich die neue Führungskultur längst niedergeschlagen: Die Schüler werden zur „Klientel", der Klassenvorstand bildet die mittlere Management-Ebene. Total-Quality-Management soll in den Schulen eingeführt werden. Auf der organisatorischen Ebene fehlt es allerdings hinten und vorne an fast allem, was in Wirtschaftsbetrieben selbstverständlich ist. Anders als am freien Markt mangelt es im Schulwesen weiterhin an jeglichem Anreizsystem. Bei den pragmatisierten Lehrern liegt es ganz am einzelnen, ob er sich engagiert oder nicht; Aufstiegsmöglichkeiten gibt es ohnehin so gut wie keine.
Ein tiefgreifender Paradigmenwechsel ist jedenfalls im Gange: Die Lehrer mutieren von Hütern eines anerkannten Wissensschatzes zu Begleitern der Lernenden, zu Bildungsanimateuren, zu Erziehungsfachleuten. Und sie werden ihre Arbeit früher oder später an europäischen Standards vergleichen lassen müssen.
Eine differenzierte Gesellschaft braucht eine differenzierte Schule. Gleichzeitig sind aber bereits Entwicklungen sichtbar, die genau in die entgegengesetzte Richtung weisen, nämlich zu Vereinheitlichung und in -ternationaler Vergleichbarkeit. Nicht erst seit Österreich Vollmitglied der Europäischen Union ist, wird im Bildungswesen von Internationalisie-rung geredet. Wenn sich Arbeitskräfte am Binnenmarkt grenzüberschreitend frei bewegen können, wenn EU-Bürger sich in allen Mitgliedsländern niederlassen dürfen, stellen sich natürlich Fragen hinsichtlich der Vergleichbarkeit der Bildungsabschlüsse.
Sponsoring, Entwicklung von Schulprofilen im Bahmen der Autonomie, neue Konkurrenz, Ausdifferenzierung einerseits und europäische Vereinheitlichung andererseits, und all das zusätzlich zu den traditionellen Aufgaben - das ist für viele Lehrer ein bißchen viel auf einmal. Und manchem schlicht zuviel. Die Zahl derjenigen, die lieber heute als morgen der Schule den Rücken kehrten, ist Legion. Mangels Alternativen bleiben sie in der Schule und verrichten weiter frustriert ihren Dienst. Eine der möglichen Reaktionen ist mittlerweile an einzelnen Schulen bereits Realität: Sie definieren ihr Profil genau konträr - sie machen den ganzen Rummel einfach nicht mit. Sie bieten Schülern und Eltern heimelige Atmosphäre, Ruhe und Gelassenheit. Und sind gerade damit am neuen Bildungsmarkt erfolgreich.