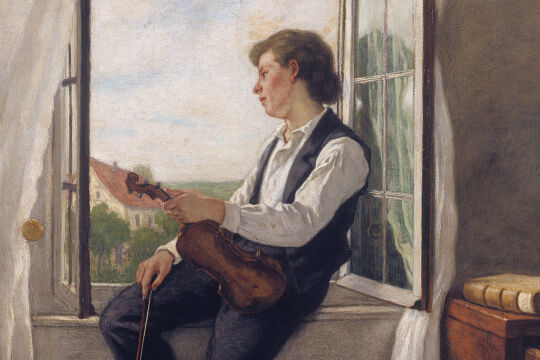Schule: Ein flirrendes, schwebendes Kollektiv
Guter Unterricht ist wie ein Konzert, in dem alle Instrumente zusammenspielen. Auch wenn die Violine quietscht, der Schlagzeuger zappelt, die Cellistin keine Noten lesen kann. Eine Komposition.
Guter Unterricht ist wie ein Konzert, in dem alle Instrumente zusammenspielen. Auch wenn die Violine quietscht, der Schlagzeuger zappelt, die Cellistin keine Noten lesen kann. Eine Komposition.
Ich weiß. In Frankreich wurde ein Lehrer enthauptet, weil er anhand von Mohammed- Karikaturen über Meinungsfreiheit sprechen wollte, und in Wien randalierten daraufhin Jugendliche („südländische“, hieß es in den Medien) in einer Kirche. Ja, ich weiß. Während Ihr Siebzehnjähriger online zu Hause unterrichtet wird, teilen sich vier Kinder einer Familie im weniger schicken Nachbarbezirk einen Computer (oder keinen). Denken Sie bitte trotzdem zu Beginn mit mir an Beethoven. Nur kurz.
Katharina Tiwald im FURCHE Podcast
Im Oktober besuchte ich ein Konzert; es war kalt und finster gewesen unterwegs, das Publikum war – 2020, Sie wissen schon – versetzt geschlichtet. Ich war grimmiger Stimmung und dachte an Beethoven in der Schule, weil ich täglich an die Schule denke. Lebensdaten vielleicht. Politische Zusammenhänge. Die Taubheit natürlich. Die Tatsache, dass Beethoven die Kreutzer-Sonate ursprünglich dem Geiger George Bridgetower gewidmet hatte, Sohn eines Esterházyschen „Kammermohren“, dunkelhäutig also (politische Bildung, Geschichte); die beiden verkrachten sich aber über einer Frau, ergo Kreutzer-, nicht Bridgetower-Sonate (lebenspraktische Unterrichtsgespräche, soziales Lernen).
Weil ich in einer dieser übellaunigen Stimmungen war, in denen man am liebsten in Ruhe gelassen wird, waren meine Erinnerungen gefärbt: ich dachte grimmig an eine Praxisstunde in meiner pädagogischen Ausbildung, während derer zu klassischer Musik gemalt werden sollte. Meditationsartig. Als Schülerin, dachte ich, hätte ich es gehasst, zu Musik irgendwas malen zu müssen. Ich versuchte, mich einstimmend auf das Konzert, jeglichen Schulgedanken zu verdrängen. Ich habe ja, dachte ich, auch noch ein Leben abseits der Schule.
Literatur ist kein Vorrecht für Gymnasien. Warum soll nur ein Gymnasiast wissen dürfen, wer Kafka oder Goethe waren?
Dann bevölkerte sich die Bühne. Die Musik begann. Ich beobachtete die Bewegungen der Hände, die Bögen führten. Ich hörte zu. Ging den Tonfolgen nach, sah meinem Geist zu, wie er in die Musik tauchte. Und irgendwas legte sich in mein, sagen wir, Herz. In Gedanken trank ich sogar Kaffee mit jemandem, den ich seit fünfzehn Jahren nicht gesehen habe und an den ich mich eigentlich nicht allzu gern erinnere. Das tat sich in meinem Kopf, in den die Schule sprungartig zurückkehrte: Was für eine großartige Idee, zu klassischer Musik zu malen; wie wunderbar, wenn sich vor den Ohren gerade jener, die den Namen Beethoven noch nie gehört haben, ein Panoptikum von Freude auftut, Genuss, wie die Musik sich in die Körper hineinschleicht und nicht mehr aus ihnen weichen wird. Wie sich die Musik immer wieder zu den jungen Malenden zurückschleichen wird. Sich in sie hineinpirschen. Ihr Leben lang. Und das alles, während sie gemeinsam malt, die Gruppe, die Klasse, die kleine Gemeinschaft, die sich durch Zufall – und das Schulunterrichtsgesetz, das nur schwer zulässt, dass sich jemand abseilt – gebildet hat.
Ich dachte genau diese zwei Worte: flirrendes Kollektiv. Ich dachte: So soll Schule sein, ein flirrendes, schwebendes Kollektiv. Mag sein, dass die Digitalisierung durch uns hindurchrollen wird, mag sein, dass wir die großen Fragen, die durch die Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte entstanden sind, nicht einmal annähernd beantwortet haben. Das aber gilt: Schule ist ein flirrendes, schwebendes Kollektiv, guter Unterricht hat etwas von einem Konzert, in dem alle Instrumente zusammenspielen. Das mag kitschig klingen. Aber es ist die Wahrheit.
Die Klasse als Orchester
Eine der größten internationalen Metastudien der letzten Jahre, die Hattie-Studie, weist darauf hin, dass der Garant Nummer eins für erfolgreichen Unterricht nichts und niemand anderer ist als die verantwortliche Lehrperson, daran ändert auch das Herumschrauben an der Klassenschülerhöchstzahl wenig bis nichts. Sehen Sie? Die Klasse – ein Orchester, der Unterricht – ein Konzert. Nun quietscht ab und zu die Violine links hinten. Die Cellistin würde gern anfangen, kann aber keine Noten lesen. Möglich, dass der Posaunist dem Bratschisten vor der Probe einen (Milch-) Zahn ausgeschlagen hat; vor dem Konzertsaal musste sich die Tubaspielerin von einem Passanten anhören, dass sie in Österreich nichts verloren hat, außerdem stehen drei Oudspieler und noch drei Menschen mit jeweils einem völlig fremden Instrument in der Tür und wollen auch mitmachen. Der Schlagzeuger kann keine zwei Minuten still sitzen. Die Hornistin ist Autistin.
Aus Privatschulen kenne ich nur Anekdoten wie die des pickligen Teenies, der seiner Kunstlehrerin zu verstehen gab, dass er nicht daran denke, die von ihr gestellte Aufgabe zu erfüllen, denn: „Ich krieg so viel Taschengeld wie Sie verdienen.
Aus meiner eigenen Bildungsbiografie kenne ich all das nicht. Wir fuhren auf Schikurse und ins Theater, lernten Schillers Bürgschaft auswendig. Ab und zu gab es einen kleinen Skandal, weil jemand sich an Eierlikör übersoffen hatte und ins Schulklo kotzte. Fast alle sprachen zu Hause Deutsch. In der (ehemals Neuen) Mittelschule am Rand von Wien, an der ich unterrichte, sieht die Lage ein bisschen anders aus – eher so wie die Orchesterprobe, bei der die Spielenden der Oud, Marimba und Djembé schon Platz genommen haben.
Aus Privatschulen kenne ich nur Anekdoten wie die des pickligen Teenies, der seiner Kunstlehrerin zu verstehen gab, dass er nicht daran denke, die von ihr gestellte Aufgabe zu erfüllen, denn: „Ich krieg so viel Taschengeld wie Sie verdienen.“ Von außen dringen allerhand Zurufe zu uns herein, angefangen von den Fantasien, was Schule alles zu erfüllen hätte (Gesundheitsbildung, Finanzführerschein, Ethik, politische Bildung etc. pp.) bis hin zu gesellschaftlichen Gegebenheiten, die sich natürlich in den Klassenzimmern abbilden – sei es der kleine, blonde Wiener, der mit dem Spruch „Der Abdel ist ein Scheißausländer“ auf den Lippen aus der Pause zurückkehrt, oder der Wiener mit türkischen Eltern, der, als ich erschüttert vom Mord an Samuel Paty erzähle, als einziger unter den (hauptsächlich muslimischen) Kindern, die so entsetzt waren wie ich, meinte: Dieser Lehrer war sicher ein Rassist. (Fußnote: Ich erinnere an den heurigen Vorfall in Bad Hall, wo eine Lehrerin in der lokalen Zeitung berichtete, die Flüchtlingskinder in ihrem Deutschkurs hätten sich nach einer Straßenumfrage unter Passanten bei ihr erkundigt, was denn das Wort „Gsindl“ bedeute. Alles bildet sich ab. Unsere Schülerinnen und Schüler bekommen zu spüren, wie die Gesellschaft tickt.)
Was wir in solchen Fällen tun, ist ein Gespräch zu führen: ein Gespräch, das nie abreißt, über Jahre hinweg nicht. Darin sehe ich die Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern, gerade im Pflichtschulbereich: Nicht nur dort, wo es um gesellschaftspolitische Fragen geht, sondern auch im höchstpersönlichen Bereich. Lassen Sie mich klar werden: Als eine Gruppe Vierzehnjähriger am Ende des Films über den Hitler-Attentäter Georg Elser murmelte, dessen Geliebte sei ja eine Hure gewesen, sagte ich entnervt, dass ich in meinem Leben auch mit mehr als einem Mann geschlafen hätte und trotzdem keine Hure sei. Stille. Nur die lauteste, größte Schülerin fragte verdattert: „Sie sind keine Jungfrau mehr?“ und stellte mir nach der Stunde unter vier Augen jede Menge Fragen.
Schüler sind keine Maschinen
Ja, manchmal sitzt in einer Klasse jemand, der oder die versucht, eigene religiöse Bedürfnisse anderen überzustülpen, oder auf unangenehme Weise äußert, wie sehr er oder sie einem – in der Realität eher fiktiven – Heimatland verbunden ist. Was passieren muss, ist ein fortlaufender Diskurs. Was kontraproduktiv ist, ist das Schellen der Alarmglocke und damit das eilfertige Mitmachen bei den düsteren Prophezeiungen von der rechten Seite des politischen Spektrums. Es tut mir im Übrigen sehr weh, wenn ich eine Klasse voller Kinder, die hauptsächlich in Wien geboren sind, frage, wer sich als Ausländer fühle, und ein Wald von Armen hochgeht: Da stimmt etwas ganz Grundlegendes nicht. Es ist auch nicht stimmig, in umgekehrter Richtung zu agieren, in einer Art Pseudosäkularisierung christliche Symbole und Rituale aus dem öffentlichen Raum zu verbannen und sozusagen im Davonrücken jedweder Empfindsamkeit an derer Religionen nachzugeben, weil man den Vorwurf fürchtet, ein Rassist zu sein.
Lässt sich keine kreative Mitte finden? Ich erinnere mich an einen Vorschlag Heide Schmidts zu Zeiten, da es noch das Liberale Forum gab: Warum nicht ein Zeichen aus jeder in der Klasse vertretenen Religion anbringen? Die Kinder und Jugendlichen haben auch in diesem Wissensgebiet – und ja, es ist ein Wissens-, nicht nur ein Gefühlsgebiet – drängende Fragen. Als Deutsch- und Geschichtelehrerin gebe ich diesen Fragen immer Raum, sie gehören zu einer ganzheitlichen, menschlichen Bildung; das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum aus all den Vorschlägen, die der Schule zugerufen werden, der Ethikunterricht unbedingt eingeführt werden muss. Unsere Schülerinnen und Schüler sind keine Maschinen, die man nur zurichten muss, damit sie dann in der Wirtschaft funktionieren. Mir sind faule, laute, auch unangenehme Schülerinnen und Schüler begegnet, aber noch niemand, der nicht irgendeine Seite gehabt hätte, die man zum Schwingen bringen kann, ein Interessensgebiet, das man entdecken, über das man mit dem Kind, dem Jugendlichen in Kontakt kommen kann.
Es ist auch nicht stimmig, in umgekehrter Richtung zu agieren, in einer Art Pseudosäkularisierung christliche Symbole und Rituale aus dem öffentlichen Raum zu verbannen und sozusagen im Davonrücken jedweder Empfindsamkeit an derer Religionen nachzugeben, weil man den Vorwurf fürchtet, ein Rassist zu sein.
Dazu gehört im Übrigen auch die Literatur. Es gibt kaum etwas, das mich stärker in Rage bringt als die Vorstellung, in unserem so sträflich- säuberlich getrennten Schulsystem sei es ein Vorrecht der Gymnasien, sich damit zu beschäftigen. Wir verzieren Goethes Portrait zu Halloween und lesen das Hexeneinmaleins aus Faust, wir lesen Gedichte, wir schreiben Alternativentwürfe zu Kafkas Metamorphose: Wie geht es weiter mit Gregor Samsa? Warum soll nur ein Gymnasiast wissen dürfen, wer Kafka war – wenn er es überhaupt noch weiß in diesem Standardtest-wütigen Land, das auf die humanistische Bildung vergisst (und auch die digitale Bildung bleibt nur so gut wie die Bildung im Lesen)? Stattdessen „Kompetenzorientierung“ allerorten.
Gestatten Sie mir auch hier eine rasche Fußnote zu einer Selbstverständlichkeit: Die OECD – in den Worten der deutschen Zeitschrift Focus „keine Hippie-Organisation“ – empfiehlt deutlich, Kinder nicht nach Leistungen zu trennen, sondern im Gegenteil langes gemeinsames Lernen zu ermöglichen. Das funktioniert dann, wenn für soziale Durchmischung gesorgt ist und die Ansammlung von Kindern aus sozial schwachen Familien an Brennpunktschulen vermieden wird. Punktum. Die sprachliche Bildung wird in Zukunft zu den brennendsten Fragen gehören, der Didaktik von Deutsch als Zweitsprache muss ein Fixplatz in der Lehrerbildung gegeben werden. Gleichzeitig muss es ohne gesellschaftliches Geschrei selbstverständlich werden, dass Lehrende sich im Rahmen ihrer Fortbildungen Grundzüge der Sprachen aneignen, die in österreichischen Schulen (auch) gesprochen werden. Türkisch zum Beispiel.
Es gibt Schülerinnen und Schüler, die zu Hause nicht Deutsch sprechen und ihre bio-österreichischen Kollegen auch im Fach Deutsch mühelos überflügeln. Es gibt aber auch viele, die zwar hier geboren sind und trotzdem, in einer linguistisch sicher systematisch zu beobachtenden Regelhaftigkeit, falsche Artikel verwenden oder grammatische Regeln übergeneralisieren, zum Beispiel „meiner Cousine Freundin“ nach dem Muster „Ninas Tasche“.
Was wir tun, ist ein Gespräch zu führen. Ein Diskurs, der nie abreißt, über Jahre hinweg nicht. Darin sehe ich die Hauptaufgabe von Lehrerinnen und Lehrern.
Die Lehrkörper, die tatsächlich Körper, Geist und Herz sind, brauchen dazu alle Unterstützung, die sie bekommen können – angefangen von genügend Platz und Raum in den Schulen, die schleunigst umgerüstet werden müssen, damit im Mai nicht schon um neun Uhr die ersten durchgeschwitzt sind, über deutlich mehr Unterstützungspersonal, sowohl administrativ als auch pädagogisch, bis hin zur politischen Vision, die bitte die Trampelpfade der Parteipolitik endlich verlassen möge.
Bitte weniger predigen, mehr machen – und lebensnah denken. Die Direktorin der Volksschule Eisenstadt, Charlotte Toth-Kanyak, nennt die TÜV-Vorschriften, die es verunmöglichen, dass Eltern mit Schülern gemeinsam auf dem Schulgelände Weidenhütten errichten, und wünscht sich vor Ort gekochtes Essen aus regionalen Produkten statt der schockgefrorenen Ware, die standardmäßig in großen Wannen angeliefert wird. Muslimische Schülerinnen und Schüler werden gern bestätigen, dass es eigentlich haram, also verboten ist, Essen wegzuwerfen. In Österreichs Schulen ist das tägliche Realität.
Ganz lebenspraktisch geht mir jetzt der Platz aus; erlauben Sie mir bitte kurz noch, mit Nachdruck die Abschaffung der tausend Zettel (ich sage nur „Kompetenznachweis“) anzuregen. Die gewonnene Zeit kann zum stundenlangen Zeichnen und Musizieren genützt werden. Sinfonie mit Cello und Djembé. Dankeschön.
Die Autorin ist Lehrerin und Schriftstellerin. Jüngst erschien: „Macbeth Melania“ (Milena 2020).

Hat Ihnen dieser Artikel gefallen?
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!
Mit einem Digital-Abo sichern Sie sich den Zugriff auf über 40.000 Artikel aus 20 Jahren Zeitgeschichte – und unterstützen gleichzeitig die FURCHE. Vielen Dank!