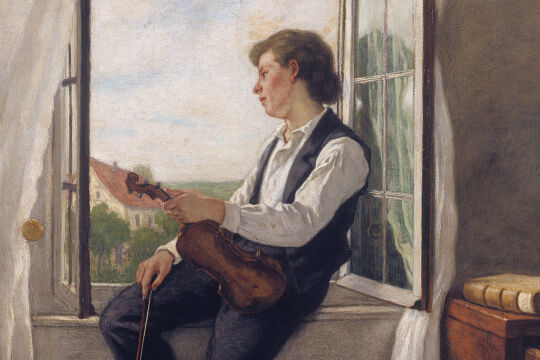"Non scholae, sed vitae discimus", predigt der Lateiner. Was aber, wenn er sich täuscht? Wenn die Schule nie mehr als Selbstzweck war? In der Wissensgesellschaft stellt sich die Frage "Wozu Schule?" dringlicher denn je. Ist sie Hort der Bildung, Erziehungsanstalt, Ausbildungsstätte, Lebensraum - oder wird von ihr erwartet, alles in einem sein zu müssen? Als Auftakt zu einer achtteiligen Serie über die "Zukunft der Schule" (Redaktion: Doris Helmberger) lädt die Furche zur Debatte.
Die Furche: Herr Professor Schirlbauer, Sie haben in Ihrem Buch "Junge Bitternis - Eine Kritik der Didaktik" gemeint: "Zur zentralen Aufgabe des Lehrers gehört es, den Schülern gegenüber eine Sache in ihrer fachlichen Differenziertheit zu vermitteln. Fernsehen, Bravo, Gruppentherapeuten oder Animateure braucht er nicht zu imitieren." Wird aber der Lehrberuf und mit ihm die Schule insgesamt nicht immer stärker in diese Rolle gedrängt?
Alfred Schirlbauer: Zuerst einmal sollten wir uns daran erinnern, zu welchem Zweck Schule vor rund 250 Jahren von Maria Theresia flächendeckend eingeführt wurde - nämlich zum Zweck der Modernisierung der Gesellschaft, die noch weitgehend landwirtschaftlich geprägt war, und zu dem Zweck, über den Leistungsgesichtspunkt eine neue soziale Schichtung einzuführen. Damit war der Startschuss gegeben für eine Gesellschaft, die sich 250 Jahre später Wissensgesellschaft nennen wird. Nun zu Ihrer Frage: Natürlich hat die Schule auch einen Erziehungsauftrag, natürlich kann ein Lehrer nicht so operieren wie mein ehemaliger Mathematiklehrer, der ohne ein persönliches Wort an die Tafel gegangen ist und an der Stelle der Formel fortgesetzt hat, bei der er das letzte Mal stehen geblieben ist. Natürlich besteht die Aufgabe, transdisziplinäre und lebensweltliche Bezüge herzustellen. Aber die Kernkompetenz der Schule muss die Wissensvermittlung bleiben, wenn sie nicht dysfunktional und auch zu teuer werden will.
Die Furche: Arbeitet die Schule im Moment dysfunktional?
Schirlbauer: Sagen wir so: Sie könnte besser werden. Vor allem, was traditionelle Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schülerschaft anlangt, sollte man sich wieder rückbesinnen: etwa bei Orthografie und Grammatik. Aber natürlich sollten sich die Schülerinnen und Schüler am Ende eines zwölfjährigen Durchgangs durch die Schulstufen auch nicht ekeln müssen, wenn sie sich an ihre Schulzeit erinnern.
Die Furche: Herr Mathuber, was tun Sie als Mathematiklehrer und Schuldirektor dafür, um Ihre Schülerinnen und Schüler vor diesem Ekel zu bewahren?
Alfred Mathuber: Ich versuche, einen wirklich praxisnahen, ergebnis- und leistungsorientierten Unterricht zu bieten. Dazu gehört es auch, hinauszuschauen in die Umgebung, Kontakte mit der Wirtschaft und Firmen zu bekommen: Die Ausstattung einer Schule muss am letzten Stand sein. Nur zu jammern, dass der Staat mir zu wenig Geld gibt, bringt nichts. Ich glaube auch, dass es keinen Sinn hat zu jammern, dass immer mehr Aufgaben an die Schule übertragen werden. Das ist eine gesellschaftspolitische Tatsache. Zu sagen: Nur die reine Lehrtätigkeit ist die Aufgabe der Schule, das war vielleicht unter Maria Theresia so. Damals hat es aber keine doppelt verdienenden Eltern oder allein erziehenden Mütter und Väter gegeben. Auf diese gesellschaftlichen Veränderungen muss sich eine gute Schule sehr rasch umstellen. Dazu gehört eine vernünftige Nachmittagsbetreuung, Angebote zu Mittag und vieles mehr. Die Schülerinnen und Schüler müssen sich einfach wohlfühlen. Es geht primär um die Bedürfnisse der Schüler und Eltern, die ja unsere Kunden sind: Deshalb haben wir auch an unserer Schule die Fünftagewoche eingeführt. Seit 16 Jahren schon bezeichne ich die Schule als Dienstleistungsunternehmen. Damals hat jeder gesagt: Was will der Wahnsinnige? Jetzt betont das jeder, dem an einer guten Schule gelegen ist. Das ist ein langsamer Umdenkprozess: Aber die Eltern wählen eben nicht mehr die nächst gelegene Schule für ihre Kinder aus, sondern jene, wo es optimale Bedingungen gibt.
Christine Krawarik: Leider Gottes ist es heute wirklich oft so, dass die Kinder gemeinsam mit den Eltern das Haus verlassen, gemeinsam mit ihnen am Abend wieder nach Hause kommen und eigentlich nur am Wochenende - wenn überhaupt - Zeit mit ihnen verbringen können. Die Lehrer haben also auch Erziehungsaufgaben wahrzunehmen. Was uns aber auffällt, ist, dass sie dafür nicht immer hinreichend ausgebildet sind. Ich weiß schon, dass sich bei der pädagogischen Ausbildung der AHS- und BHS-Lehrer viel getan hat. Aber die Eltern haben nach wie vor den Eindruck, da studiert jemand zwei Fächer und dann geht er her und unterrichtet Mathematik und Physik - aber er unterrichtet nicht die Kinder in diesen Fächern. Ich bin auch entsetzt, was jüngere Lehrer im Umgang mit Kindern und Schulpartnern alles nicht beherrschen.
Die Furche: Nun kann man einwenden, dass die pädagogische Ausbildung früher auch nicht umfangreicher war, und dennoch gab es nicht so viele disziplinäre Schwierigkeiten. Liegt das Problem nicht vielmehr am Autoritätsverlust des Lehrberufs allgemein?
Schirlbauer: Ich glaube schon, dass unsere Zeit als eine des Autoritätsschwundes bezeichnet werden kann. Die "Professoren" haben keinen besonderen Status mehr in der Bevölkerung. Das ist schlechthin vorbei. Wir leben in einer Zeit, in der sich Lehrer ihre Autorität in der Arbeit mit den Schülern erst erarbeiten müssen. Und dazu gehören sehr viele Dinge - nicht nur Fachkompetenz, die ich für sehr wesentlich halte, sondern auch menschlich-pädagogische Fähigkeiten. Unsere pädagogische Ausbildung an der Universität ist jedenfalls stundenmäßig gewachsen, was man als Fortschritt begrüßen kann. Nur würde ich davor warnen, sich die Illusion zu machen, dass den Studierenden mit vier zusätzlichen Pädagogik-Stunden wesentlich größere menschlich-pädagogische Fähigkeiten zuwachsen. Ich will nicht vom geborenen Lehrer sprechen, dieser Nativismus ist mir höchst suspekt, aber eines wird man schon feststellen können: Dass zu dem, was einen guten Lehrer ausmacht, auch Lebenserfahrung gehört. Manche, die als 16-Jährige schon in der Jungschar oder bei den Roten Falken gearbeitet haben, verfügen hier sicher über mehr Erfahrung. Andere stehen vor einer Klasse, bekommen eine Gänsehaut und greifen zu absurden Machtmitteln. Die akademisch-pädagogische Ausbildung muss wohl sein, aber man sollte den angehenden Lehrern besser verordnen, in irgendeinem Jugendverein mehrmonatige Praktika zu absolvieren, damit sie überhaupt ein Gespür entwickeln, wie man mit Jüngeren umgehen soll.
Die Furche: Wie viel pädagogisches Gespür stellen Sie bei Ihren Lehrerinnen und Lehrern fest?
Claudia Haas: Das kommt ganz auf den Bereich an. Wenn ich ein Resümee über den Bereich der Berufsbildenden Höheren Schulen ziehen kann, der mich betrifft, dann ist es so, dass die Fachlehrer, die aus der Wirtschaft kommen und teilweise eigene Firmen betreiben, auf Grund ihrer Fachkompetenz teilweise sehr hoch geschätzt und respektiert werden. Bei den allgemeinbildenden Lehrern hängt es davon ab, ob sie Interesse an der Klasse zeigen. Diese soziale Kompetenz fehlt teilweise. Wenn ein Lehrer in die Klasse kommt und es ihm absolut egal ist, wie viele Leute da sind und welche Noten man schreibt, ist es logisch, dass die Schüler diesem Lehrer gegenüber keinen Respekt haben. Ich behaupte nicht, dass sich die Lehrer ihren Respekt generell erarbeiten müssen, aber man kann heutzutage nicht mehr automatisch von diesem Respekt ausgehen - vor allem dann, wenn die Kinder nur wenig Zeit mit ihren Eltern verbringen. Von wem hätten sie es lernen sollen? Die andere Frage ist aber sicher, ob Lehrerinnen und Lehrer mit diesem Autoritätsverlust umgehen können oder nicht. Man kann Kinder schnell verschrecken, wenn man sehr autoritär ist, vor allem im Pflichtschulbereich. Das zeigen auch die vielen Schülerselbstmorde in Österreich.
Die Furche: Um mehr Transparenz zu erhalten, fordern Sie als Bundesschulsprecherin eine Gesamtevaluation: Schüler sollen ihre Lehrer, Lehrer den Direktor, der Direktor die Schulaufsicht und die Eltern schließlich die Schule evaluieren. Was erwarten Sie sich von dieser Maßnahme?
Haas: Bei dieser halbjährlichen Evaluation sollte eine Statistik herauskommen, aus der man ablesen kann, wie die Schüler einen Lehrer beurteilt haben, ob er sein soziales Engagement und den Inhalt vermitteln kann oder nicht. Das soll vom Direktor gewartet werden, damit man sieht, wo man diesen Lehrer unterstützen kann. Wenn es heutzutage ein Problem mit einem Lehrer gibt, wird oft so lange geschwiegen, bis er irgendwann die Schule wechselt, in Pension geht oder ein neuer Direktor kommt. Das sind die momentanen Zustände. Es gibt natürlich auch viele sehr gute Lehrer, nur soll diese Evaluierung aufzeigen, wer Probleme hat.
Krawarik: Eine solche Gesamtevaluierung wurde vor Jahren schon in Wien gestartet - und ging völlig daneben, weil sich die Lehrer geweigert haben, hier mitzutun. Hier sehe ich derzeit überhaupt keine realistischen Chancen.
Haas: Ich habe zuletzt den Kärntner Landesschulratspräsidenten Heiner Zechmann besucht: Er hat gemeint, dass das relativ gut funktionieren sollte. Es gibt schon viele Schulen, die ein solches Feedback provisorisch erstellt haben. Hier gibt es kein Einheitsmodell - und das ist auch unmöglich. Die Schulen machen das freiwillig und gern. Es gibt eben immer ein Problem bei der Evaluierung: Sobald sie verpflichtend ist, wird es so sein, dass jemand pfuscht.
Die Furche: Wie sehr würden sich die Lehrerinnen und Lehrer über eine solche Evaluierung - eventuell mit verpflichtender Weiterbildung - freuen?
Mathuber: Mir geht es nicht darum, ob sich Lehrerinnen und Lehrer über eine verpflichtende Lehrerfortbildung freuen - die wir im Übrigen derzeit nicht haben. Ich habe als Schulleiter nicht die Möglichkeit, Lehrerinnen und Lehrer zu einer Weiterbildung zu verpflichten - leider. Die Direktorinnen und Direktorinnen sind vor allem in den Ballungsräumen um Qualität bemüht - vor allem dann, wenn die Anmeldezahlen für die ersten Klassen in ihrer Schule sinken und in der Nachbarschule steigen. Sich einfach zurückzulehnen und zu warten, bis der so genannte schwächere Lehrer in Pension geht, ist nicht die Lösung. Man muss aber nicht nur bei der Aus- und Weiterbildung der Lehrer ansetzen, sondern auch die Organisation der Schule verbessern. Es hilft nichts, wenn ein Lehrer zusätzlich zu seiner vollen Lehrverpflichtung auch noch Schülerberatungsfunktionen bekommt. Die Beispiele aus dem Ausland zeigen: Wir benötigen pädagogisches Personal, wir benötigen Personal für die Organisation und wir benötigen Damen und Herren, die psychologisch ausgebildet sind und helfen können, Probleme von Schülern und Schülerinnen in und außerhalb des Unterrichts zu lösen.
Die Furche: Im vergangenen Jahr ist kurzzeitig eine Diskussion über öffentliche Schulrankings aufgeflammt, wie sie etwa im PISA-Siegerland Finnland längst üblich sind. Was halten Sie von dieser Idee?
Krawarik: Mit diesen Rankings, die in den verschiedenen Zeitungen immer wieder auftauchen, habe ich große Probleme, weil man nie weiß, wie das zustande kommt.
Schirlbauer: Auch ich misstraue ihnen, und zwar deshalb, weil das Messverfahren, wie es momentan verwendet wird, einfach noch nicht differenziert genug ist, um verlässliche Aussagen über die Schule treffen zu können. Übrigens gibt es dieses Ranking auf der Gerüchtebörse sowieso - zumindest in Ballungszentren. Man weiß: In dieser Schule geht es hart oder auch unfreundlich zu, an jener Schule eher humaner, aber dafür darf man sich leistungsmäßig nicht so viel erwarten. Nicht zuletzt gibt es aber in schlechten Schulen auch gute Lehrer.
Die Furche: Gibt es - vom Schulranking abgesehen - im finnischen Schulsystem Zugänge, die man für das heimische Bildungswesen in Betracht ziehen könnte?
Schirlbauer: Ich habe eher den Eindruck, dass unser Schulwesen unter permanenter Dauerreform leidet. Die meisten Reformen bleiben dann auf halbem Weg im Sand stecken. Was wir brauchen, ist vielmehr ein langfristiges Konzept. Die Grundfunktion erfüllt unser Bildungswesen jedenfalls: Vor zwei Jahren hat es eine Umfrage gegeben, die empirisch bestätigt hat, was schon immer meine Hypothese war - nämlich, dass Erziehung in unserer Gesellschaft wunderbar funktioniert. 98 Prozent der Bevölkerung halten sich an die geltenden Gesetze, ohne sie zu kennen... Also wenn das kein erzieherischer Erfolg des Bildungswesens ist!
Die Furche: Aber zweifellos gibt es auch Sand im Getriebe - allein, wenn man die steigenden Ausgaben für Nachhilfeunterricht betrachtet. Kann man sich angesichts dessen wirklich zufrieden geben?
Mathuber: Nein, sicher nicht. Es gibt nur Schätzungszahlen, aber das Nachhilfewesen steigt tatsächlich an: Es muss also im Unterricht eine Veränderung geschehen. Das heißt: noch schneller weg vom Frontalunterricht, fächerübergreifender Unterricht, Teamorientierung im Unterricht, die Schüler den Stoff so weit möglich selbst erarbeiten lassen. Wir müssen weg vom Bild des Lehrers als reinem Wissensvermittler hin zum Lehrer als Vermittler von Kompetenzen: Die Jugendlichen müssen lernen, wie und wo sie sich ihr Wissen holen können.
Schirlbauer: Damit bin ich durchaus einverstanden. Nur eines in puncto Nachhilfe: Dass es das Nachhilfewesen gibt, und dass es sich hier um eine expandierende Branche handelt, kann schon am Unterricht liegen - aber es kann natürlich auch am Schüler liegen, wenn er etwa in der falschen Schule sitzt. Deshalb wage ich folgende etwas halsbrecherische Hypothese: Wenn das Nachhilfewesen expandiert, dann liegt etwas im Argen. Aber so lange es überhaupt ein Nachhilfewesen gibt, kann man mit guten Gründen sagen, dass unser Schulsystem im großen und ganzen in Ordnung ist. Erst wenn es überhaupt kein Nachhilfewesen mehr gibt, dann ist die Schule sicherlich am Ende. Denn dann verlangt sie nichts mehr. Wenn man in ihr nicht mehr scheitern kann - denn es geht ja auch um Leistung -, dann erfüllt die Schule nicht mehr die ihr gesellschaftlich zugedachte Funktion - nämlich auch jene der Selektion. Nicht jeder soll alles werden können - davon lebt unsere Gesellschaft.
Krawarik: Ich glaube auch, dass es in der Schule einer Anstrengung bedarf. Eine Schule, die jeder schafft, wünsche ich mir für meine Kinder jedenfalls nicht. Wenn es aber Schülerinnen und Schüler nur mehr durch Nachhilfe schaffen, dann haben wir ein Problem - oder die Betroffenen sitzen vielleicht wirklich in der falschen Schule.
Haas: Dem kann ich nur zustimmen: Es ist wichtig, die Möglichkeit zu haben, Nachhilfe zu nehmen - denn wenn die Schülerinnen und Schüler immer nur durchkommen und sich nicht anstrengen müssen, haben wir im Endeffekt zigtausende Maturanten, die nichts können. Meiner Meinung nach gibt es sehr viele Schulen, wo es überhaupt kein Problem ist, sich bis zur Matura durchzukämpfen - und das finde ich ehrlich gesagt schade. Es gibt in meiner Schule auch Leute, die definitiv der Meinung sind, dass sie mehr davon haben, zu Hause ein Buch oder die Zeitung zu lesen, bevor sie diese oder jene Unterrichtsstunde besuchen - und genau das wird praktiziert. Andererseits gibt es natürlich auch Fächer - bei mir ist das Kunstgeschichte -, wo man auch am Nachmittag interessiert dabei sitzt, sich sehr anstrengen und selbst nachforschen muss.
Mathuber: Wenn es bei mir als Lehrer so sein würde, dass bestimmte Damen und Herren immer wieder in meinen Stunden fehlen würden - und es gibt tatsächlich Schüler, die bei vierzig bis fünfzig Prozent der Stunden in einem bestimmten Gegenstand abwesend sind -, und wenn diese Schüler dennoch eine gute oder durchschnittliche Note erhalten würden, dann sollte das mir natürlich zu denken geben. Warum ist das in einem anderen Fach nicht so? Und hier wäre ein Feedback sehr wichtig - das der Direktor nicht zu sehen bräuchte. Aber ein guter Lehrer macht das ja von selbst: Er lernt daraus und verändert sein Auftreten. Viele sehen aber ein Feedback als Gefahr für ihre Autorität. Das ist die künstliche Autorität, die die Jugendlichen zunehmend - und ich sage Gott sei Dank - nicht mehr akzeptieren.
Die Furche: Von der vielzitierten "Wissensgesellschaft" war schon die Rede: Manche Bildungsforscher meinen nun, nachdem sich die "Halbwertszeit" des Wissens stets verkürzt, müsste auch die Schule ihr Augenmerk verstärkt auf die so genannten Soft und Life Skills legen - dazu gehören etwa soziale Kompetenz, Problemlösen, Selbstorganisation, Teamwork oder die Fähigkeit zum Lernen. Mit welchem Rüstzeug muss die Schule der Zukunft die jungen Menschen der Wissensgesellschaft Ihrer Meinung nach wappnen?
Schirlbauer: Wir sind immer schon eine Wissensgesellschaft gewesen - nicht erst sei dem Beitritt zur Europäischen Union und nicht erst, seitdem das "Lebenslange Lernen" ausgerufen wurde. Der französische Schriftsteller Paul Valéry hat etwa geschrieben, dass für ihn Europa nichts anderes ist als eine gigantische intellektuelle Transformationsmaschine, die Wissen von allen Seiten des Erdteils her ansaugt, transformiert und für seine Zwecke nützt. Das ist genau der Prozess, der Europa groß und bedeutend gemacht hat. Ich halte es also auch für eine falsche Alternative, jetzt mehr Werterziehung zu betreiben - auf Kosten des Wissens. Und zu den Life Skills: Ja selbstverständlich sollen aus den jungen Leuten Problemlöser werden. Sie sollen mit Problemen vernünftig, also rational umgehen können. Doch wie lernt man Problemlösen? Kann man es als solches lernen, oder lernt man es nicht vielmehr an Inhalten? Ich glaube, man kann Problemlösen immer nur an tatsächlichen Problemen lernen - und das sind immer inhaltliche Probleme. Das Üben von Problemlösen hat also im Fach selbst zu erfolgen, oder im fachübergreifenden Unterricht an transdisziplinären Fragstellungen. In diesem Problemlösungszirkel wird natürlich en passant auch das mitgeübt, was wir Social Skills nennen: Diskussionsfähigkeit, Toleranz und so weiter.
Mathuber: Das ist richtig: Problemlösend kann man nur dann agieren, wenn man über ein bestimmtes Wissen verfügt. Man kann das den Jugendlichen schon im Unterricht - und zwar fächerübergreifend und nicht nur in einem Fach fokussiert - vermitteln. Ich würde aber das eine nicht gegen das andere ausspielen wollen. Das ist unmöglich.
Haas: Das wichtigste ist nicht, lernen zu lernen, sondern verstehen zu lernen. Heutzutage ist der Frontalunterricht meiner Meinung nach für schulisches Lernen nicht mehr die ideale Form, sondern lernen sollte man besser im Rahmen von Projekt- und Teamarbeiten - was natürlich den Nachteil hat, dass manchmal ein Teil der Gruppe nicht mitarbeitet. Aber das wird es immer geben. Was die Allgemeinbildung betrifft, würde ich einen Schüler nicht aus der Schule gehen lassen oder ein Maturazeugnis in die Hand drücken, wenn er oder sie nur weiß, wie man lernen kann. Es muss schon eine gewisse Wissensvermittlung vorhanden sein. Aber natürlich muss der Schüler auch wissen, wo er sich sein Wissen holen kann. Wenn er das nicht weiß, dann hat die Schule versagt.
Das Gespräch moderierte Doris Helmberger.