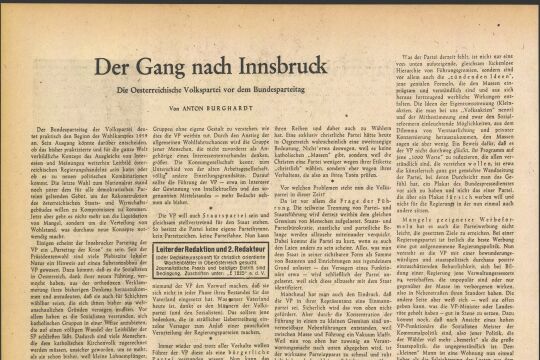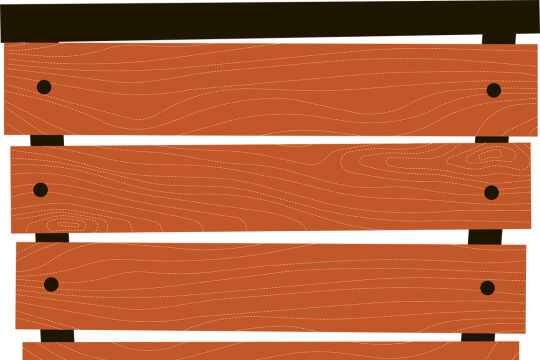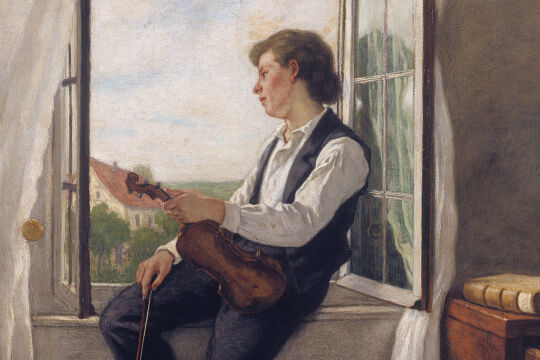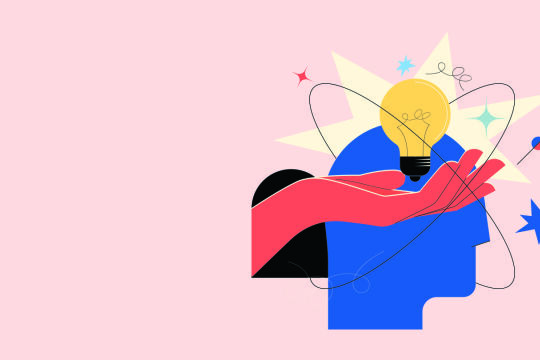Analoger und digitaler Unterricht: eine Herausforderung für Pädagog(inn)en
Dieser Herbst stellt Pädagog(inn)en vor große Herausforderungen. Was ist von ihnen zu erwarten? Was nicht? Und: Geht es nur um digitale Kompetenz? Eine Lehrerbild-Reflexion.
Dieser Herbst stellt Pädagog(inn)en vor große Herausforderungen. Was ist von ihnen zu erwarten? Was nicht? Und: Geht es nur um digitale Kompetenz? Eine Lehrerbild-Reflexion.
Was versteht man unter einem „guten“ Lehrer, einer „guten“ Lehrerin? Seit es so etwas wie Unterricht und Schule gibt, stellen sich Betroffene diesseits und jenseits des Katheders diese Frage, aber nur eines kann man mit Sicherheit sagen: Einig ist man sich nicht geworden. Zu groß sind die kulturellen Unterschiede, zu heterogen die Vorstellungen von Bildung und Erziehung.
Derzeit bekommt man den Eindruck, die wichtigste Voraussetzung für den Lehrberuf wäre informationstechnologisches Know-how. Corona leert die Klassenräume und zwingt Lehrer wie Schüler zur digitalen Kommunikation. Dass Fertigkeiten im Umgang mit digitalen Medien im heutigen Europa eine unverzichtbare Voraussetzung für vieles, also auch für den Lehrberuf sind, steht außer Streit. Dass E-Learning unter den aktuellen Umständen sehr nützlich ist, wird niemand leugnen. Aber mittelfristig wollen wir doch davon ausgehen, dass wir – insbesondere mit den jüngeren Schülerinnen und Schülern – zu direkteren, weniger entfremdeten Lehr- und Lernsituationen zurückkehren und dass Lerngruppen ihre Dinge wieder in Physik- und Musiksälen, in Werkräumen und ganz normalen Klassenzimmern betreiben.
Wenn Digitales auch stört
Wahrscheinlich werden dann auch digitale Medien eingesetzt, aber nicht immer und überall. Denn für vieles braucht man sie nicht, zum Beispiel für mündliche Kommunikation in allen Sprachen dieser Welt – und für manches sind sie sogar störend, zum Beispiel für die Erhaltung der Handschrift. Bleistift und Schreibheft haben immer noch kulturellen Charme. Da hat Peter Handke schon recht. Die beste Mathematikstunde, die ich jemals erlebt habe, verdanke ich einem Unterrichtspraktikanten, der für seinen Lehrauftritt wenige schlichte Zutaten verwendete: Fach- und Erklärungskompetenz, Klarheit, Dialogfähigkeit, Freundlichkeit, Tafel, Kreide.
In diesem Zusammenhang fällt mir ein Cartoon ein, in dem ein Kannibale mit Sorgenmiene sagt: „Wir haben die Digitalisierung verschlafen.“ Ein anderer antwortet: „Kannibalismus ist eben eher was Analoges.“ Pädagogik ist auch eher etwas Analoges, wenn auch in anderem Sinn als der Kannibalismus, obwohl es genügend Erzählungen gibt über Lehrer, die für Schülerinnen und Schüler lebensbedrohlich sind. Man denke an Gott Kupfer in Friedrich Torbergs Roman „Der Schüler Gerber“. Oder an die Lehrerkonferenz in Frank Wedekinds Drama „Frühlings Erwachen“. Ein Lehrer heißt Knochenbruch und der Rektor Sonnenstich, als solcher eher vertrottelt als gefährlich. Auch das ist ein Lehrerbild, das sich durch die Bildungsgeschichte zieht.
Den negativ typisierten Lehrerfiguren, dem Sadisten und dem Deppen, stehen positive gegenüber, die meist an idealistischer Überhöhung leiden. Als ich zum ersten Mal Peter Weirs Film „Der Club der toten Dichter“ gesehen hatte, war ich – so wie viele – irgendwie berührt: Der Ausnahmelehrer John Keating, Bündnispartner seiner Schüler im heroischen Widerstand gegen ein reaktionäres System. Der pädagogische Mythos von 1968! Ich brauchte eine Weile, bis ich durchschaute, wie manipulativ Mister Keating verfährt. Er ist der charismatische Führer, der kraft seiner Persönlichkeit ein gefährliches Ausmaß an Macht über die Schülerseelen gewinnt. Diese Macht verführt sanftmütig, macht abhängig und blockiert dadurch jenen emanzipatorischen Bildungsprozess, den Keating für seine Pädagogik beansprucht. Diese Schüler handeln nicht aufgrund von Kritikfähigkeit, sondern aus Liebe zu ihrem Meister. Der Begriff des pädagogischen Eros geistert janusköpfig durch die Bildungsgeschichte. Einerseits erinnert man sich gerne an außergewöhnliche Lehrerpersönlichkeiten, die aufgrund ihrer Bildung, ihres Engagements und einer schwer fassbaren Ausstrahlung eine Klasse zu ungewöhnlicher Aufmerksamkeit bewegen konnten. Andererseits kennen wir zu viele Fälle, in denen die Bewunderung für pädagogische Lichtgestalten ein Quell des Missbrauchs wurde, seelisch, körperlich, politisch.
50.000 von den „Besten“
Aber auch dann, wenn die außergewöhnliche Persönlichkeit moralisch untadelig ist, taugt sie nur bedingt als Muster für ein allgemeines Lehrerbild, denn sie steht, wie der Begriff signalisiert, außerhalb des Gewohnten. Die große Mehrheit der Lehrerinnen und Lehrer leistet ehrliche, solide Arbeit. Und das muss genügen, denn das ist das menschliche Maß. Die ehemalige Bildungsministerin Claudia Schmied (SPÖ), um weltverändernde Versprechen nie verlegen, kündigte an, dass nur mehr „die Besten“ zum Lehrberuf zugelassen werden; und das in einer Zeit, in der absehbar war, dass Österreich im kommenden Jahrzehnt ungefähr 50.000 neue Lehrerinnen und Lehrer brauchen wird. Könnte es sein, dass sich seither doch nicht 50.000 „Beste“ gemeldet haben? Wenn wir das Anforderungsprofil für Lehrkräfte konkretisieren, sollten wir hypertrophes Anspruchsdenken ebenso vermeiden wie resignative Bescheidenheit. Gelassener Realismus mit einem Schuss Ehrgeiz und die klare Eingrenzung der Aufgaben könnten hilfreich sein.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!