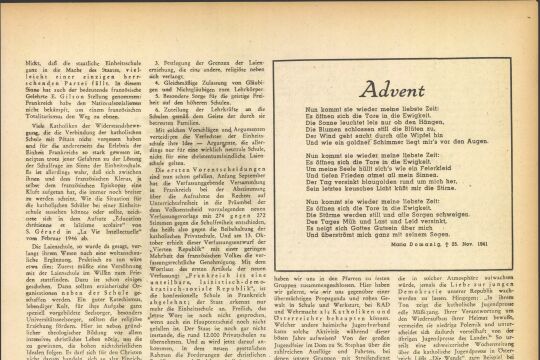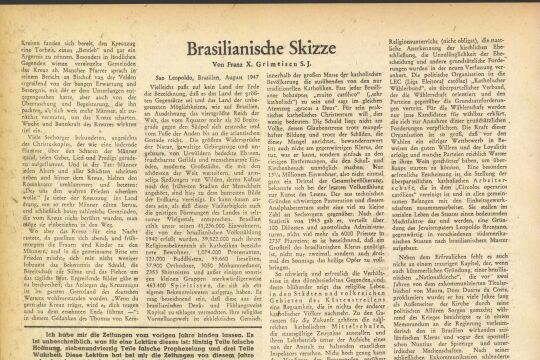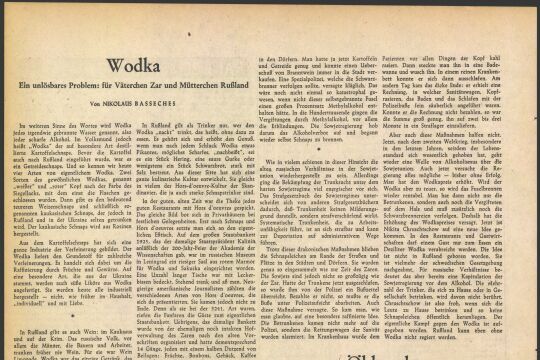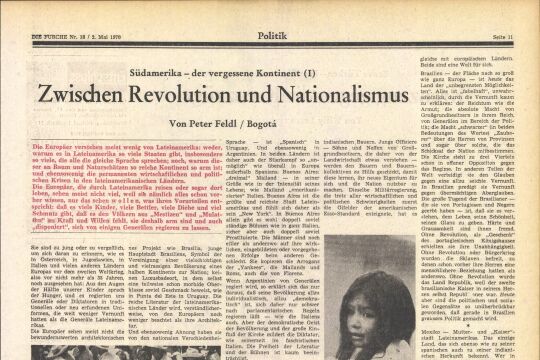Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Kontinent der Zukunft
Herbert Vytiska, Pressesprecher des Parlamentsclubs der Volkspartei, reiste in diesem Sommer mit einer ÖVP-Bundesratsdelegation unter der Leitung von Professor Dr. Herbert Schambeck quer durch Südamerika. Vier Staaten standen auf dem Programm: Venezuela, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Für die FURCHE faßt Vytiska die Eindrücke der Reise in einem Bericht zusammen.
Herbert Vytiska, Pressesprecher des Parlamentsclubs der Volkspartei, reiste in diesem Sommer mit einer ÖVP-Bundesratsdelegation unter der Leitung von Professor Dr. Herbert Schambeck quer durch Südamerika. Vier Staaten standen auf dem Programm: Venezuela, Brasilien, Argentinien und Uruguay. Für die FURCHE faßt Vytiska die Eindrücke der Reise in einem Bericht zusammen.
Der Sightseeing-Bus hält gerade im Villenviertel von Sao Paulo. Vor uns breitet sich die Skyline der brasilianischen Wirtschaftsmetropole aus. Und so beiläufig sagt der österreichische Handelsdelegierte, Josef Schwald zu mir: „Was für uns und für unsere Generation Nordamerika ist, das wird für unsere Kinder und Enkelkinder einmal Südamerika sein.“ In dieser Randbemerkung hegt fast eine Zukunftsphilosophie.
Die Geburtenstatistik belegt, daß es sich bei Südamerika zweifellos um einen explodierenden Kontinent handelt. Venezuela etwa weist eine der stärksten Bevölkerungszunahmen der Erde auf: 45 Prozent der Bevölkerung sind jünger als 15 Jahre. Brasilien hat eine Wachstumsrate von jährlich 2,9 Prozent. Bei einer durchschnittlichen Bevölkerungsdichte von 12 Einwohnern auf einem Quadratkilometer ist es zwar relativ Qünn besiedelt, aber der Geburtenüberschuß schafft Probleme. Finanzminister Mario Henrique Si-monsen: „Wir müssen jährlich 1,2 bis 1,4 Millionen neue Arbeitsplätze schaffen.“ Trotzdem will man in Südamerika von Familienpolitik, von Geburtenregelung noch nichts wissen. Das Land kann genug Menschen ernähren, sagen die Politiker.
In Brasilien hat man in der Mitte des Landes aus dem dürren Boden, mit fast unvorstellbarem Kapitaleinsatz, die modernste Hauptstadt der Welt gestampft: Brasilia. Hier sitzt die Regierung, hier sitzen die Ministerien, hier haben alle Firmen des Landes ihre Büros. Nur Wirtschaft ist hier keine angesiedelt. Denn die Fabriken sind in Sao Paulo oder Man-aus, das Leben spielt sich in Rio de Janeiro ab. Die Stadt ist eine stolze Leistung für die Politiker, die sich an diesen Bau gewagt und für die Architekten, die sie gebaut haben. Nicht unkritisch hört man freilich gelegentlich, daß es vielleicht besser gewesen wäre, „statt Brasilia zu bauen, das Eisenbahnnetz zu reparieren.“
Brasilia ist aber typisch für ein weiteres südamerikanisches Phänomen: den Bürokratismus. Da gibt es zwar ein Heer von Beamten, aber 68 Prozent von ihnen verdienen nur den Mindestlohn. Es geht ihnen jedoch besser als vielen Arbeitern. Denn sie bekommen ihren Mindestlohn wenigstens ausbezahlt. Bei 65 Prozent der 18 Millionen Arbeiter, so ein christlicher Gewerkschafter, steht der Mindestlohn nur auf dem Papier. Sie müssen zwar den Gehaltszettel unterschreiben, bekommen aber weniger auf die Hand.
Fast in allen Regierungen - egal ob man es wie in Venezuela mit einer Demokratie, oder wie in Argentinien mit einer Militärdiktatur zu tun hat -spielen die Wirtschaftsminister die erste Geige. Die Wirtschaftspolitik steht absolut im Zentrum. Spricht man mit den Gewerkschaftern, hört man viel Kritik an der Regierungspolitik, spricht man mit Wirtschaftskreisen, gibt es viel Lob. Eines steht allerdings außer Zweifel. Es bedarf gewaltiger Anstrengungen, um diese Bevölkerung zu ernähren, um ihr einen gewissen Lebensstandard zu geben. Man braucht sich nur umzusehen: in Caracas, Rio de Janeiro und Buenos Aires.
Venezuela gehört heute auf Grund seiner Erdölexporte zur Gruppe der reichsten Länder der Welt. Es ist aber auch eines der Länder mit der un-
gleichmäßigsten Einkommensverteilung. Die Ursachen dafür liegen sicher auch in dem noch nicht bewältigten Strukturwandel. So bringt etwa die Landwirtschaft nur 8 Prozent des Sozialproduktes ein, weist aber 28 Prozent der Beschäftigten auf. Der Erdöl- und Bergbausektor erbringt 40 Prozent des Sozialproduktes und hat nur 1,8 Prozent der Beschäftigten.
In Brasilien hat die relativ schnelle aber regional doch sehr unterschiedliche Industrialisierung bisher die Einkommensverteilung kaum verbessert. Das gibt sogar die Regierung offen zu: 20 Prozent der Bevölkerung verfügen über 61,5 Prozent des Nationaleinkommens. Die Industrialisierung geht vorderhand an den Massen der Bevölkerung vorbei.
In Argentinien gilt das Jahr 1976, als das Militär die totale Macht übernahm, als „Stunde Null“. Ein Blick in
die Statistik zeigt, daß damals tatsächlich nur noch 20 Prozent der Staatsausgaben durch Einnahmen gedeckt waren. Heute steht Argentinien außenwirtschaftlich sogar besser da als Brasilien. Die Devisenreserven sind in zwei Jahren von 30 Millionen auf 6,5 Milliarden Dollar angewachsen. Finanzminister Martinez De Hoz: „Wir wollen eine Wirtschaft
wiederherstellen, die ziemlich brachgelegen ist.“ Vielleicht gelingt das.
Vorderhand haben freilich die Arbeitnehmer die Opfer bringen müssen. Seit 1976 sind die Reallöhne um 50 Prozent zurückgegangen. Wenngleich die Sanierungsphase auf etwa vier bis fünf Jahre angelegt ist, so regt sich doch schon jetzt scharfe Kritik an der Wirtschaftspolitik. Um diese Kritiker zu beruhigen, bedient man sich nicht nur solcher Mittel wie Pressezensur und Versammlungsverbot. Man hat 1978 die Fußball-Weltmeisterschaft ins Haus geholt und ganz offen wird auch von politischer Seite erklärt: „Sie war uns ein politisch willkommener Anlaß,“
Man braucht nur mit offenen Augen durchs Land zu fahren. Die offiziellen Sightseeing-Tours führen die Fremden fast verschämt vorüber. Da sie aber nicht zu übersehen sind, muß man es ihnen doch erklären: die Elendsquartiere. „Favelas“ nennt man sie in Brasilien, „Casas miseras“ in anderen südamerikanischen Ländern. Es sind dies eng aneinander gepferchte, aus den verschiedensten Materialien von lehm- über Wellblech- bis zu holzlattengebauten kleinen Hütten, meist ohne Licht, keine Spur von Wasser und sanitären Anlagen. Tausende Menschen leben hier auf engstem Raum. Oft trennt nur eine Straße diese „Favelas“ oder „Casas miseras“ von der Wohlstandsgesellschaft. Auf der einen Straßenseite kriechen diese Hütten wie Spinnen auf den Berg hinauf. Auf der anderen Seite reiht sich eine Luxusvilla an die andere.
Das Problem, das Südamerika noch zu schaffen machen wird, ist,
daß es auf der einen Seite eine sehr große, breite, reiche Bevölkerungsschicht, aber auf der anderen Seite eine immer größer werdende arme Bevölkerungsschicht gibt.
Als Christ soll man eines nicht tun: Die Hoffnung aufgeben. Hoffnung für die Menschen in Südamerika vermittelt das Engagement der Kirche. Sie hat sich nicht hinter die Kirchentore zurückgezogen. Sie will erst gar nicht die Probleme stumm zur Kenntnis nehmen. Sie redet.
Der Klerus ist ohne Zweifel sehr stark mit den sozialen Spannungen konfrontiert, die in Südamerika bestehen. Während man die Fremden an den „Favelas“ oder „Casas miseras“ mit dem Bus vorüberführt, gehen die Priester tagein, tagaus in diese Elendsquartiere mitten hinein. Sie betreuen die Gläubigen und halten an Sonntagen da drinnen sogar ihren Gottesdienst. Dom Ivo Lorscheider, Generalsekretär der brasilianischen Bischofskonferenz, ist stolz darauf, daß die Kirche in Südamerika so stark auch gesellschaftspolitisch engagiert ist. Für ihn ist das „globale Pastorale“. Er begründet dieses Engagement: „Die Kirche muß sich schließlich mit allen Menschen beschäftigen.“ Was für manche jetzt vielleicht wie eine politisierende Kirche aussieht, wird aber mit dem
nächsten Satz sofort eingeschränkt: „Wir machen keine Politik der Partei, aber wir beschäftigen uns mit allen Problemen.“
Offiziell wird heute von allen politischen Stellen des Staates aus versichert, daß man nur ein Ziel hat, nämlich die Demokratie wiederherzustellen. Es sind erfahrene Diplomaten, die meinen, daß Brasilien heute am ehesten auf dem Rückweg zur Demokratie sei. In Argentinien und Uruguay wird der Weg noch länger dauern.
Was die Zukunft Südamerikas betrifft, so wird sie sicherlich sehr wesentlich davon abhängen, daß sich jene Kräfte, die die Demokratie wollen, nicht in einem Kampf gegeneinander verzetteln. Caldera sieht einen Hoffnungsschimmer: „Wir waren alle sehr enttäuscht, als in einigen südamerikanischen Ländern es wieder zu Rückfällen in Diktaturen kam. Aber wir wissen heute wenigstens, daß die Demokratie das beste System ist. Und gerade bei den Militärs, den jüngeren Militärs, macht sich eine Tendenz in diese Richtung bemerkbar.“
Es war am Schluß unserer Reise, als mir der Chefredakteur der brasilianischen Zeitung „Le Nacion“ erklärte: „Schauen Sie, wir gehören zur westlichen Welt, aber wir leben weit weg von dieser westlichen Welt. Wir leben unter dem Äquator. Europa sollte nicht vergessen, daß es auch hier noch Menschen gibt. Wir wünschen das Gespräch mit Europa.“
Europa sollte dieses Gespräch suchen. Denn: „Was für uns und unsere Generation Nordamerika ist, das wird für unsere Kinder und Enkelkinder einmal Südamerika sein.“
Ich kann es mir vorstellen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!