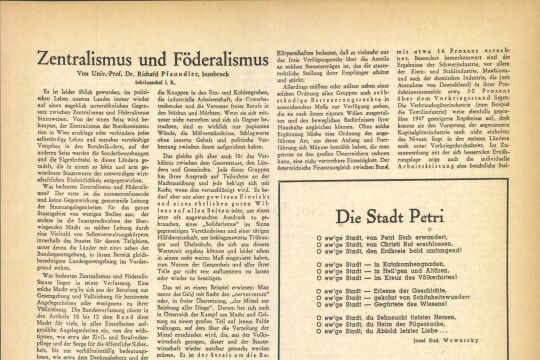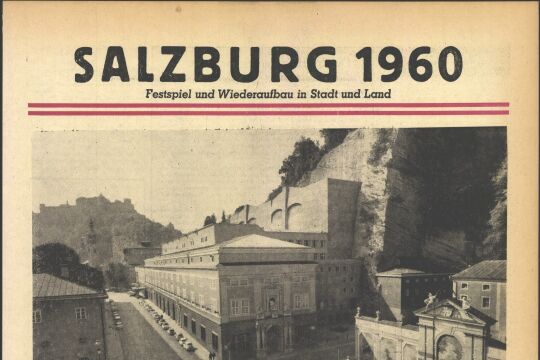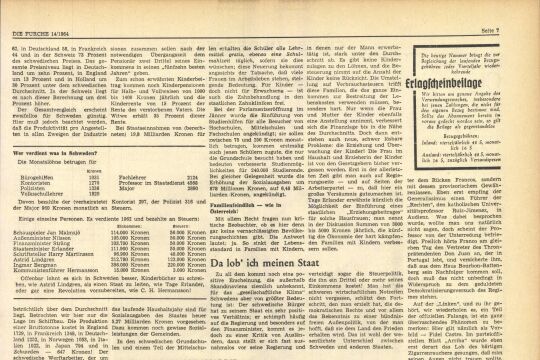Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Amerika, warum hast du es besser?
Ist die Wirtschaftspolitik der Vereinigten Staaten ein Vorbild für Europa? Diese Frage führt zu leidenschaftlichen Debatten. Die einen sehen in den USA ein „Entwicklungsland mit Atombombe”, in dem fast 40 Millionen Bürger ohne Krankenversicherung leben, ein Viertel der Kinder in Armut geboren werden, die Verslummung in den Megastäd-ten ein in Westeuropa unvorstellbares Ausmaß annimmt und die Zahl der Häftlinge nach einer Verdoppelung in den letzten zehn Jahren die Millionengrenze überschritten hat. Viele Menschen müssen mehrere Berufe, meist schlecht bezahlte MacJobs, zugleich ausüben, um sich und ihre Familie mühsam durchzubringen. Die Verteilung der verfügbaren Einkommen sei ungerecht: Die Armen würden ärmer, die Reichen reicher (siehe dazu Seite 2, Anm. d. Red.). Das ist auch das Bild, das viele europäische Medien zeichnen.
Die Verteidiger des amerikanischen Weges verweisen auf die wirtschaftlichen Erfolge des von Bonald Beagan begonnenen und von George Bush wie Bill Clinton fortgesetzen Kurses: Das Wirtschaftswachstum der USA erreichte in den letzten zwölf Monaten vier Prozent. Damit stehen die Vereinigten Staaten besser da als alle anderen der sieben führenden Industrienationen (G-7).
Der demokratische Präsident und der republikanisch dominierte Kongreß haben sich auf eine Budgetpolitik geeinigt, die die völlige Beseitigung des Haushaltsdefizits bis zum Jahre 2002 festschreibt. Das Passivum im Budget beträgt heuer nur noch 0,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, während die meisten EU-Staaten größte Mühe haben, die in Maastricht vereinbarte Obergrenze von drei Prozent einzuhalten. Die gute Konjunktur hat bewirkt, daß die Arbeitslosen-rate auf 4,8 Prozent, den niedrigsten Stand seit 24 Jahren, gefallen ist. Das entspricht weniger als der Hälfte des EU-Durchschnitts (vor einem Vierteljahrhundert war es noch umgekehrt). Die USA hätten jene Arbeitsplätze geschaffen, die die europäischen Regierungen in den letzten zehn Jahren ständig versprochen haben, seit 1983 nahezu 26,2 Millionen Jobs bei 250 Millionen Einwohnern und zwar größtenteils in der freien Wirtschaft und nur drei Millionen im staatlichen Bereich. Dies sei nur möglich gewesen, weil 1,5 Millionen neue Unternehmen allein in den achtziger Jahren gegründet wurden.
Unsozial & profitgierig
Das Bild vom „unsozialen Amerika” wollen die Befürworter der Wirtschaftspolitik Washingtons durch Aussagen korrigieren, die Experten im zuletzt veröffentlichten OECD-Bericht und in einer Studie des Informationsdienstes der Deutschen Wirtschaft, Köln gemacht haben. Danach sei es unrichtig, daß gut bezahlte Arbeitsplätze durch schlecht bezahlte ersetzt würden. Nahezu 60 Prozent der neuen Posten würden Löhne bieten, die um 14 bis 17 Prozent über dem nationalen Durchschnitt lägen. Ebenso wäre die Behauptung falsch, die Spanne zwischen den Gehältern habe sich vergrößert und die Einkommensverteilung hätte sich durch die steigende Zahl von Billiglohn-Jobs aus sozialer Sicht verschlechtert. Die USA hätten ihre wirtschaftlichen Erfolge nicht mit einem niedrigeren Sozialstandard erkauft. Auch die Arbeitslosenrate der Afroamerikaner sei auf unter zehn Prozent gefallen, während sie vor wenigen Jahren noch 15 Prozent betrug. Die Behauptung, amerikanische Firmen würden letztlich nur kurzfristiges Profitstreben kennen, sei absurd. Wäre dies der Fall, könnten sie nicht nachhaltig mit der europäischen und asiatischen Wirtschaft konkurrieren.
Wie immer man diese Argumente wertet: Bei einer Untersuchung über die Ursachen des amerikanischen Wirtschaftserfolges und der ungelösten Probleme in Europa werden die unterschiedlichen wirtschaftspoliti -sehen Bahmenbedingungen sichtbar: Das Bruttoinlandsprodukt ist nach der vom Internationalen Währungsfond veröffentlichten Statistik in beiden Wirtschaftsregionen seit 1970 real um ungefähr 80 Prozent gestiegen. Der Kapitaleinsatz war in Europa im gleichen Zeitraum mit über 220 Prozent sogar etwas größer. Beide Faktoren können daher nicht als Ursache für die unterschiedliche Beschäftigungslage herangezogen werden. Die EU-Löhne dagen sind im gleichen Zeitraum real um 60 Prozent, die amerikanischen lediglich um 15 Prozent gestiegen. Europa hat überdies in den letzten 25 Jahren seine sozialrechtlichen Bestimmungen wesentlich stärker ausgebaut. So würden der erweiterte Kündigungsschutz, hohe Lohnnebenkosten wie Sozialabgaben, großzügige Urlaubs- und Ab-fertigungsbestimmunggnjmc|vor allern die zu starren Arbeitszeitregelungen die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beeinträchtigen. Die OECD-Studie schreibt in diesem Zusammenhang: „Anpassungsverweigerung verschiebt das Unvermeidbare und bindet Bessourcen, die für den Einstieg in neue dynamische Märkte gebraucht werden.”
Nun könnte man darüber diskutieren, ob nicht manche der sogenannten „sozialen Errungenschaften” in Europa Vorteile sind, die von einigen zum Nachteil anderer abseits des Marktes erkämpft und petrifiziert wurden. Kündigungsschutz, Abfertigungen und automatische Gehaltserhöhungen - um drei Beispiele zu nennen -halten viele Unternehmer davon ab, neue Mitarbeiter einzustellen, da dies in einer zunehmend dynamischen Wirtschaft mit zu hohen Bisiken verbunden wäre. Das ist ein oft übersehenes soziales Problem: Den im Arbeitsprozeß stehenden Besserverdienern geht es, überspitzt ausgedrückt, auf Kosten der Arbeitsuchenden gut.
Doch spätestens an diesem Punkt der Diskussion treffen die Amerikaverteidiger auf einen ernstzunehmenden Einwand.
Was immer gut und richtig sei: die Verhältnisse ließen sich, nicht zuletzt wegen der sehr unterschiedlichen Mentalität der risikofreudigen Amerikaner und der mehr auf Sicherheit bedachten Europäer, aber auch aufgrund der Rahmenbedingungen grundsätzlich nicht vergleichen.
Das stimmt. Der Amerikaner empfindet Flexibilität als Chance, der Europäer als Gefahr. Der Amerikaner sieht im Prinzip „hire and fire” (geringer Kündigungsschutz) auch den Vorteil, daß ihm ein großes Angebot an frei werdenden Stellen geboten wird und er jenen Posten finden kann, der in einem sich rasch verändernden Markt seinen Qualifikationen am besten entspricht. „Wozu brauche ich einen Arbeitsvertrag” meinte kürzlich eine afroamerikanische Angestellte in einer Fernsehsendung, „wenn ich meinen Job gut mache und der Firma Nutzen bringe, wenn mir oder dem Arbeitgeber etwas nicht paßt suche und finde ich etwas entsprechendes.”
Nach Angaben des US-Census-Bu-reau übersiedeln jährlich etwa 17 Prozent aller Amerikaner. Bei jungen Berufstätigen ist dieser Prozentsatz noch wesentlich höher (35 Prozent bei den 20-24jährigen, 30 Prozent bei den 25-29jährigen). Ungefähr ein Drittel dieser Übersiedler gehen in einen anderen Staat. Trotz der Freizügigkeit innerhalb der EU gibt es nachhaltige Barrieren wie Sprach- und Kulturunterschiede. In Österreich kommt noch die unsoziale, korruptionsanfällige Bewirtschaftung des Wohnungsmarktes hinzu, die die Mobilität ganz wesentlich erschwert.
Jeder, wie er will?
Nun könnte man nach dem Grundsatz des „Fledermaus”-Prinzen Or-lofsky „Chacun ä son goüt” alles so belassen wie es ist. Soll doch jeder nach seiner Facon selig werden! Das geht aber nicht. Denn durch die Globalisierung der Märkte, durch die Freizügigkeit der Investitionsströme, treten die unterschiedlichen Systeme in einen Wettbewerb, der die Qualität des Wirtschaftsstandortes mißt. Und wer nicht durch ideologische Scheuklappen oder fromme Wunschvorstellungen behindert ist, muß erkennen, daß Europa durch eine zu starre, mehr auf die Gegenwart als auf die Zukunft gerichtete Wirtschaftspolitik ins Hintertreffen gerät.
Das bedeutet nicht, daß wir den American Way of Life übernehmen müssen oder sollen. Doch ein Überdenken unserer Positionen ist angebracht. Eine Beformpolitik, die sich an größerer Flexibilität orientiert, ist auch in europäischen Ländern mehrheitsfähig. Das zeigen die Niederlande, Finnland und zuletzt auch Großbritannien, dessen Labourregierung eine Politik „der radikalen Mitte jenseits von Bechts und Links” eingeschlagen hat. Tony Blair hat sich nicht gescheut, von Disziplin, Leistung, Eigenverantwortung, Gesetz und Ordnung („Law and order is a labour is-sue”) zu sprechen. Er hat die Wahl gewonnen.
Diese Politik ist kein Monopol und auch keine Erfindung einer Partei. Sie wird gemeinsam getragen von unterschiedlichen Gruppen, in Washington zwischen dem eher progressiven Weißen Haus und dem eher konservativen Kapitol, in Holland auf der Basis einer breiten Koalitionsregierung und einer funktionierenden Sozialpartnerschaft, in Großbritannien und Neuseeland durch die Übernahme wesentlicher Positionen früherer Begierungen.
Zu dieser Politik gibt es auch in Österreich keine ernstzunehmende Alternative.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!