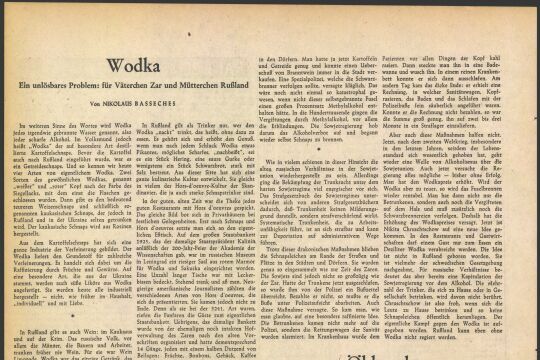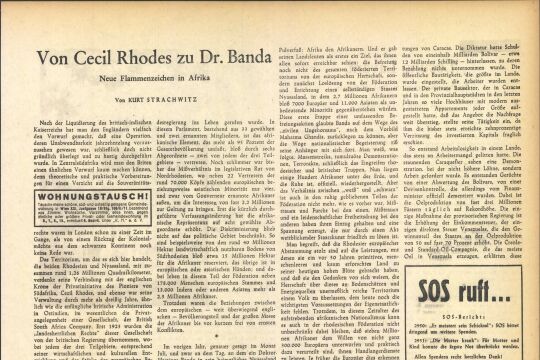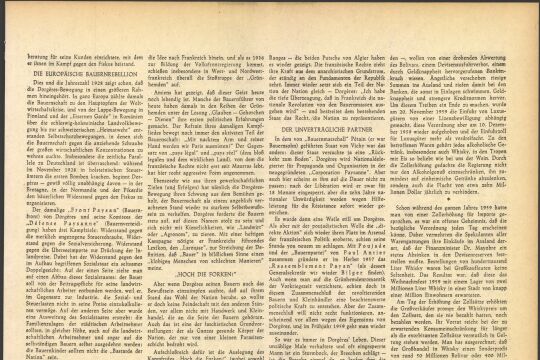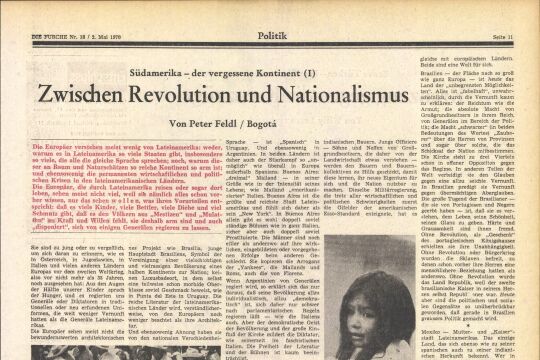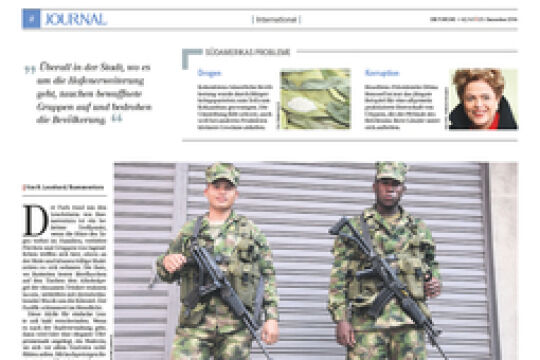Rund um Caracas, das in einem von ursprünglich grünen Berghängen umgebenen Hochtal liegt, wuchern in die Vegetation geschlagene Wunden : abgeholzte, von Erosion zerfurchte, grellrote Laterit- flecke bilden das Substrat, auf dem die Barriadas und Rancherias stehen, bodenständige Bezeichnungen für das Krebsgeschwür der Stadt, die Slums.
Hier leben die Marginales, die Randfiguren, wie der Südamerikaner seine Elenden bezeichnet — falls er überhaupt ihre Existenz erwähnt. In den wilden Siedlungen rund um die Stadt, die aus Hütten aus Pappe, Sackleinen, Brettern und Kanistern bestehen, in denen es kein Wasser, keinen Kanal, kęin elektrisches Licht gibt, leben 600.000 von den zwei Millionen Einwohnern, die Caracas heute zählt.
Nirgends prallen die Gegensätze so hart aufeinander, wie in Venezuela: Caracas ist eine der teuersten Städte der Welt, Venezuela hat das höchste pro-Kopf-Einkommen Lateinamerikas (1000 Dollar jährlich). Andere Statistiken sprechen auf Grund anderer Berechnungsgrundlagen allerdings von nur 279 Dollar, selbst das wäre noch ein Rekord. Doch haben zwölf Jahre ununterbrochener Demokratie die Verteilung des Volkseinkommens noch immer nicht verbessert, es ist auch das am ungerechtesten verteilte ganz Südamerikas.
Bevölkerungszuwachs 5,8 Prozent
In Venezuela sind zwar die Löhne am höchsten, doch verdienen von den 1,5 Millionen Familien nur 55.000 mehr als jene 3000 Bolivar monatlich (rund 14.000 Schilling), die man für ein menschenwürdiges Dasein braucht. Keine Statistik nennt das durchschnittliche Einkommen eines Campesinos (Landarbeiters) oder Barrkbewohners: 500 Schilling.
Es gibt eine Million verlassene Kinder und jedes Jahr werden weitere 100.000 ausgesetzt. Mit 3,6 Prozent jährlich übertrifft Venezuela mit seinem Bevölkerungszuwachs alle südamerikanischen Nachbarn, ja Indien und die Türkei. In Caracas selbst — das heißt in den Slums — beträgt sie 5,8 Prozent. Über die Hälfte aller Kinder wird von ledigen Müttern zwischen 15 und 20 Jahren geboren.
Mehr als 300.000 Venezolaner sind dauernd arbeitslos — sie hausen in den Elendsvierteln dar Großstädte. Bis zu 75 Prozent der Slumbewohner gehen keiner geregelten Arbeit nach — kein Wunder, ziehen doch in ganz Lateinamerika jährlich drei Millionen hungernde Landbewohner, angelockt vom erhofften Reichtum der schillernden Großstädte, in die Metropolen und Industriezentren, wo schon Hunderttausende seit Jahren auf Arbeit warten. So werden die Kistenbretterstädte zu Horten der Verzweiflung und des Verbrechens, Zentren von Gewalttätigkeit und Gemeinheit. Es ist eine Bombe der Arbeitslosigkeit, die hier vor den Toren der Industriestädte, in den Slums der Großstädte, lautlos explodiert.
Die Behörden der Länder kämpfen — wenn sie es überhaupt tun — auf verlorenem Posten gegen die Zeit. Alle wirtschaftlichen Anstrengungen werden angesichts der Bevölkerungsexplosion unwirksam. Die Not auf dem Land nimmt zu, die Arbeitslosigkeit schwillt.
Erschütternd und verwirrend sind die Statistiken, die das venezolanische Wohnungsproblem kaschieren: da heißt es offiziell, daß es in Venezuela einen Wohnungsüberschuß von
75.0 Einheiten geben soll. Pro Wohnung 3,3 Räume, von denen jeder wiederum mit durchschnittlich 1,8 Personen belegt sein soll, wobei es offiziell heißt, daß 55,5 Prozent der Wohnungen mit Gas, 67,1 Prozent mit fließendem Wasser und 78,4 Prozent mit elektrischem Licht versehen sein sollen. 50 Prozent sollen an das Kanalisationsnetz angeschlossen sein.
In derartigen „Rechenschaftsberichten“ werden die Slumsiedlungen nicht als Wohnungen berücksichtigt.
Über 1000 Aufstände, Putsche und Revolutionen in eineinhalb Jahrhunderten haben nichts an den katastrophalen Zuständen geändert. Sie verschlimmern sich nur von Tag zu Tag. Wer durch die Rancherias von Venezuela, die Villas miserias in Argentinien, die Barriadas oder Pueblos jovenes in Peru, durch die Tugurios Kolumbiens oder die Callampas Chiles gegangen ist, weiß vom bitteren Los und vom Elend des Aus- gestoßenen.
Doch sind die Slumsiedlungen, die jedes Land mit umschreibenden Namen belegt, kein spezifisch süd- amerikanisches Problem. Ein Zehntel der Menschheit lebt heute in Städten mit mehr als einer Million Einwohner. Und die Flut der nachdrängenden Landbewohner nimmt kein Ende. Fachleute sprechen von der Völkerwanderung des 20. Jahrhunderts. In Thailand wie in Brasilien.
In Südamerika hat diese Entwicklung, unterstützt durch die Politik der reaktionären Großgrundbesitzer, dazu geführt, daß die Landwirtschaft stiefmütterlich behandelt wird und Bodenreformen selbst nach Revolutionen nur schleppend vorankommen.
Bis heute fließen 80 Prozent der Einkünfte Südamerikas in die Taschen von nur 10 Prozent der Bevölkerung. Nur ein Fünftel des Volkseinkommens steht jenen zur Verfügung, die allgemein als das Subproletariat bezeichnet werden: sie vegetieren ohne Hoffnung, ob im
Nordosten Brasiliens oder im peruanischen und bolivianischen Altiplano.
Die sozialen Mißstände haben dazu geführt, daß die südamerikanische Nahrungsproduktion pro Kopf gefallen anstatt gestiegen ist. Südamerika war vor 30 Jahren jener Teil der Erde, wo Getreideüberschuß herrschte, heute müssen die lateinamerikanischen Staaten alle Getreide einführen, auch Chile, der ehemalige Weizenlieferant Nummer eins.
60 Prozent der Bevölkerung sind fehlemährt. Es mangelt an Mineral- stoffen, Vitaminen und Proteinen; drei von vier Kindern legen sich abends hungrig zu Bett. Die Lebenserwartung der Südamerikaner beträgt bei einer Kindersterblichkeit bis zu 30 Prozent bei den Frauen 49 Jahre, bei den Männern 43. Allein in Brasilien werden jährlich vier Millionen Kinder geboren, mehr als drei Viertel ohne Chance auf ein gesundes Überleben.
Die wilden Siedlungen der Ranchos wachsen von Tag zu Tag. Die Regierungen sind machtlos, obwohl sie alle möglichen Anstrengungen machen, die Misere zu beenden. Riesige Satellitenstädte modernsten Sozialwohnbaues wachsen im Westen von Caracas aus dem Boden. Venkehrs- mäßig durch eine Schnellstraße mit der Hauptstadt verbunden, mit allen nötigen Service- und Dienstleistungsbetrieben versehen, hat der soziale Wohnbau eine hohe Stufe.
Wucherzins im Slum
Den Ärmsten der Armen wird dadurch nicht geholfen. In den Callampas braucht niemand Miete zu zahlen, offiziell jedenfalls nicht, in Sözialbauten schon. In den Pueblos jovenes ist das Kistenhaus der Privatbesitz des wilden Siedlers — die Mietwohnung nicht. In die vom Staat subventionierten Wohnungen können daher nur die schon besser Gestellten aus den Villas miserias ziehen und die leeren „Häuser“, die die Umzügler in den Barriadas zu rücklassen, werden sofort von den nächsten Anwärtern bezogen.
Auf Grund der Wohnungsnot auch innerhalb der Slumviertel haben sich auch hier Geschäftssinn und Gemeinheit breitgemacht. Längst sind reiche Ranchobesitzer dazu übergegangen, Slumhütten zu kaufen oder durch erpresserische Akte ganze Familien in ihre Gewalt zu bekommen. Freie Hütten werden geradezu — im Vergleich zum Gebotenen — zu Wucherpreisen „vermietet“, Slumbewohner bezahlen Pachtzins für Grund und Boden, der niemandem gehört — jedenfalls nicht dem, der den Zins eintreibt. Sie zahlen „Schutzgebühmen“ nach dem Chika- goer Verbrechermuster. Nicht überall in Südamerika, besonders aber in den Rancherias von Venezuela, den Villas miserias in Argentinien, den Tugurios Kolumbiens, ist es so.
Nicht in Chile. Dort sind die Campesinos organisiert. MIR-Komman- dos unterrichten und verteidigen die Slumbewohner gegen „Übergriffe“ der Behörden — was jetzt freilich selten vorkommt: ist doch Allende mit Hilfe des Subproletariats an die Macht gekommen. Aber die MIR organisiert die Besetzung von fremdem Eigentum und „verteidigt“ die schnell errichteten Callampas gegen Räumkommandos und gegen die Polizei, die die MIR — eine extrem radikale Linksgruppe — erbarmungslos jagt.
Wie Schwämme nach dem Regen
An der Abhängigkeit der Slumbewohner hat sich nicht viel geändert. Werden die Kreolen Venezuelas von Verbrechern ausgebeutet, so werden die Callampabewohner Chiles ideologisch auf Vordermann gebracht. Die vielzitierte Freiheit gibt es in keinem Slum.
Der Staat rechnet bei seinen Planungen nicht mit der unbeugbaren, geradezu unheimlichen Widerstandskraft der wilden Siedler. Alarmierendes Beispiel ist Brasilia: erst zehn Jahre besteht die Stadt, sie wurde aus dem lateritischen Boden des Sertao gestampft, durohgeplant und konzipiert für maximal 500.000 Einwohner. Noch lange ist die Stadt nicht fertig — aber schon leben
400.0 Menschen in ihr, allerdings nicht nur in den für das Wohnen bestimmten Appartementhäusern:
200.0 Menschen in den Favelas, den Bretterhüttendörfem, die sich außerhalb befinden. Sie waren nicht eingeplant — beschämt sprach die Regierung anfangs von Bauarbeitersiedlungen. Aber die Bauarbeiter lebten seit eh und je — und nicht nur in Südamerika — in von Firmen bereitgestellten Unterkünften. Die Favelas hingegen folgen dem Gesetz des Großstadtmagnetismus.
Rio, die angeblich schönste Stadt der Welt, ist mit von Favelas verunzierten Berghängen durchsetzt — zur Freude fremder Ignoranten, die hier ganze Filme verschießen und Pauschalurteile über Länder fällen, von deren Problematik Sie’ nichts mitbekommen. Für sie besteht Lateinamerika nur aus Slums und sie übersehen die Anstrengungen, die die brasilianische Regierung dagegen unternimmt. Wie in Caracas, so entstehen auch in Rio riesige Wohnblocks, in denen die ehemaligen Favelabewohner angesiedelt werden. Räumkommandos und Caterpillars ebnen die verlassen Favelas innerhalb weniger Tage ein — oft müssen die Zwangsumgesiedelten mit Gewalt aus ihren „Häusern“ geholt werden.
Oligarchische Despoten
Der berüchtigte venezolanische Diktator Pėrez Jimėnez „defaveli- sierte“ ebenfalls. Über Rundfunk und Zeitungen ließ er verkünden, diese oder jene Barriada werde zu einem festgesetzten Zeitpunkt geräumt. Panzer und Polizei fuhren auf: die Frist zur Räumung wurde mit Lautsprechern verkündet, die Soldaten standen Gewehr bei Fuß. War die gesetzte Frist abgelaufen, walzten die Panzer die Barriada nieder — ohne Rücksicht auf noch in ihr lebende Menschen.
Pėrez Jimėnez kann den Ruf für sich in Anspruch nehmen, Caracas tatsächlich — rein äußerlich — von seinen Schandflecken befreit zu haben. Freilich — kaum war er gestürzt, wuchsen die Barriadas von neuem. Und größer, als je zuvor.
Trotzdem imponierte Jimėnez den Südamerikanem. Wie sonst wäre es verständlich, daß der gestürzte Diktator 1968 von seinem Madrider Exil aus einen Senatssitz in Caracas gewann, dessen Besetzung durch den General der venezolanische Oberste Gerichtshof nur durch juridische List verhindern konnte.
Uneingeschränkte Bewunderung wird dem Diktator nach wie vor von Reich und Arm zuteil, von den Reichen, weil Jimėnez den Armen die Faust zeigte und das verrottete System lateinamerikanischer Oligarchie aufrechtzuerhalten wußte, von den Armen, weil natürlich auch Jimėnez Häuser, Straßen, Schulen, Spitäler baute und es mit demagogischem Geschick verstand, für die Armen zu einer Art Vaterfigur zu werden.