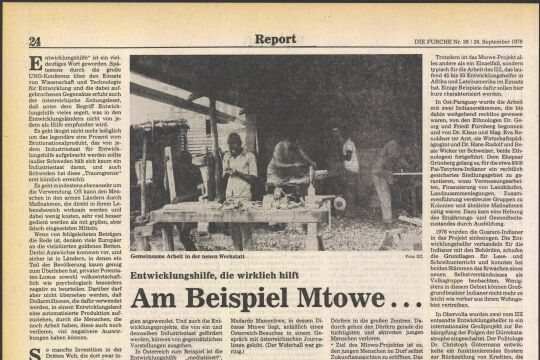Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Was ist wichtiger - der Mensch oder das Geschäft?
Wir können zwar die Welt nicht verändern, doch auch das kleine Österreich kann Entwicklungsprojekte finden, in denen wir lokal oder in einer ganzen Region ein konkretes Werk zu verwirklichen trachten. Ein durchdachtes und mit allem Einsatz geführtes Projekt kann zu einem Zeichen der Hoffnung werden, daß es keine Utopie ist, diese unmenschlich Armen aus ihrer Hoffnungslosigkeit herausziehen zu können. Diese Einsätze, die die Entwicklungshelfer leisten, sind nicht nur jene Tropfen auf heißen Steinen, wie so viele meinen, die von vornherein jede Entwicklungshilfe ablehnen.
Worauf kommt es dabei an? In den „Entwicklungsländern“ Partner suchen - Siedlungsgemeinschaften, Genossenschaften, ethische und religiöse 'Gruppen - und herausbekommen, wie man sie auf eigene Füße stellen kann, sie selbstbewußter und unabhängiger von Ausbeutung jeder Art und unabhängiger von Naturgewalten zu machen, sie vom Vegetieren zum Menschsein zu bringen. Dabei aber nicht glauben, daß nur unsere westliche Zivilisation die Rettung ist. Die Hilfe muß den jeweiligen Umständen angepaßt werden, sonst ist jeder Einsatz umsonst und kann sogar negativ ausgehen.
Ein auf viele Jahre angelegtes Unternehmen hegt im bolivianischen Bergbaugebiet, Oruro, wo Ing. Gottfried Reiner 1971 eine Steigerschule errichtete, aber nicht mit der Mentalität der dortigen Bevölkerung rechnete. Die „Schüler“ fühlten sich nach einjähriger Schulung als kleine Ingenieure und wollten nicht mehr unter Tag arbeiten. Reiner stellte die Hauerausbildung völlig um. Drei bis sechswöchige mobile Kurse in verschiedenen Minen sollten den Teilnehmern die Grundbegriffe des Bergbaues beibringen. Inzwischen hat das Projekt die dritte Phase erreicht. Eine Lehrmine wurde eingerichtet, in der eine dreimonatige Weiterbildung der Steiger durchgeführt werden kann. Die Mittel dafür konnten zum größten Teil von der österreichischen Bundesregierung (19 Millionen Schilling), vom bolivianischen Bergbauinstitut (5 Millionen) und aus privaten Quellen (2,5 Millionen) gedeckt werden.
Auch das Know-how einer Fachschule für Sägewerkstechnik in Mexiko läßt sich in diese Art von Entwicklungshilfe einreihen, da bei diesen Einsätzen auch handfeste, ins Auge springende Erfolge zu verzeichnen sind. Alle diese Projekte sind in erster Linie wirtschaftsorientiert, sie haben die Ankurbelung der Wirtschaft zum Ziel, um die Entwicklungsländer allmählich in die Weltwirtschaft einbeziehen zu können und dadurch ihre Entwicklung zu heben. Humanitäre Motive und Überlegungen spielen bei
der staatlichen Entwicklungspolitik de facto kaum eine Rolle.
Ein österreichischer Bäckermeister organisierte in San Salvador im März des Vorjahres eine Bäckereigenossenschaft, ein paar Monate später richtete er eine Schulbäckerei in San Jose de Costaricä ein.
Auf dem riesigen lateinamerikanischen Subkontinent gibt es weite Gebiete mit traditionell bäuerlicher Bevölkerung, die Edlen Prognosen herkömmlicher Entwicklungsstrategien zum Trotz sich nicht nur bis heute erhalten hat, sie ist in vielen Gegenden noch angewachsen. Die angestrebte Umwandung dieser kleinen bäuerlichen Familienwirtschaften in wettbewerbsfreudige Farmbetriebe ist ausgeblieben. Die Landbesitzer, die „criollos“, stehen der uransässigen bäuerlichen Bevölkerung, die das Land recht und schlecht bearbeitet, gegenüber. Bei den Großgrundbesitzern ist die koloniale Ausbeutung der Landbevölkerung wie des Bodens noch fest verwurzelt.
Wenn nun Ethnologen ein solches Gebiet bereisen, um ansässige oder halbnomadisierende Indianerstämme zu erforschen, stoßen sie naturgemäß auf Dorfgemeinschaften, deren Bewohner so arm, ungebildet und zum Teil auch krank sind, daß der Wunsch, ihnen zu helfen, zur moralischen Verpflichtung wird. Doch nur Aktionen, die von vornherein auf unbeschränkte Zeit angelegt sind, wie die von Dr. Christa Kubier in Zusammenarbeit mit der Jesuitenmission in Bachajon im Urwald von Chiapas, können mit einem dauernden Erfolg rechnen.
Anders das Lehrerehepäar, das mit einem deutschen Pfarrer in Zunil im Hochland von Guatemala eine Landschule für Indianer-Erwachsenenbildung errichtet und in wenigen Jahren bereits indianische Lehrerinnen mit guten pädagogischen Fähigkeiten herangezogen hat. Sie erstellten ein den Indios angemessenes Modell. Dann kam das Erdbeben, bei dem der deutsche Pfarrer ums Leben kam. Sein Nachfolger war ein Guatemalteke, der sich zu den Einheimischen in Distanz hielt, den kolonialen Pfarrherrn herauskehrte und an der Entwicklungsarbeit nicht mehr interessiert ist. Das Lehrerehepaar Peter und Hedwig II-lichmann war nicht mehr erwünscht. Die Ablösung des europäischen durch heimisches Fürsorgepersonal brachte einen Stillstand und schließlich ein Versanden des vielversprechenden Projektes.
Mit mehr Glück leitete Dr. Georg Grünberg geradezu ein Paradebeispiel an Entwicklungsarbeit mit seinem Helferehepaar Wtcfcer, das unter „Guaraniprojekt“ bekannt geworden ist. Dieses indianische, halbnomadische Bauernvolk in Paraguay hat bis
heute jeder Kolonialherrschaft und auch Christianisierung widerstanden. Den Ethnologen gelang es, ihr Vertrauen zu gewinnen, und für sie von der Regierung Land zu beschaffen. 16.000 Menschen wurde ein endgültiges Zuhause gegeben.
Obwohl sich dieses Projekt weder mit der Indianerpolitik der Regierung noch mit einer christlichen Mission identifiziert, arbeiten seine Initiatoren bei der Bekämpfung der Unterernährung, der Tbc wie bei allen konkreten sozialen Problemen mit dem Behörden und der nationalen Bischofskonferenz zusammen. Der Aktionsplan umfaßt eine rechtsgültige Zuteilung von gemeinschaftlich nutzbarem Land, ein integriertes Erziehungsprogramm, das auch eine allmähliche Alphabetisierung vorsieht. Das Ziel des Projektes ist es, in den Dorfgemeinschaften das soziale und ökologische Gleichgewicht zu erhalten, um diesem Indianerstamm seine ethnische und kulturelle Identität zu erhalten. Der Wohlstand der Indios hat sich merklich gehoben, die Tbc ist zurückgegangen, und damit hat sich auch das Selbstbewußtsein und die Bereitschaft, ihre Rechte selbst wahrzunehmen und zu verteidigen, entscheidend gebessert.
Es ist heute nicht mehr die Frage: Wie müssen die traditionellen, vorkapitalistischen Gesellschaften und Völker geändert werden, um sie langsam an unseren Standard heranzuführen, sondern, wie muß der Fortschritt beschaffen sein, -der es den Völkern am Rande unserer Geschichte ermöglicht, zu Trägern historischer Emanzipation zu werden, ohne daß eine Herrschaft irgendwelcher Art ihre natürlichen Quellen zerstört, ihnen aber hilft, ihre täglichen Probleme im konkreten Leben selbst zu lösen?
Die Entwicklungspolitik, ob staatlicher, kirchlicher und sonstiger Stellen, muß davon ausgehen, die unmittelbaren Grundbedürfnisse - Nahrung, Behausung, Gesundheit, Ausbildung und Arbeit - zu befriedigen. Die Uberwindung der absoluten Armut, die aus dahinvegetierenden Lebewesen erst Menschen macht, die langsam lernen, ihre Rechte wahrzunehmen, verlangt in der praktischen Entwicklungshilfe ganz andere Konzepte als die staatliche, traditionell wirtschaftlich orientierte Entwicklungspolitik. Entwicklungsarbeit dieser Art ist kein geeignetes Instrument, das technische Know-how der Industriestaaten der Dritten Welt zu verkaufen, aus der Hilfe möglichst wirksame Handelsbeziehungen zu knüpfen, die Wirtschaftbeziehungen anzukurbeln und unmittelbar österreichische Waren abzusetzen.
Aus diesem Grund stagniert seit Jahren die staatliche Entwicklungs-
hilfe Österreichs in Lateinamerika. Vom Beginn neuer Projekte ist gar nicht zu reden, gewisse bereits angelaufene mußten zurückgestellt oder sogar abgebrochen werden.
Der österreichische Entwicklungshelferdienst (OED) hat am 13. Februar im Bundeskanzleramt ein Memorandum übergeben, wobei wesentliche Unterschiede in der Grundeinstellung gegenüber der Entwicklungsarbeit zwischen dem OED, dessen Arbeit auf den Grundsätzen der Enzyklika popu-lorum progressio basiert, und der Regierung festgestellt wurden.
Abgesehen von einigen Aushängeschildern wie der Schule in Guatemala, ist das Bundeskanzleramt an Lateinamerika nicht mehr interessiert. Die staatlichen Schwerpunkte hegen in erster Linie in Afrika. Der Bund wird von nun an nur mehr Entwicklungseinsätze finanzieren, die im österreichischen Interessenschwer-punktbereich hegen. Das heißt: Wo eine Möglichkeit besteht, die Wirtschaft anzukurbeln, bei einer gleichzeitig möglichst großen Einbindung des betreffenden Landes in den Welthandel und insbesondere in die Handelsbeziehungen mit Österreich.
Die Sozialistische Internationale hat in Lateinamerika politisch offenkundig in absehbarer Zeit keine Aussichten. Afrika aber stellt ein politisches Hoffnungsgebiet des Sozialismus dar. Der Wettlauf zwischen Kommunismus
und Sozialismus auf dem schwarzen Erdteil ist in vollem Gange. Daher gelten in Hinkunft nur mehr afrikanische Länder als Schwerpunktbereiche. Außerdem liegt Afrika den Europäern wesentlich näher.
Diese Frage des Einsatzes betreffen aber nicht allein die einzelnen Entwicklungshilfeorganisationen, sie sind zum essentiellen Problem der gesamten katholischen Entwicklungshilfe in Österreich geworden.
Der OED ist entschlossen, eine Eigenmittel für jene Programme in Lateinamerika einzusetzen, die nicht im Interesse des Staates hegen. Im kommenden Jahr werden aber die Mittel, über die der OED verfügen kann, nicht mehr ausreichen, man wäre gezwungen, die Programme drastisch zu reduzieren, was bald einer totalen Einstellung gleichkäme. Kann die Kirche auf diesen Ausdruck der Diakpnie verzichten?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!