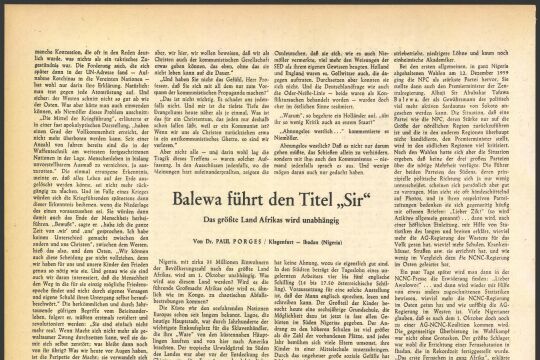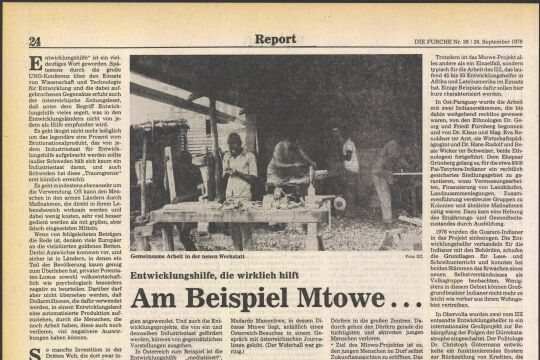In Afrika zählen Geschäft und Politik, aber nicht Humanität
Afrika, das ist der Kontinent vor der Tür Europas, der Erdteil, der sich für die Entwicklungshilfe geradezu mit einem moralischen Imperativ anbietet. Dieser „schwarze Kontinent“ bildet seit je den Schwerpunkt sowohl für kirchliche wie für staatliche Hilfen. Gerade in Afrika aber kam die staatliche Spendentätigkeit zumindest zu Beginn in vielen Fällen nicht denen zugute, die es am meisten benötigten. Das hat dem Ruf der Entwicklungshilfe sehr geschadet.
Die eingesetzten Entwicklungshelfer einerseits, die Politiker und Wirtschaftsfachleute anderseits haben mit der Zeit ihre Erfahrungen gesammelt und gelernt, daß erst die Grundbedürfnisse - Nahrung, Kleidung, Wohnung, Gesundheit, Erziehung und Arbeit - zu stillen sind. Erst auf diesem Grund kann dann begonnen werden, den gesamten Lebensstandard durch Bodenreformen, landwirtschaftliche Genossenschaftseinrichtungen und mit einer selbständigen Verwaltung kleinerer Gemeinschaftszonen zu heben.
In der Entwicklungshilfe engagierten sich nicht nur die Kirchen, sondern auch Staaten und Politiker, Wirtschaftsgruppen und Industrien. So verschieden wie ihre Standpunkte und ihre Einstellung zu den unterentwik-kelten Ländern sind, so unterschiedlich sind auch ihre Projekte und die Probleme, mit denen sie konfrontiert werden, aber auch ihre Erfolge und Mißerfolge.
Geradezu ein Musterbeispiel für verfahrene Entwicklungspolitik stellt das kupferreiche Zambia dar. Es ist das einzige Land, mit dem Österreich eine Art Staatsvertrag für Entwicklungshilfe abgeschlossen hat, ein Binnenland, das von so problemgeladenen Staaten wie Angola, Rhodesien und Mozambique umgeben ist. Die weltpolitische Situation hat es innerhalb kurzer Zeit jeder Exportmöglichkeit beraubt. Der Kupferbergbau mußte praktisch stillgelegt werden, daher kann es auch den von Österreich zur Verfügung gestellten Kredit von einer Million Dollar derzeit nicht einsetzen. Ein Heer von Arbeitslosen bedeutet nun eine stete Unruhequelle.
Anderseits besitzt Zambia ein gut ausgebautes Schulnetz nach europäischem Muster. Etwa 80.000 Jugendliche verlassen jährlich die Schule. 20.000 davon können recht und schlecht einen Arbeitsplatz finden oder studieren weiter, doch die anderen können sich meistens in ihren alten Dorfgemeinschaften nicht mehr zurechtfinden. Viele junge Leute lassen sich von den Guerillakämpfern an den
Grenzen zu Rhodesien anwerben. Sie hoffen, daß ein Umschwung im Nachbarland auch ihnen neuen Wirtschaftsaufschwung bringen wird.
Das kirchliche Institut für Internationale Zusammenarbeit (HZ) in Wien hat sich nun dieses Problems angenommen. Um die Unruhe in der Jugend zu steuern und Arbeit zu schaffen, haben das Entwicklungshelferehepaar Johann und Gertrude Rauch mit einem einheimischen Dorfschullehrer in Chipata eine großangelegte Aktion zum Erlernen handwerklicher Berufe gestartet. Außerdem gibt die Diözese - was früher der Stammeshäuptling getan hat - Land aus kirchlichem Besitz, um die jungen Leute wieder in die Landwirtschaft zurückzuführen. Für dieses Projekt würde natürlich auch Geld aus dem österreichischen Fonds für Entwicklungshilfe dringend benötigt. Dafür aber hat unser Staat kein Geld. Man fragt sich ernstlich, ob Friede statt Bürgerkrieg und Buschkampf nicht das Geld wert wäre! .
Doch bei einer Besprechung zwischen der Leitung des österreichischen Entwicklungsdienstes (OED) einerseits, Staatssekretär-Adolf Nußbaumer und Sektionschef Otto Gat-scha anderseits wurde am 13. Februar klargestellt, daß die Entwicklungshilfe des Staates im wesentlichen wirt-schaftsorientiert und darauf ausgerichtet sein müsse, für Österreich Handelsbeziehungen anzuknüpfen, um unmittelbar österreichische Waren absetzen zu können.
In der Paxis sieht das dann so aus: In jüngster Zeit ist der Sudan zu einem Hoffnungsland des österreichischen Außenhandels geworden. Dieses Land verfügt über große fruchtbare Bodengebiete. Saudi-Arabien und Kuweit stellen reichlich Geld zur Entwicklung zur Verfügung - sie geben derzeit die beachtliche Summe von drei Prozent ihres Bruttonationalproduktes für ihnen nahestehende islamische Staaten aus (zum Vergleich: Österreich stellt für alle Entwicklungsländer zusammen nur 0,1 Prozent bereit) -, um den Sudan zur Kornkammer Afrikas zu machen. Hunderte landwirtschaftliche Projekte sind bereits in Arbeit. Die Europäer, in unserem speziellen Falle Österreich, stellen das Know-how und das Service zur Verfügung. Die Steyr-Werke liefern Traktoren, Geländefahrzeuge und Elektroaggregate auf kommerzieller Basis.
Am 3. April erfolgte die feierliche Ubergabe eines kombinierten Wohn-und Werkstattwagens an die „Entwicklungshelfer“. Im internationalen Geschäftsleben ist es meist üblich,
daß, wenn ein gewisses Kontingent an Maschinen an seinen Bestimmungsort kommt, die Lieferfirma aus eigenem das Service zur Wartung der Geräte übernimmt und das einheimische Personal anlernt. Die Mechaniker der Steyr-Werke aber werden nicht von der Verstaatlichten Industrie, sondern von der österreichischen staatlichen Entwicklungshilfe bezahlt. Ist aber ein Techniker Entwicklungshelfer? Werden hier nicht Know-how und Service zu einem guten Geschäft? - Wie aber sagte Staatssekretär Nußbaumer, als er in der „Zeit im Bild“ am 18. April auf dieses Problem der Entwicklungshilfe angesprochen wurde: „Wir sollten doch nie aus den Augen verlieren, daß es hier im wesentlichen um ein humanitäres Anliegen geht, und daß wir ja den Entwicklungsländern in erster Linie helfen wollen und in zweiter Linie uns selbst.'
Für bilaterale Projekthilfe sind im Budget nur 108 Millionen Schilling vorgesehen. Man wül sich daher auf wenige Länder konzentrieren, in denen auch wirtschaftliche Interessen für Österreich bestehen. So gehen seit Jahren 1000 Zuchtrinder nach Tunesien. Das Land liegt nahe, es gibt keinen langen Transportweg und den österreichischen Bauern wird ebenfalls geholfen. Es werden Musterfarmen errichtet, Veterinäre hinaus gesandt, die das Vieh fachkundig betreuen. So entstehen in Afrika Wohlstandsinseln, auf denen die Lebensbedingungen, verglichen mit ihrer Umwelt, ungewöhnlich hoch sind.
Eine Musterfarm aber bleibt auf diesem Kontinent ohne jede Ausstrahlungskraft. Der Unterschied zwischen arm und reich wird noch verschärft. Nur wenn kleine, sehr dezentralisierte Wirtschaftskreisläufe in mehreren, nebeneinanderliegenden Dörfern entstehen, kann die Infrastruktur gefördert und das Lebensniveau einer Gegend langsam gehoben werden.
Um die staatliche Wirtschaftshilfe nicht versanden zu lassen, versuchen die kirchlichen Entwicklungsdienste, OED und HZ, Alternativprogramme zu entwickeln. Dabei müssen sie wohl oder übel Kompromisse schließen, denn Sektionschef Gatscha hat ausdrücklich betont, daß nur Geld für eine gleichzeitige Förderung österreichischer Wirtschaftsinteressen ausgegeben werde. OED und HZ versuchen nun, der armen Landbevölkerung unter die Arme zu greifen. Dazu brauchen sie keine hochqualifizierten Experten. In einem intensiven Einsatz von Entwicklungshelfern werden Rinder unter die mittleren Bauern gebracht, die wenigstens einen Stall bereitstellen können, um ihnen die Grundvoraussetzungen beizubringen, wie eine Kuh und ein Kalb aufgezogen werden müssen. Diese Entwicklungshelfer an der Basis aber stehen außerhalb der staatlichen Entwicklungshilfe.
In Kamerun baut ein großer internationaler Konzern eine Zellulosefabrik, ohne die sozialen Probleme, die dadurch entstehen können, zu berücksichtigen. Das Panafrikanische Entwicklungsinstitut, in dem die westeuropäischen Länder zusammenarbeiten und in dem auch Österreich vertreten ist, hat sich dieses Projektes angenommen, um ein Begleitprogramm zu erstellen, damit die auftretenden Probleme einer Verproletarisierung der Einheimischen und eine Slumbildung verhindert oder wenigstens entschärft werden.
Kenia und die Elfenbeinküste sind vollkommen frei-marktwirtschaftlich orientierte Staaten. Sie haben für ausländisches Kapital ein äußerst günstiges Investitionsklima geschaffen. Das zieht aber auch die Nachteile einer raschen Industrialisierung nach sich: Die städtischen Slums wuchern, und der Unterschied zwischen arm und reich wächst zusehends.
Europa hat heute die große Chance, Afrika als politischen und Wirtschaftspartner zu gewinnen und sowjetischen wie amerikanischen Einfluß zurückzudrängen. Mit der reinen Investitionstätigkeit aber wird man die Länder des schwarzen Kontinents nicht gewinnen können, da dort nicht jene Verhältnisse zu finden sind, wie sie der Marshall-Plan im Europa nach dem letzten Krieg gefunden hatte. Ein partnerschaftliches Verhältnis zwischen Europa und Afrika muß auf einer ganz anderen Grundlage angestrebt werden.
Die Entwicklungsideologie des Pater Josef Lebret, des Vaters der katholischen Entwicklungshilfe, sieht für Afrika statt kapitalistischer Unternehmerinitiative eine langfristige Planung und staatliche Initiativen vor, die gleichzeitig einen gewissen Mythos ausstrahlen. Dieser Mythos, wenngleich für europäische Augen ein wenig romantisch, ist für die jungen afrikanischen Staaten notwendig, sagt Pater Lebret, um über die vielen konfessionellen und Stammesgegensätze
hinwegzuhelfen und damit sie sich auf ihr altes afrikanisches Erbe besinnen.
Schüler von Pater Lebret sind Leopold Senghor von Senegal, Julius Nye-rere aus Tansania, beide praktizierende Katholiken, und Kenneth Kaunda, ein Christ der Presbyteriani-schen Kirche. Alle drei verbreiten die Ideen eines afrikanischen Sozialismus und sind selbst Parteiführer und Präsidenten ihres Landes. Selbstverständlich sind sie auch im Board der Sozialistischen Internationale vertreten. Nicht zuletzt durch sie ist Afrika ein Hoffnungsgebiet des internationalen Sozialismus geworden. Der Wettlauf zwischen dem sowjetischen Kommunismus und dem europäischen Sozialismus ist auf diesem Kontinent bereits in vollem Gange. Auch die österreichische Regierung schließt sich dem Trend ihrer internationalen Parteifreunde an. Die staatliche Entwicklungshilfe wird daher heute genau bestimmt, wohin zu sie zu gehen hat und zu welchem Zweck sie eingesetzt wird. Selbst in personeller Hinsicht wird nach Parteigesichtspunkten ausgewählt,' so als ob nur Sozialisten allein „Entwicklungshilfe“ leisten könnten.
Für Schweden, die Niederlande und Belgien haben humanitäre Ziele dagegen ein wesentlich höheres Gewicht. Die Bundesrepublik Deutschland ist sogar das einzige Land, das den Entwicklungsorganisationen Zuschüsse ohne jeden Einfluß auf die Projekte gibt. LINDA DE ELIAS-BLANCO