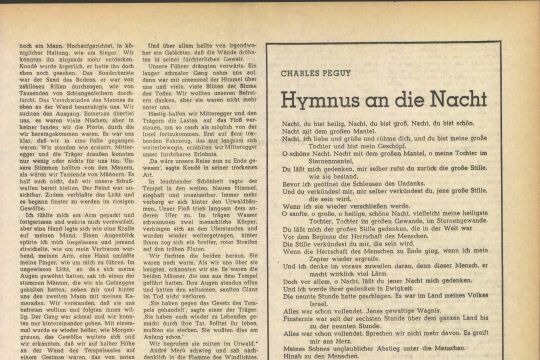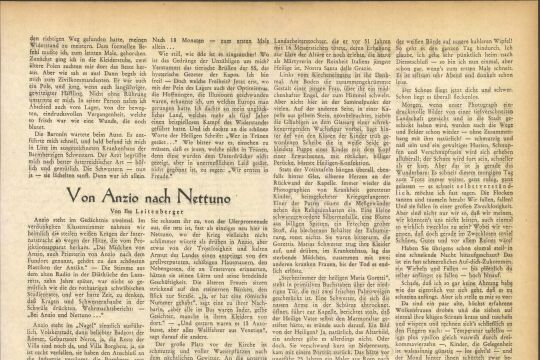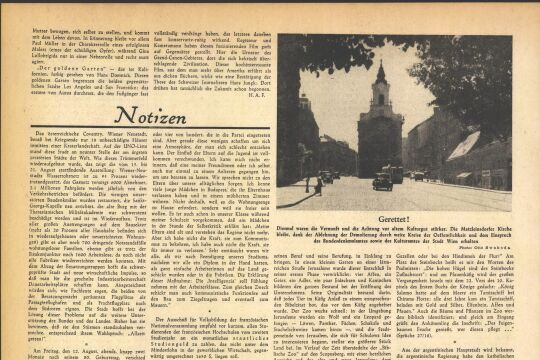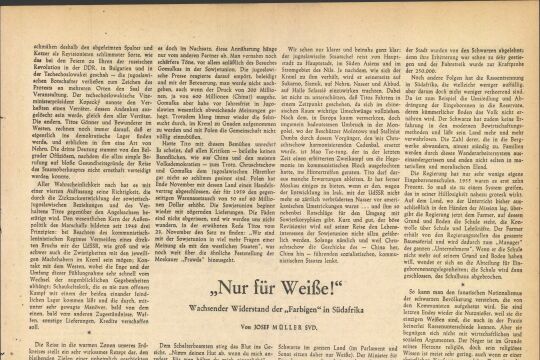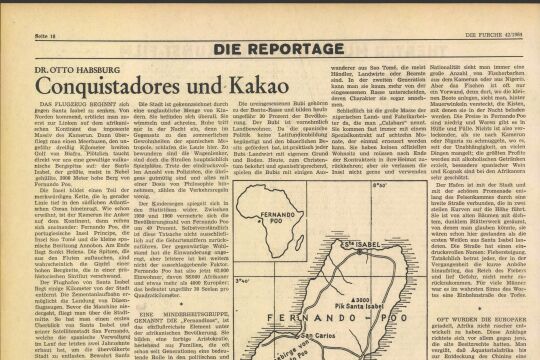In Kolumbiens WILDEM WESTEN
Bankenkriminalität, Korruption und unterdrückte Freiheit. In der Hafenstadt Buenaventura zeigt sich die Schattenseite der südamerikanischen Gesellschaft.
Bankenkriminalität, Korruption und unterdrückte Freiheit. In der Hafenstadt Buenaventura zeigt sich die Schattenseite der südamerikanischen Gesellschaft.
Der Park rund um den Leuchtturm von Buenaventura ist ein beliebter Treffpunkt, wenn die Hitze des Tages vorbei ist. Familien, verliebte Pärchen und Gruppen von Jugendlichen treffen sich hier, sitzen an der Mole und können billige Mahlzeiten zu sich nehmen. Die Bars, wo Batterien leerer Bierflaschen auf den Tischen den Alkoholpegel der einsamen Trinker erahnen lassen, wetteifern mit ohrenbetäubender Musik um die Klientel. Der Pazifik schimmert im Mondlicht.
Diese Idylle für einfache Leute soll bald verschwinden. Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, dann wird hier eine elegante Uferpromenade angelegt, ein Malecón, wo sich vor allem Touristen wohlfühlen sollen. Mit hochpreisigen Restaurants und Bars ist zu rechnen.
Aufregung herrscht deswegen im Stadtteil San José, der der Verlängerung der Uferpromenade im Wege steht. Es ist ein übelriechender Slum, wo sich nachts niemand auf die Straße traut, weil bewaffnete Banden ihren illegalen Geschäften nachgehen. Trotzdem hängen die Bewohner an dem heruntergekommenen Bezirk, den sie durch Aufschüttung von Müll und den Schalen von Krustentieren über die Jahre dem Meer abgetrotzt haben. Viele der Häuser stehen auf Stelzen.
Leben mit Tradition
Die Menschen hier leben mit dem Meer und vom Meer. Viele sind Fischer, andere verdingen sich als Tagelöhner am Hafen. Harrinson Moreno, ein Aktivist, der sich für die Erhaltung des historischen afrokolumbianischen Viertels einsetzt, kennt noch einen anderen Grund, warum niemand weg will: "Wir pflegen seit altersher einen Brauch: wenn ein Kind geboren wird, dann wird die Nabelschnur unter einem Baum oder einer Kokospalme vergraben". Die starke Beziehung zum Territorium habe also auch eine spirituelle Dimension. Die von der Stadtverwaltung vorgesehene Abschiebung in eine neue Betonsiedlung namens San Antonio, 18 Kilometer landeinwärts, sei für die Einwohner von San José keine Option: "Wenn man uns nach San Antonio umsiedelt, wo es keine Mangroven und kein Meer gibt, dann holt man uns aus einer Armut, in der wir überleben können, und liefert uns dem absoluten Elend aus".
Buenaventura war lange Zeit ein verschlafener Pazifikhafen. Der Außenhandel wurde fast zur Gänze über die Häfen am Atlantik abgewickelt. Mit dem Aufschwung des Pazifikhandels zu Beginn der 1990er-Jahre sollte sich das ändern. Die Regierungen in Bogotá interessierten sich zwar nicht für die Stadt, die in 400 Jahren rund um den Hafen gewachsen war, doch der Hafen erfuhr eine schrittweise Aufwertung. Im Einklang mit der herrschenden Marktideologie wurden die Anlagen nach und nach privatisiert. Heute werden 60 Prozent der Exporte und Importe hier umgeschlagen.
Das Zentrum von Buenaventura liegt auf einer Insel, die durch eine einzige Brücke mit dem Festland verbunden ist. Die Hafenanlagen erstrecken sich entlang des Nordufers der Insel und breiten sich immer weiter entlang der Festlandküste aus. Mangrovenwälder, die den Wellengang abdämpfen und als Biotop für Fische und Krebstierchen vielen Menschen eine Lebensgrundlage bieten, verschwinden nach und nach. Auch die ältesten Stadtteile sollen den Begehrlichkeiten der Reeder oder den Modernisierungsplänen der Stadtverwaltung weichen.
Bürgermeister Bartolo Valencia sitzt nicht im Rathaus, sondern im Gefängnis. Ihm wird vorgeworfen, das städtische Schulbudget in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Dementsprechend schlecht ist es um die Ausstattung der Schulen und den Unterricht bestellt. Aber das ist nicht das größte Problem der Stadt, die im fernen Bogotá als "Wilder Westen" Kolumbiens abgeschrieben wird. Landraub, Gewalt und Korruption prägen das Leben. Die paramilitärischen Banden La Empresa und Los Urabeños kämpfen um den Einfluss auf die Stadtverwaltung und die Kontrolle über die Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. Überall dort, wo es um die Hafenerweiterung auf Kosten von alten Stadtvierteln geht, tauchen Bewaffnete auf und bedrohen die Bevölkerung. Berüchtigt sind die Casas de pique von Buenaventura -Häuser, wo Menschen ermordet werden.
"Vor kurzem verschwand eine Frau. Wenig später wurden nur mehr Teile von ihr gefunden", erzählt Adriel Ruiz. Der Redemptoristenpater, der mit seinen langen Haaren, T-Shirt und Jeans eher wie ein Sozialarbeiter aussieht, leitet die Stiftung Fundescodes, die Kindern und Jugendlichen Freizeitaktivitäten und Schulungen bieten. "Weil sie zu uns kommen, leben sie noch", meint er. Diese Projekte werden von der österreichischen Dreikönigsaktion unterstützt.
Im Obergeschoss des Fundescodes-Sitzes hängen Portraits von Menschen aus dem Bezirk, die in den vergangenen Jahren ermordet wurden oder verschwunden sind. Es sind über 150. In ganz Buenaventura, einer Stadt von 400.000 Einwohnern seien zuletzt zwischen 300 und 400 Menschen jährlich gewaltsam ums Leben gekommen, weiß Pater Adriel. Wie viele Morde wurden aufgeklärt? "Kein einziger". Bis vor kurzem habe es nicht einmal einen Staatsanwalt gegeben. Ohne den Druck der sozialen Bewegungen würden gar keine Ermittlungen aufgenommen, so der Geistliche. Das Vertrauen in die Behörden sei gleich Null. Ganze Stadtteile werden von kriminellen Banden regiert, die von allen Geschäftsleuten, selbst Busfahrern und Taxilenkern Schutzgelder einfordern. In bestimmte Bezirke wird man deswegen kein Taxi bekommen.
Auch der Stadtteil Puente Nayero war so ein Viertel, wo die Gewalt regierte. Unter einem Palmdach spielen Männer Domino. Jugendliche haben ihre Stereoanlagen auf volle Lautstärke gedreht und sitzen auf einem umgedrehten Boot. Aus den Häusern dringt der Duft von gebratenem Fisch und Brotfrucht. Die Menschen wirken fröhlich und entspannt.
Gift und Militär
Das war nicht immer so, sagt der 61-jährige Fischer Hilario Reina Aguirre. Er erinnert sich noch gut, als die ersten Bewohner vor 30 Jahren begannen, eine Müllhalde am Rande des Meeres in bewohnbares Land zu verwandeln. Der Müll wurde mit Erde zugeschüttet und eingeebnet. Die Menschen lebten vor allem vom Fischfang. Der Friede hatte ein Ende, als vor etwa zwölf Jahren in der Nähe große Hotels gebaut wurden. "Die Hotelzone soll erweitert werden", sagt Reina, "wir stehen dem im Weg". Plötzlich seien die Paramilitärs aufgetaucht und hätten die Leute von Puente Nayero terrorisiert. Aus einer Casa de Pique habe man immer wieder Schreie gehört.
Den mögliche Ausweg fand ein Freund, der im Norden des Landes die humanitäre Zone von San José de Apartadó kennenlernte. Dort beschlossen die Bewohner eines von der Gewalt geplagten Dorfes, sämtlichen bewaffneten Akteuren den Zutritt zu verwehren. Wie man das anstellt, wusste zunächst niemand. Aber man fand Unterstützung bei der Organisation Justitia et Pax, die auch die Gemeinde San José im fernen Urabá begleitet und vom österreichischen Versöhnungsbund unterstützt wird. Im Geheimen wurden über 20 Koordinatoren geschult, von denen einige wieder absprangen weil sie um ihr Leben fürchteten.
Eine Messe, die Héctor Epalza, der Bischof von Buenaventura, am 13. April 2014 las, diente als Anlass für den Befreiungsschlag. Der Bischof forderte ein Ende der Gewalt und im Beisein internationaler Beobachter erklärten sich die Bewohner von Puente Nayero zum "humanitären Raum". "Das Leben eines US-Amerikaners zählt mehr als das von tausend Kolumbianern", sagt Luis Grueso, einer der Koordinatoren. Die Paramilitärs hätten sich darauf zurückgezogen. Armee und Polizei mussten sich verpflichten, den notwendigen Schutz zu gewährleisten. Polizisten wachen an fünf strategischen Punkten darüber, dass kein Bewaffneter das Viertel betritt. Sie selbst halten sich heraus. Aber ohne die Präsenz internationaler Beobachter würden sich die Leute im Puente Nayero auch jetzt noch nicht sicher fühlen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!