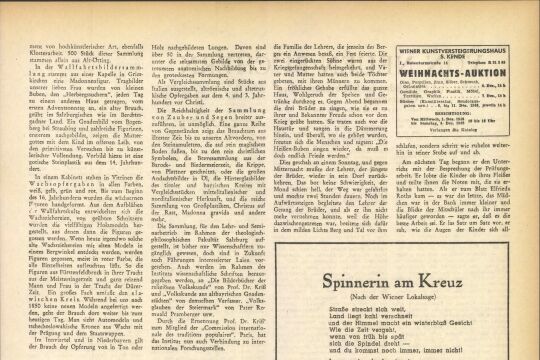Literarischer Erfolg, sachliche Blamage
Unter den unveröffentlichten Manuskripten Friedrich Torbergs fand sich ein Essay, in dem er die Entstehungsgeschichte seines Romanerstlings,,Der Schüler Gerber" schildert. Anläßlich der erfolgreichen Premiere der Romanverfilmung veröffentlicht die FURCHE eine gekürzte Fassung dieser 1973 entstandenen Erinnerung.
Unter den unveröffentlichten Manuskripten Friedrich Torbergs fand sich ein Essay, in dem er die Entstehungsgeschichte seines Romanerstlings,,Der Schüler Gerber" schildert. Anläßlich der erfolgreichen Premiere der Romanverfilmung veröffentlicht die FURCHE eine gekürzte Fassung dieser 1973 entstandenen Erinnerung.
Am besten beginne ich wohl mit der Mitteilung, daß ich seit meiner frühesten Jugend - um nicht zu sagen: seit meiner Kindheit - fest entschlossen war, Schriftsteller zu werden - um nicht zu sagen: ein Dichter - und daß ich mir niemals einen anderen Beruf für mich vorstellen konnte als einen, der mit Schreiben zu tun hat.
Ich war, wenn schon kein geborener Literat, so doch eine literarische Frühgeburt, ich begann als sieben- oder achtjähriger Volksschüler, zur Zeit des Ersten Weltkrieges, patriotische Reime von mir zu geben, und ich war von meiner Sendung offenbar schon damals so tief überzeugt, daß ich das Heft, in das ich diese Gedichte einschrieb, sorgfältig aufbewahrte...
Es versteht sich von selbst, daß ich mit jenen kindischen Reimen niemals an die Öffentlichkeit getreten bin, sondern mich damit begnügte, sie Verwandten oder Mitschülern aufzusagen. Zu den ersten Veröffentlichungen in
Zeitungen und Zeitschriften brachte ich es während meiner Gymnasialzeit ...
Indessen begann neben meiner poetischen allmählich auch meine polemische Ader zu pulsen, und in den letzten Jahren am Gymnasium wuchs mein Widerwille gegen die Ungerechtigkeit der Professoren und gegen die Unterwürfigkeit der Schüler, wuchs meine Angriffslust gegen die Mißstände der Institution „Schule“ so heftig, daß ich ihr Luft machen mußte. Ich tat das in Form von kleinen Glossen, in denen ich diese Mißstände aufzuzeigen unternahm, in Form von Kurzgeschichten, in denen ich zum Teil Erfundenes und zum Teil Erlebtes verarbeitete, manchmal sogar in Form satirischer (oder satirisch gemeinter) Epigramme.
Natürlich konnte ich all diese Dinge nicht gut unter meinem eigenen Namen veröffentlichen, da ich ja noch der Schuldisziplin unterstand und mich schwerster Bestrafung ausgesetzt hätte. Deshalb mußte ich mir einen Decknamen erfinden.
Ich bildete aus dem zweiten Teil meines Vaternamens Kantor und aus dem Geburtsnamen meiner Mutter Berg das Pseudonym Torberg, das mich einerseits vor nachteiligen Folgen in der Schule deckte (was ja die Funktion eines Decknamens ist) - anderseits hatte ich die Möglichkeit, im eitlen Bedarfsfall meine Autorschaft nachweisen zu können, also vertrauenswürdigen Freunden unter der Auflage strikter Geheimhaltung zuzuflüstern: „Du verstehst ... Kan-tor-berg ... das bin nämlich ich.“
Es war nicht zuletzt der Erfolg des „Schüler Gerber“, der mich einige Jahre später bewogen hat, den Namen Torberg als bürgerlichen Namen anzunehmen.
Damit halte ich eigentlich schon bei der Entstehungsgeschichte meines Romans, für die mir noch ein kurzer Rückblick erforderlich erscheint. Ich war in Wien bald nach Beendigung des Ersten Weltkrieges ans Gymnasium gekommen, zu einer Zeit, da in der jungen Republik Österreich die „Glöckelsche Schulreform“ einsetzte.
Zunächst wirkte sie sich unter anderem durch die Einführung von „Schülerräten“ aus, einer dreigliedrigen, von der ganzen Klasse in geheimer Wahl bestimmten Vertretung, die aus einem Sprecher und zwei Beiräten bestand und der es oblag, dem Lehrkörper gegenüber die Interessen der Schülerschaft zu wahren - sei es im Hinblick auf den Unterrichtsstoff, auf seine Schwierigkeiten, auf seine Behandlung, sei es im Hinblick auf die Behandlung der Schüler durch die Professoren.
Theoretisch sah das alles sehr schön
aus, praktisch gedieh es schon damals nicht sehr weit. Die Vorzugsschüler waren an einer Störung ihres friedlichen Einvernehmens mit den Professoren in keiner Weise interessiert, und die schlechten Schüler wollten sich auf Auseinandersetzungen und damit auf weitere Gefährdungen ihrer ohnehin schwachen Position erst recht nicht einlassen.
Ich stand ungefähr in der Mitte zwischen den beiden Lagern, gehörte in ei
nigen Gegenständen zu den Besten, in einigen anderen zu den Schlechtesten der Klasse und hatte teils trotzdem, teils infolgedessen das Pech, zum Klassensprecher gewählt zu werden.
Nachdem ich mich mit einigen Versuchen, namens der Klasse kämpferische Aktivität zu entfalten, entweder gegen meine beiden Beiräte oder gegen den betreffenden Professor nicht durchgesetzt hatte, pendelten sich die Dinge allmählich dahin ein, daß zwischen mir und den mir mißliebigen Professoren - wobei die Mißliebigkeit durchaus gegenseitig war - eine Art stillschweigenden Burgfriedens zustandekam: ich unterließ meine Anfeindungen und die Professoren unterließen es, mich öfter und gründlicher als unbedingt nötig zu prüfen ...
fjs lag in der Natur der Sache, daß dieses Stillhalteabkommen sich vor allem in jenen Fächern ergab, die mich nicht interessierten und in denen ich auch unter normalen Voraussetzungen nur dürftige oder gar unzureichende Leistungen geboten hätte. Das galt neben den Naturwissenschaften in erster Linie für die Mathematik, und damit war bereits der Grundstock für meinen späteren Durchfall bei der Matura gelegt.
Es kam noch ein weiterer Umstand hinzu. Im Jahre 1923 übersiedelte meine Familie von Wien nach Prag, wo ich den Mittelschulbesuch fortsetzte und wo die Verhältnisse, jedenfalls an den deutschsprachigen Mittelschulen, noch ganz bedeutend rückständiger waren als in Wien.
Es herrschte noch das alte, autoritäre Schulsystem aus den Zeiten der untergegangenen Monarchie, die Professoren ergingen sich in Willkürakten, die in Wien nicht mehr möglich gewesen wären, protegierten ihre Lieblingsschüler ebenso unverhohlen, wie sie diejenigen, die ihnen nicht zu Gesicht standen, benachteiligten, und das Schlimmste war, daß es gegen all das keinen Widerstand gab, geschweige denn einen sozusagen rechtlich verankerten, wie ich ihn in Wien als Sprecher des Schülerrates meiner Klasse gekannt und geübt hatte...
Wann ich den Plan zur Niederschrift dieses Werkes gefaßt habe, kann ich heute nicht mehr sagen. Es muß noch während meiner Schulzeit gewesen sein, wahrscheinlich im letzten, achten Jahr des Gymnasiums, dem Jahr der Reifeprüfung, aber genau weiß ich es nicht...
Ich habe die Reifeprüfung nicht bestanden. Ich bin in Mathematik durchgefallen und wurde auf ein Jahr „repro- biert“, das heißt: ich mußte, ohne die achte Klasse zu wiederholen, ein Jahr später nochmals zur Matura antreten,
bei der ich dann mit Müh und Not und knapper Stimmenmehrheit für reif erklärt wurde.
In diesem Jahr begann ich den „Schüler Gerber“ zu schreiben. Und ich lege Wert auf die Feststellung, daß mein Durchfall bei der Matura nur der Anstoß war, nicht etwa der Anlaß. Ich hätte den Roman auch dann geschrieben, wenn ich durchgekommen wäre. Es hatte sich in mir so viel Zorn und Empörung angesammelt, daß ich ihn einfach schreiben mußte.
Möglicherweise liegt in der Vehemenz dieses Müssens, in der Unmittelbarkeit seiner Gestaltung, mit der ich ja praktisch noch auf der Schulbank anfing, in der Nähe der Erinnerung, die mich während der ganzen Niederschrift an der Gurgel hatte und mir bei der Schilderung manch einer Prüfungs- Szene noch nachträglich den Angstschweiß auf die Stirne trieb - möglicherweise liegt gerade in dieser Distanz- losigkeit der Unterschied zu allen vorherigen Schülerromanen, die ja immer schon von Erwachsenen geschrieben waren.
ICurt Tucholsky, der den „Schüler Gerber“ in einer seitenlangen Besprechung in der „Weltbühne“ vom Mai 1930 enthusiastisch begrüßt hat (er war, wie ich mit einigem Stolz hinzufügen darf, nicht der einzige, auch Robert Musil fand in der „Frankfurter Zeitung“ Worte der schönsten Anerkennung, die mir auch noch von einigen anderen prominenten Autoren und Kritikern jener Epoche zuteil wurde) - Kurt Tucholsky also rühmte dem Roman eben diese Unmittelbarkeit nach, einen „zischenden Haß, der durch die Seiten brennt - und nichts macht hellsichtiger als solcher Haß“.
Nun mag ja Haß keine besonders edle Regung sein, aber er hat sich hier jedenfalls als eine sehr produktive Regung erwiesen. Er war in der Tat ein wesentlicher Antrieb für diesen Roman. Ich haßte die Schule, ich haßte ihren Zwang, ich haßte das ganze System und ich wollte ihm zu Leibe rücken, solange mein Haß noch lebendig war.
Er steigerte sich sogar, als während der Niederschrift des Romans - die mit einigen Unterbrechungen insgesamt zwei Jahre in Anspruch nahm - durch Wiener und Prager Zeitungsnotizen nicht weniger als zehn Schülerselbstmorde zu meiner Kenntnis gelangten ...
So stand im großen und ganzen das Konzept des Romans für mich von An
fang an fest. Die Handlung sollte auf das letzte Mittelschuljahr des Helden und auf die abschließende Reifeprüfung beschränkt bleiben, Kurt Gerber sollte in seinem Verhältnis zu Professoren und Klassenkameraden, zu seinen Eltern und zu einer früheren Mitschülerin gezeigt werden, und sein Selbstmord am Schluß sollte sich nachträglich als unbegründet erweisen - insofern unbegründet, als aus einer epilogisch angefügten Zeitungsnotiz hervorgeht, daß der Schüler Gerber die Reifeprüfung bestanden hat.
Anderseits war, während er auf die Verkündigung des Prüfungsergebnisses wartete, in einer phantastischen Fiebervision das Leben vor ihm zur Reifeprüfung angetreten und durchgefallen. Es sollte also offenbleiben, ob er aus Enttäuschung und vergeblicher Auflehnung in jedem Fall mit seinem Leben Schluß gemacht hätte.
Ich habe vorhin von „abgesteckten Fronten“ gesprochen, und Kurt Gerber war ja wirklich nach mehreren Seiten hin in eine Kampfstellung geraten. Er stand in Opposition zu seinem Vater, den er liebte und respektierte, und in dem er eben darum nur ungern einen Verfechter jener bürgerlichen Konventionen sah, für die eine erfolgreich bestandene Matura mit anschließendem Erwerb eines akademischen Titels immer noch als mehr oder minder unerläßliche Voraussetzung des gesellschaftlichen Fortkommens und Ansehens galt.
Auch in der Liebesbeziehung zu seiner ehemaligen Mitschülerin Lisa Ber- wald glaubt Kurt an konventionelle Behinderungen und Einengungen zu stoßen, gegen die er machtlos ist.
Aber den eigentlichen und eigentlich zermürbenden Zweifrontenkrieg führt er in der Schule. Er führt ihn gegen die Selbstherrlichkeit und Selbstgefälligkeit der Professoren, gegen die unumschränkte, nahezu diktatorische Verfügungsgewalt, die sie sich anmaßen, gegen ihre Willkür und Ungerechtigkeit, die sein fanatischer Gerechtigkeitssinn nicht erträgt.
Und er führt den Kampf zugleich gegen die Schüler, die ihren Gerechtigkeitssinn aus opportunistischen Erwägungen unterdrücken, gegen die Kriecher und Streber, die lieber mit den Professoren gemeinsame Sache machen als mit ihresgleichen und die selbst dort auf jede Gegenwehr verzichten, wo sie mit ein wenig Solidarität etwas erreichen könnten.
„Das werden wir ja gleich sehen“, sagt an einer Stelle des Romans der Gegenspieler Kurt Gerbers, der Mathematikprofessor Kupfer, in dem sich für
Kurt die ganze Brutalität des Schulsystems verkörpert und den die Schüler seiner von ihm gerne betonten Allmacht und Unfehlbarkeit wegen „Gott Kupfer“ nennen.
„Das werden wir ja gleich sehen“, sagt er, und Kurt denkt dazu: „Welch eine Schmach. Oben steht ein einziger und sagt ,wir‘ - unten sitzen so viele und jeder sagt ,ich‘.“ Die ganze Haltung Kurt Gerbers und die ganze Ursache ihrer Vergeblichkeit haben hier den kürzesten Ausdruck gefunden.
Kiurt bevorzugt die humanistischen Fächer, die Sprachen vor allem, Deutsch und die deutsche Literatur, Latein und Französisch, aber auch Geschichte und in den beiden letzten Jahrgängen die Philosophie. Mit Mathematik, Physik, Chemie und ähnlichen Gegenständen weiß er nichts anzufangen, besonders die Mathematik, deren strenge, an starre Formeln gebundene Methodik der Phantasie keinen Spielraum läßt, erscheint ihm kalt und seelenlos.
Überflüssig zu sagen, daß mit alledem nicht nur die Haltung Kurt Gerbers charakterisiert ist, sondern auch die meine, daß also dieser Roman, wie Erstlingsromane fast immer, stark autobiographisch geprägt ist...
Ob der Roman stilistisch geglückt ist oder nicht, und inwieweit er auch in dieser Hinsicht jene Mängel aufweist, die einem Erstlingsroman beinahe unvermeidlich anhaften - das zu beurteilen bin ich nicht in der Lage. Zur Zeit der Niederschrift stand ich bereits unter dem Einfluß des großen Wiener Sprachmeisters Karl Kraus, ein Einfluß, der sich nach meiner persönlichen Bekanntschaft mit ihm noch verstärkt hat und dem ich hoffentlich gerecht geworden bin.
Mir schien das auch schon damals beim „Schüler Gerber“ der Fall gewesen zu sein, und da ich das gedruckte Buch zum ersten Mal las, hat es mir sehr gut gefallen.
Später änderte sich das, ich fand es an einigen Stellen allzu schwulstig und pathetisch, an anderen allzu wehleidig, ich entdeckte kleinere Unarten aus der Schule des gerade zu Ende gegangenen Expressionismus und fand auch sonst manches auszusetzen. Aber mit der Haltung des Buchs, mit seinem Impetus und seiner Zielsetzung war ich einverstanden und bin es auch heute noch. Als der Roman erschien, stand ich im 21. Lebensjahr und erfreute mich schon seit längerem der tatkräftigen Zuneigung meines väterlichen Freunds und Mentors Max Brod, der als Leiter der Literaturbeilage des „Prager Tagblatts“ meine ersten lyrischen und Prosa-Beiträge veröffentlicht hatte und mir späterhin wiederholt die Ehre erwies, meinen Namen in der Reihe der von ihm entdeckten und geförderten Autoren anzuführen, die mit Franz Kafka begann und über den bedeutenden schlesischen Lyriker Peter Bzruc, über Franz Werfel und den Komponisten Leoš Janâcek bis herunter zu mir reicht.
Brod schickte das Manuskript des „Schüler Gerber“, das ich ihm natürlich zu lesen gab, hinter meinem Rük- ken an den Verlag Zsolnay - wie er mir nachher sagte: mit dem Ersuchen, es im Falle der Ablehnung an ihn zurückzustellen; andernfalls wjire ich direkt zu verständigen. Und so hielt ich eines Tages völlig unvermutet ein Telegramm des Verlags Paul Zsolnay in Händen, das mir von der Annahme meines Romans Mitteilung machte...
Aber die Tatsache, daß ein Buch, mit dem ich die Übelstände des Schulsystems doch hatte bekämpfen und ändern wollen, 43 Jahre nach seinem Erscheinen noch immer präsent und aktuell ist, läßt mich dieses Erfolgs nicht recht froh werden.
Ich habe das Ziel, das ich mir mit dem „Schüler Gerber“ gesteckt hatte, ebenso wenig erreicht wie das Ziel der Klasse. Mein Erstlingsroman war ein literarischer Erfolg und eine sachliche Blamage.