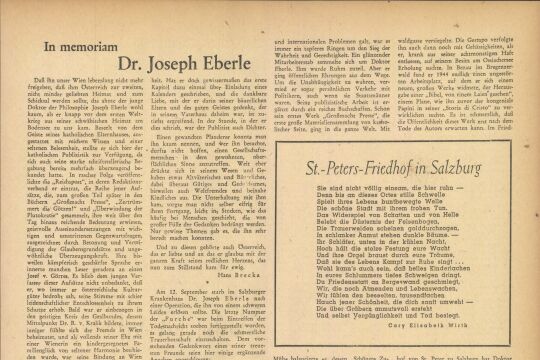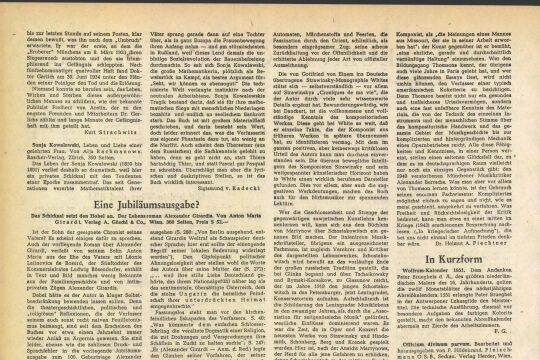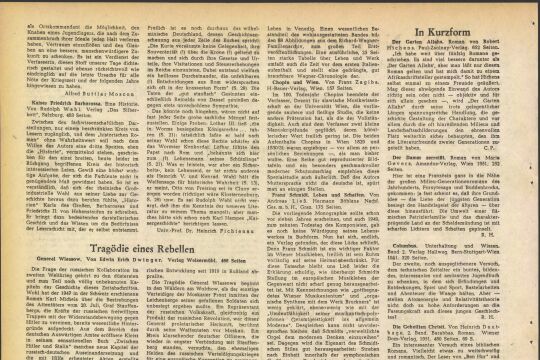Fischer-Dieskau und seine Gouvernanten
Seinen allerersten öffentlichen Liederabend gab er 1948 unmittelbar nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft in einer Berliner Mädchenschule. Vor etwa 40 Zuhörern. Aber auch ein prominenter Berliner Musikkritiker ist dabeigewesen, der sehr beeindruckt war. — Nicht sehr viel mehr Personen mögen es gewesen sein, als Fischer-Dieskau seinen ersten Abend im Mozartsaal gab. Ein reines Beethoven-Programm, wenn ich mich recht erinnere. Also ein Ritt über den Bodensee. Und solche tours de force hat er immer wieder unternommen. Aber nicht nur, um zu zeigen, was er leisten und seinem Publikum zumuten kann, sondern auch um Werke zu präsentieren, die man oft jähre-, ja jahrzehntelang nicht im Zusammenhang hören konnte. Auch die Unpopularität modernster Programme hat Fischer-Dieskau wiederholt (und mit unerwartetem Erfolg) auf sich genommen. Und im Frühjahr 1975 gab er in der Berliner Akademie der Künste ein von ihm zusammengestelltes Programm zum besten, das neben Liedern von Wagner, Liszt, Nietzsche und Peter Gast auch die vierhändige, gemeinsam mit dem Komponisten Aribert Reimann vorgetragene „Manfred“-Meditation von Nietzsche enthielt. (Dies vorweg jenen seiner Kritiker gesagt, die dem'Buchautor die Kenntnis der Werke der beiden zuletzt genannten absprechen.)
Seinen allerersten öffentlichen Liederabend gab er 1948 unmittelbar nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft in einer Berliner Mädchenschule. Vor etwa 40 Zuhörern. Aber auch ein prominenter Berliner Musikkritiker ist dabeigewesen, der sehr beeindruckt war. — Nicht sehr viel mehr Personen mögen es gewesen sein, als Fischer-Dieskau seinen ersten Abend im Mozartsaal gab. Ein reines Beethoven-Programm, wenn ich mich recht erinnere. Also ein Ritt über den Bodensee. Und solche tours de force hat er immer wieder unternommen. Aber nicht nur, um zu zeigen, was er leisten und seinem Publikum zumuten kann, sondern auch um Werke zu präsentieren, die man oft jähre-, ja jahrzehntelang nicht im Zusammenhang hören konnte. Auch die Unpopularität modernster Programme hat Fischer-Dieskau wiederholt (und mit unerwartetem Erfolg) auf sich genommen. Und im Frühjahr 1975 gab er in der Berliner Akademie der Künste ein von ihm zusammengestelltes Programm zum besten, das neben Liedern von Wagner, Liszt, Nietzsche und Peter Gast auch die vierhändige, gemeinsam mit dem Komponisten Aribert Reimann vorgetragene „Manfred“-Meditation von Nietzsche enthielt. (Dies vorweg jenen seiner Kritiker gesagt, die dem'Buchautor die Kenntnis der Werke der beiden zuletzt genannten absprechen.)
Wagner und Nietzsche ist das Thema des 310 Seiten umfassenden, von der Deutschen Verlagsansta.lt Stuttgart herausgebrachten Buches mit dem etwas reißerischen, aber gutgewählten Untertitel „Der Mysta-goge und sein Abtrünniger“. — Das ist eine komplizierte und vielschichtige Materie, nicht nur -ür Musikolo-gen, Philosophen und Dozenten der Ästhetik, sondern auch für Tiefenpsychologen, und zwar weniger für „Freudianer“ als solche aus der Adler-Schule. Denn wieviel Persönliches, Allerpersönlichstes-Intimes spielt da hinein (die tödliche Kränkung zum Beispiel, die Wagner dem Freund durch eine Äußerung zu dessen Arzt zugefügt hat); der offene und unterschwellige Antisemitismus von Bayreuth (der westpreußische Rittergutsbesitzer jüdischer Abstammung,' Philosoph und Nletzsche-FseuhdrPaul Reer war sein Opfer), und dann — die Frauen, von denen Lou von Salome die harmloseste war. Aber Cosima und die Nietzsche-Schwester Elisabeth, die durch eine fast kriminelle Fälschung ein „post-humes Werk“ Nietzsches herausgab, das dieser in der Form nie geschrieben hat und die, zu Nietzsches Empörung und Kummer, einen der ersten prominenten Antisemiten heiratete, den Gymnasiallehrer Paul Förster, der wegen rassistischer Umtriebe von der preußischen Unterrichtsbehörde entlassen wurde und sich — nach Südamerika absetzte („Wie sich die Bilder gleichen!“).
Doch kehren wir zu den Anfängen zurück, zum Beginn der geistigen und persönlichen Beziehungen. —
Nietzsche, erregte durch seine allerersten Publikationen solches Aufsehen, daß er, ohne je das Doktorat gemacht zu haben, als Professor für griechische Sprache und Literatur an die Universität Basel berufen wurde. Aber sein Wirken dort war nur von kurzer Dauer. Eine unheilbare Krankheit, die sich vor allem in rasenden, in regelmäßigen „Schüben“ wiederkehrenden Kopfschmerzen äußerte, trieb ihn ruhelos auf Reisen, vor allem in die Westschweiz und nach Italien, bis hinunter nach Palermo (wo Wagner, wie an dieser Stelle einmal ausführlich geschildert, die Instrumentation des „Parsifal“ beendete). Die Musik beschäftigte Nietzsche schon auf dem Gymnasium von Schulpforta leidenschaftlich, aber als er 1861 „Tristan“ kennenlernte, war's um den Philologen geschehen: er begann nicht nur Musik zu studieren, sondern auch zu komponieren.
Aber den Meister, dessen Musik er so ganz verfallen war, lernte er im Haus des Verlegers Brockhaus erst 1868 kennen. Im Jahr darauf machte er einen längeren Besuch in Trib-schen bei Luzern. Sie begegneten sich weltanschaulich sozusagen auf Schopenhauer-Basis. Wagner erkannte mit dem ihm eigenen Instinkt den unbedingten Verehrer seiner Kunst, den er, obwohl immer von Bewunderern umgeben, als den einzigen Ebenbürtigen empfand.
Und Nietzsche sah sein Idol lebendig vor sich und fand in Wagner einen Gesprächspartner, wie er ihn bisher nicht hatte. (Was Wagner betrifft: wie fast alle schöpferischen Musiker war er — und gerade als künstlerischer Revolutionär und Außenseiter — auf Anerkennung von professoraler Seite, die auf fundierten Fachkenntnissen beruhte, sehr dankbar — ja geradezu erpicht.)
■
Bei jenem ersten Besuch mögen in den Gesprächen Gedanken angeklungen haben, die Nietzsche später in der Schrift „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik“ ausführte, die eine einzige Huldigung an Wagner und Rechtfertigung des Gesamtkunstwerkes war. Sie wurde von diesem auch sofort als solche erkannt. — Aber was sagt Nietzsche in diesem schwierigen, vertrackten, wenig gelungenen Frühwerk? Mit Sokrates gelangte die Anschauung zur „Weltherrschaft“, daß das Denken nicht nur zum Sein vorstoßen, sondern dieses auch verändern könne. Diesen Gedanken führte Nietzsche durch seinen „Heilsweg“ weiter, seine „Theodizee“: Nur als ästhetisches Phänomen sei die Welt, und in ihr der Schrecken der individuellen Existenz im Sinne Schopenhausers, gerechtfertigt. Diese Wiedergeburt der tragischen Weltbetrachtung sei allein imstande, eine kulturelle Regeneration einzuleiten. Von hier war es nur ein Schritt zur Frage nach der idealen Kunstform, und da konnte man bei den Romantikern anknüpfen, deren Traum die Verbindung von Poesie und Musik war. Und damit war man beim „Gesamtkuhst-werk“. Große, echte, wahre Kunst jedenfalls war nur aus tragischer Weltsicht zu schaffen. Aber zu seiner metaphysischen Rechtfertigimg brauche der Schmerz die Erlösung ...
Genau das war es, was Wagner einmal schwarz auf weiß lesen wollte, und es geschah, als Nietzsche ihm einen Vorabdruck seiner Abhandlung schickte. — Außerdem erwies sich Nietzsche als außerordentlich hilfreich in der Erfüllung kleiner Wünsche, Vermittlungen und Besorgungen. Dies wurde von Wagner und den seinen reichlich ausgenützt — und konnte auf die Dauer nicht gut gehen. Dazu kam Menschliches, Allzumenschliches: Nietzsche, empfindlich und empfindsam, „von einer fast engelhaften Reinheit“, wie ihn ein Zeitgenosse einmal geschildert hat, konnte die zuweilen derben und deftigen, in ordinärstem Sächsisch vorgetragenen „Spaße“ Wagners einfach nicht vertragen. Aber dazu kam Wichtigeres. 1876 — Wagner hatte es mit unendlichen Mühen geschafft — fanden die ersten Bayreuther Festspiele im neuerbauten Haus statt. Nietzsche, von allem Anfang an skeptisch, ja ängstlich, war zutiefst enttäuscht. Übrigens war es auch Wagner selbst, beson-was das Publikum betraf. (Der Glückliche! Er kannte das Salzburger Osterpublikum nicht!) Daß die erwarteten Potentaten, die Kaiser Ludwig und Wilhelm, zur Eröffnung nicht erschienen, sondern erst später, am 6. bzw. am 13. August eintrafen, mochten die Freunde verschmerzen. Aber es gab noch andere Dissonanzen. — Nietzsches kritische Auseinandersetzung mit dem ganzen fragwürdigen Phänomen in der Schrift „Richard Wagner in Bayreuth“, die er dem Freund nur zögernd schickte, las dieser so, als handle sie überhaupt nicht von ihm, sondern schrieb an den Autor: „Lieber Freund, Ihr Buch ist ungeheuer!“ Wagner erwies sich damit als ein guter „Nehmer“ — oder er wollte Nietzsche um keinen Preis verlieren ...
Doch die endgültige Entscheidung fiel auf einer ganz anderen Ebene. Nietzsche, der „Mittelmeersüchtige“, hatte durch Vermittlung und Empfehlung des Musikers Peter Gast, einem seiner treuesten Freunde (der mit seinem bürgerlichen Namen Heinrich Köselitz hieß und erst 1918 gestorben ist), Bizets „Carmen“ kennengelernt — und hier all das realisiert gefunden, was er von einem vollkommenen Kunstwerk, nach seinem damaligen Geschmack, erwartete. Nietzsche hat „Carmen“ mindestens 20 Mal gehört, und hat, was er — gewissermaßen als Fazit seiner Carmen-Erlebnisse und seines gewandelten Musikgeschmacks zu sagen hatte, in dem „Turiner Brief vom Mai 1888“ mit dem Titel „Der Fall Wagner — Ein Musikantenproblem“ niedergeschrieben. — Es ist die schönste, treffendste und eleganteste Würdigung, die Bizets Musik und das Textbuch nach Merimees berühmter Novelle je erfahren haben, und wer eines der brillantesten Stücke deutscher Prosa kennenlernen will, sei hiermit animiert, diese Abhandlung (am leichtesten zugänglich in der kleinen oder großen Nietzsche-Werkausgabe des Carl-Hanser-Verlages, München) nachzulesen.
Aber kaufen und lesen — die erste Auflage war bald vergriffen — sollte jeder Musik- und Kulturinteressierte das Buch Fischer-Dieskaus. Dort findet er auch die Schilderung des tragisch-fatalen Endes dieser „Sternenfreundschaft“, die nur wenige Jahre vor Wagners Tod erlosch. Denn in diesem Buch wird eines der aufregendsten Kapitel deutscher (und europäischer) Geistesgeschichte im 19. Jahrhundert wieder lebendig, und man stellt mit Staunen fest, wie sehr man sich immer wieder, bei der Lektüre, pro und contra engagiert. Die Tatsachen sind in ihrer ganzen Dramatik dargestellt, die Dokumente gut ausgewählt. Denn Fischer-Dieskau ist nicht nur ein fesselnder, auf weite Strecken glänzender Erzähler, sonder er hat die gewaltige Materie auch genau studiert und die wichtigsten Zitate sehr effektvoll gegeneinandergestellt Auf 11 Seiten, am Ende des Buches, findet man die wichtigsten Daten aller in diesen Konflikt verwickelten oder in Sachen Wagner und Nietzsche relevanten Personen. Auf weiteren zweieinhalb Druckseiten hat Fischer-
Dieskau die von ihm benützte Literatur vermerkt.
Wir müssen das alles so pedantisch und nachdrücklich hervorheben, weil Fisdier-Dieskaus Buch von der deutschen und der österreichischen Presse sehr schlecht behandelt worden ist. 26 Kritiken liegen vor uns, und selten war eine Lektüre so deprimierend wie diese Ansammlung von Dokumenten hämischen Neides, Besserwisserei, routinierter Bosheit und Inkompetenz. Was da unterschwellig alles mitgespielt haben mag? Das Vorurteil, daß ein Sänger zu singen und im übrigen dumm zu sein habe? Aber bei seinen Liederabenden wurde doch immer wieder auch die Intelligenz Fischer-Dieskaus hervorgehoben. Oder hatten manche Feuil-letonisten und Kritiker das Gefühl, das ihnen da jemand ins Handwerk pfuschte? Aber woher nehmen sie den Mut, einem der sich — ich schätze: mindestens zwei Jahre lang mit der Abfassung dieses Buchs nach vielleicht jahrzehntelangem Studium der Schriften Wagners und Nietzsches beschäftigt hat, auf diese Weise zu verfahren?
Bereits in einigen Titeln kündigt sich die feindselige Gesinnung an: „Plüschernes aus der Musik und Philosophie“, „Faustischer Duft“, „Die Autorenunredlichkeit des Liederinterpreten“ u. a. Mit dem letzten Titel ist der in der Rezension breit ausgeführte Vorwurf angedeutet, der F.-D. habe „abgeschrieben“ und zwei seiner wichtigsten Quellen, nicht genannt. Aber die Namen der beiden reklamierten Autoren stehen zu Beginn desBuches, gleich auf Seite 5 und werden gewissermaßen mit einer speziellen Danksagung bedacht (Ivo Frenzel, Autor einer Nietzsche-Bildbiographie, und der Amerikaner Robert W. Gutmann, Wagner-Biograph).
Da kann man also lesen: F.-D. habe „eine Privatsache zur öffentlichen Angelegenheit hochgejubelt“, er schreibe „auf Oberlehrerniveau“, es handle sich um „Bildungsphiliste-rei voll gespreizter Gelehrsamkeit in einem zuweilen übertakelten Stil“; ein „moralisierender Predigerton“ wird ihm ebenso vorgeworfen wie „schiefe Optik“, er schreibe „flüssig berichtend und schwammig reflektierend“ (bitte: entweder das eine oder das andere!), dann weht es scharf von links: „Hier jedoch mit der Sonde eines historisch-materialistischen Denkansatzes vorzugehen, fehlt es dem Buch völlig.“ (So wie dem Kritiker an Kenntnis der deutschen Syntax.) Und dann als Clou die absurde Unterstellung: „Er tritt damit in Begabung und Talent, in Geschäft und Unverfrorenheit in die Fußstapfen seines Meisters Karajan“ (der ja, wie man weiß, auch Bücher am laufenden Band produziert... Und so weiter und so fort und immer mieser. Ein Glanzstück kalkulierter Verdächtigung und Diffamierung ist die Behauptung eines Rezensenten, Fischer-Dieskaus Buch sei nur deshalb in der D.V.A. Stuttgart, dem „Verlag wissenschaftlicher Feuergeister“ erschienen, weil selbiger mit der „Deutschen Grammophon“ schwesterlich verbunden“ sei. — Das könnte von Annina und Valzacchi stammen, die ja nicht nur im „Rosenkavalier“, sondern auch auf den Kulturseiten mancher Zeitungen ihr Unwesen treiben.
Etwas sei noch festgehalten: fast in allen negativen Kritiken (es sind die positiven übrigens in der Uberzahl!) wird das ganze Buch als „überflüssig“ bezeichnet („Eh schon alles wissen!“). Aber das ist doch die reinste Euphorie! Man mache einmal einen Test unter „Gebildeten“, was sie konkret und genau über Wagner und Nietzsche wissen! Bereits unter den 30 bis 40jährigen stößt man, was Philosophie und Kulturgeschichte betrifft, auf eine geradezu abgründige Unbildung. Aber es würde ja auch ein Buch rechtfertigen, an Vergessenes zu erinnern...
Doch nun ist der Autor dieses Artikels seinen Lesern die Legitimation schuldig, in dieser Sache ein wenig mitzureden. — Es ist ihm nämlich, viel zu früh, im Alter von 16 Jahren, Schopenhauers „Welt als Wille und
Vorstellung“ in die Hand gefallen und bald darnach ein blaues Kröner-Bändchen der “Nietzsche-Ausgabe. Zwar verstand er nur einen Bruchteil, sagen wir: ein Zehntel dessen, was er damals las. Aber es blieb eine lebenslange Faszination. So lag es nahe, sich zum Thema des Philoso-phicums an der Universität Wien beim „alten Reininger“, dem meist als „Neukantianer“ bezeichneten Philosophen Rudolf Reininger, als spezielles Prüfungsgebiet „Schopenhauer und Nietzsche, mit Ausblick auf Bergson“ zu wählen...
Und was Wagner betrifft? Zu seinen Schriften und Korrespondenzen hätte ich, bei Wotan, freiwillig kein zweites Mal gegriffen, nachdem einmal, vor Jahren, das Wichtigste pflichtgemäß durchgeblättert worden war. Nun aber mußte ich. Denn es wurden mir zu Beginn des Jahres 1950 neun angeblich unbekannte, sehr ausführliche Wagner-Briefe im Original zur Veröffentlichung und Kommentierung anvertraut. Aber waren sie wirklich noch nicht publiziert? Es blieb mir nichts übrig, als die gesamte mir erreichbare Wagner-Literatur (eine kleine Bibliothek) nach Hinweisen auf diese neuaufgefundenen Briefe zu durchforschen und sämtliche veröffentlichte Wagner-Briefe nachzulesen. Nach etwa drei Monaten konnte ich mir und dem Besitzer der Briefe versichern, daß sie noch nie und nirgends publiziert und kommentiert waren, daß aber Max Morold ihren Verlust beklagt. — So wurde ich denn, nachdem ich in den folgenden Jahren mindestens ein Dutzend Wagner-Biographien gelesen habe, ein wenig zum Wagner-Kenner, und die neun Briefe wurden (auszugsweise) in der FURCHE, im FORUM, in der österreichischen Musikzeitschrift und vollständig in zwei Folgen der Monatsschrift „Das Musikleben“, 1950, Heft 5 und 6 (Mai und Juni) veröffentlicht — und Dr. Wolfgang Wagner, dessen Einwilligung einzuholen ich versäumt hatte, gab nachträglich seinen Segen zu der Publikation.
Die folgenden Schlußzeilen stammen von Deutschlands bekanntestem Kritiker, einem der wenigen, der auch europäisches Ansehen genießt, Autor von fünf in mehrere Sprachenübersetzten Büchern, zuletzt der großen Schönberg-Biographie, Prof. em. für Musikgeschichte an der Technischen Universität Berlin, Hans Heinz Stucken-schmidt:
„Ich kenne und bewundere Dietrich-Fischer-Dieskau seit gut anderthalb Jahrzehnten auch als Mensch. Er ist von erstaunlicher Bildung, erfüllt von dem Wunsch, immer neue Gebiete des Wissens und der eigenen Denkerfahrung zu erobern. Er besitzt eine Bibliothek, um die ihn jeder Germanist und Musikolog beneiden kann. In vielen Gesprächen, die ich mit ihm führte, wurden musikalische Dinge oft nur am Rande erwähnt. Es ging meist um Literatur, Theater, Geschichte. Und fast immer fand ich bei Fischer-Dieskau präzise Kenntnisse, die oft ins Fachmännische vordrangen. — DajS Fischer-Dieskau vorzüglich Klavier' spielt und im Freundeskreis musikhistorische Vorlesungen hält, die er spielend und singend illustriert (zu denen er mich nie einzuladen wagte!), ist ebenso bekannt, wie seine neuerliche Beschäftigung mit der Dirigierkunst, die auszuüben sein Knaben- und Jugendtraum gewesen ist.“
Nun können wir drauf gespannt sein, wie die lieben Kollegen, vielleicht schon im Jahr seines 50. Geburtstages, mit dem Dirigenten Fischer-Dieskau umspringen werden. So ungefähr kann man sich's vorstellen.