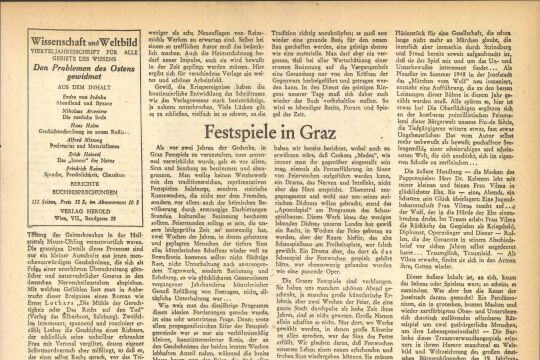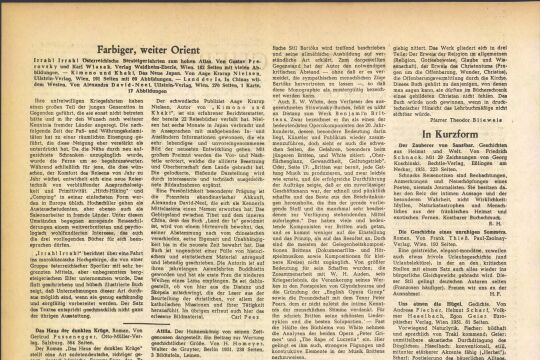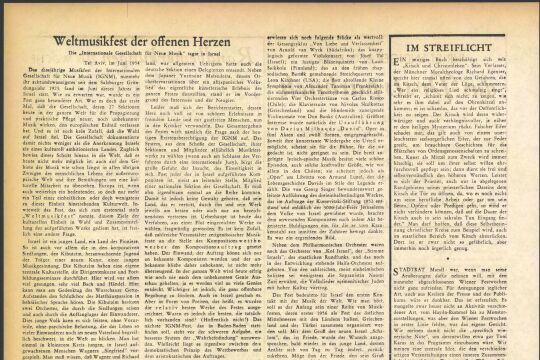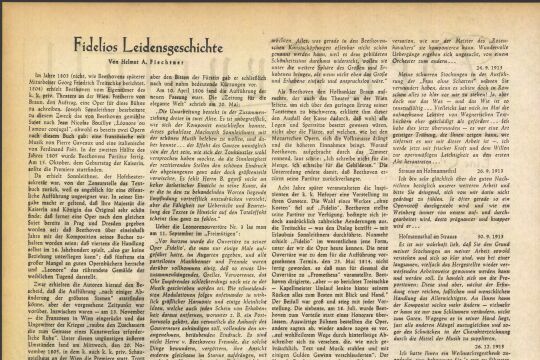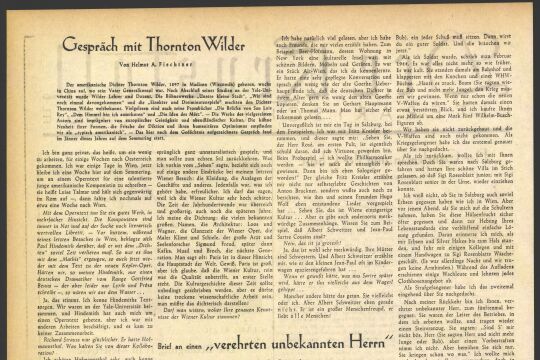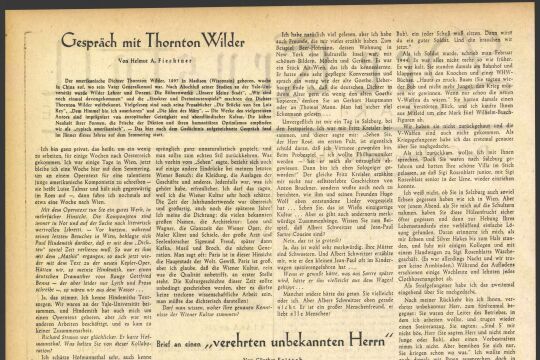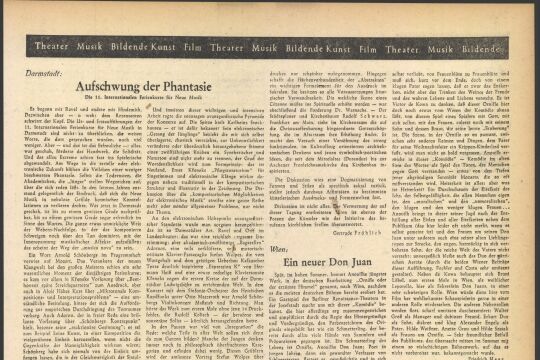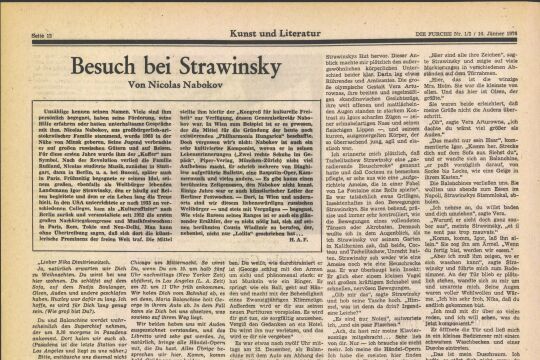Welchem Ihrer frühen Zeitgenossen verdanken Sie am meisten? Debussy? Glauben Sie, daß Debussys Stil durch den Kontakt mit Ihrer Musik beeinflußt worden ist?
In meinen frühesten Jahren beeinträchtigten mich Einflüsse, die eine Entwicklung meiner eigenen kompositorischen Technik hemmten. Ich verweise auf den Akademismus des St. Petersburger Konservatoriums, von dem ich mich jedoch glücklicherweise bald frei machen konnte. Aber die Musiker meiner Generation und ich selbst verdanken Debussy am meisten. Ich glaube nicht, daß sich Debussys Kunst durch unsere Beziehung geändert hat. Im Vergleich zu seinen freundlichen und lobenden Briefen an mich (er liebte „Petruschka“ sehr) erscheint es mir eigentlich rätselhaft, daß aus einigen Briefen, die Debussy in derselben Zeit an andere Musikfreunde geschrieben hat, eine völlig andere Einstellung zu meiner Musik -spricht. War es Un-aufrichtigkait, oder war er über seine Unfähigkeit verärgert, die Musik des „Sacre“ zu verstehen, der die junge Generation enthusiastischen Beifall zollte? Nach mehr als vierzig Jahren läßt sich das jetzt schwer beurteilen.
Was können Sie von Manuel de Falla erzählen?
Eines Tages im Jähre 1910, bei Cipa Godebskd, wurde mir ein Mann vorgestellt, der noch kleiner war als ich selbst und so bescheiden und zurückhaltend wie eine Auster. Ich hielt ihn, diesen Manuel de Falla, für einen Hommo serieux; und in der
Tat, nie bin ich einer kompromißloseren religiösen Natur begegnet als ihm — und nie einem Menschen, der weniger für Äußerungen des Humors übrig hatte. Ich habe niemand gekannt, der so scheu gewesen wäre wie er. Im Verlauf eines Empfanges zu seinen Ehren nach einer Aufführung von El Re-table de Maese Pedro im Hause der Princesse de Polignac (dieser sonderbaren Amerikanerin, die wie Dante aussah und die Ambition hegte, daß ihre Büste im Louvre neben die von Richelieu zu stehen komme) wurde man plötzlich gewahr, daß Falla selbst sich unsichtbar gemacht hatte; man fand ihn schließlich allein im verdunkelten Theaterraum mit einer von Maese Pedros Puppen in der Hand. Ich habe mich immer gewundert, daß ein so schüchterner Mann wie Falla überhaupt dazu zu bringen war, auf der Bühne zu erscheinen. Er hat indessen dirigiert und auch Cembalo gespielt — in seinem Con-certo, einem Stück, das ich bewundere und auch schon selbst dirigiert habe. Während einer Aufführung eben dieses Concer-tos in London in den dreißiger Jahren habe ich de Falla zum letztenmal gesehen.
Wurde Ihre Meinung über Schönberg und seine historische Stellung durch die jüngsten Veröffentlichungen seiner unvollendeten Werke beeinflußt?
Schönbergs Reichweite wird durch sie beträchtlich erweitert, aber ich glaube, seine Stellung bleibt dieselbe. — Schönbergs Gesamtwerk hat zu viele schwache Seiten, als daß wir es als Ganzes erfassen könnten. So sind zum Beispiel fast alle seine Texte erschreckend schlecht, manche davon in solchem Maße, daß man entmutigt wird, die Musik aufzuführen. Auch seine Orchestrationen von Bach, Händel und Brahms unterscheiden sich von typisch kommerzieller Orchestration nur durch die Überlegenheit des handwerklichen Könnens; Schönbergs Absichten sind nicht besser. In der Tat zeigt seine Händel-Bearbeitung deutlich, daß er nicht in der Lage war, Musik von „begrenztem harmonischem Bereich“ zu würdigen, und man hat mir erzählt, daß er die englischen Virgiinalisten, ja überhaupt jede Musik ohne „harmonische Entwicklung“ für primitiv hielt. Sein Expressionismus ist mehr als naiv, beispielsweise in den Anmerkungen für Beleuchtungseffekte in der Partitur der „Glücklichen Hand“. Seine späten tonalen Werke sind so langweilig wie die von Reger, denen sie ähnlich sind, oder die von Cesar Franck. Das viertönige Motiv in der Ode an Napoleon könnte von Cesar Franck sein. Seine Unterscheidung zwischen „inspirierter Melodie“ und ausschließlicher „Technik“ ist (Gegenüberstellung von „Herz“ und „Verstand“) gekünstelt, und das Beispiel, das er für die erste Kategorie angibt — das Unisono-Adagio im vierten Streichquartett —, macht mich schaudern.
Wir — und damit meine ich die Generation, die heute sagt „Webern und ich“ — sollten uns nur der vollkommenen Werke erinnern: fünf Stücke für Orchester (sie ausgenommen, könnte ich auf die ersten neunzehn Opuszahlen verzichten), Herzgewächse, Pierrot, Serenade und Orchestervariationen. Dank dieser Werke zählt Schönberg zu den großen Komponisten. Noch lange Zeit werden sich die Musiker an ihnen orientieren. Sie bilden zusammen mit einigen wenigen Werken nicht allzu vieler Komponisten die wahre Tradition.
In welcher Achtung steht bei Ihnen heute die Musik von
Berg? .
Wäre ich in der Lage, die Schranke des Stils zu durchdringen (nämlich Bergs überaus fremdartiges emotionelles Klima), ich glaube, er würde mir als der begabteste Formkonstrukteur aller Komponisten des Jahrhunderts erscheinen. Er übertrifft selbst sein eigenes, sehr offensichtliches Modell. Tatsächlich ist er der einzige, dem eine Großentwicklung von Formtypan gelang, ohne jegliche Andeutung „neuklassizistischer Heuchelei“. Sein Vermächtnis enthält jedoch wenig, um darauf aufzubauen. Aber er steht am Ende einer Entwicklung (auch sind Form und Stil keine so unabhängigen Gewächse, als daß wir vorgeben könnten, das eine zu verwenden und das andere wegzulegen), während die „Sphinx“ Webern ein ganzes Fundament zeitgenössischer Sensibilität und Stilistik hinterlassen hat.
Bergs Formen sind thematisch (in dieser Hinsicht wie auch in manch anderer steht er im Gegensatz zu Webern). Sie bilden die Essenz seines Werkes und sind für die Unmittelbarkeit der Formen verantwortlich. Wie komplex oder „mathematisch“ auch ihre Struktur sein mag, immer sind es „freie“ thematische Formen, geboren aus „Expression“ und „reinem Gefühl“. Um dies zu studieren, sind die „Drei Stücke für Orchester“ das vollkommene Werk. Ich halte sie zusammen mit dem „Wozzeck“ für die wesentlichste Komposition, um seine Musik überhaupt kennenzulernen. In diesen Stücken zeugt Bergs Persönlichkeit von Reife, und sie scheinen mir ein freier und reicherer Ausdruck seines Talents zu sein als seine seriellen Zwölftonkompositionen.
Eine Photographie mit Berg und Webern hängt bei mir an der Wand. Sie stammt ungefähr aus der Entstehungszeit der „Drei Orchesterstücke“. Berg ist groß, vollkommen gelöst, fast zu schön; sein Blick ist nach außen gerichtet. Webern dagegen ist klein, starr, kurzsichtig zum Boden blickend. Berg offenbart sich selbst durch seine wallende Künstlerkrawatte; Webern trägt schmutzige Bauernschuhe — was mir etwas sehr Tiefgründiges enthüllt. Schaue ich auf die Photographie, so werde ich sofort daran erinnert, daß beide Menschen nur wenige Jahre nach dieser Aufnahme vorzeitig eines tragischen Todes sterben mußten, nach Jahren der Armut, musikalischer Vernachlässigung und schließlich der musikalischen Verbannung im eigenen Land. Ich sehe Webern mit ruhigem Blick zu den Bergen auf dem Friedhof von Mittersill stehen, den er, laut seiner Tochter, in den letzten Monaten häufig besuchte und auf dem er auch später begraben wurde; und ich sehe Berg, der in den letzten Monaten ahnte, daß seine Krankheit tödlich sein könnte. Ich vergleiche das Schicksal dieser Menschen, die nicht auf einen Anspruch der Welt achteten und die eine Musik schufen, durch die unser halbes Jahrhundert in Erinnerung bleiben wird, im Vergleich zu den „Karrieren“ von Dirigenten, Pianisten und Geigern, alles nichtige Auswüchse! Dann richtet diese Photographie von zwei großen Musikern, von zwei echten Geistern, beides herrliche Menschen, mein auf dem tiefsten Punkt stehendes Gerechtigkeitsgefühl wieder auf.
Akzeptieren Sie jetzt eigentlich eine der Opern von Richard Strauss?
Ich würde gerne alle Strauss-Opern einem, gleichgültig, welchem, Purgatorium überlassen, das triumphierende Banalität bestraft. Ihre musikalische Substanz ist billig und armselig. Sie können einen Musiker heute nicht mehr interessieren. Und die jetzt so hochgehaltene „Ariadne“? Ich kann die Quartsext-
Akkorde von Strauss nicht ertragen: Die „Ariadne“ erweckt in mir den Wunsch zu kreischen.
Strauss selbst? Ich hatte bei Diaghilews Inszenierung der „Josephslegende“ Gelegenheit, Strauss aus der Nähe zu beobachten, näher als zu irgendeiner anderen Zeit. Er dirigierte die Premiere seines Werkes und hielt sich während der Einstudies-
rung einige Zeit in Paris auf. Er wollte nie mit mir Deutsch sprechen, obwohl ich besser Deutsch sprach als er Französisch. Er war sehr groß, kahl, energisch, Abbild des „bourgeois alle-mand“. Ich beobachtete ihn bei den Proben und bewunderte die Art, wie er dirigierte. Jedoch war sein Verhalten dem Orchester gegenüber weniger bewundernswert, aber jede seiner Korrekturen war exakt. Seine Ohren und seine Musikalität waren unbestechlich. Seine Musik erinnerte mich zu dieser Zeit an Böcklin und Stuck und die „deutschen grünen Greuel“. Ich bin froh, daß die jungen Musiker von heute dazu gekommen sind, das lyrische Talent des verachteten Komponisten Strauss in seinen Liedern zu würdigen und herauszufinden, wer in unserer Musik bedeutender ist als er: nämlich Gustav Mahler.
Meine geringe Achtung für die Opern von Strauss wird etwas ausgeglichen durch meine Bewunderung für Hofmannsthal. Ich kannte diesen vortrefflichen Dichter und Librettisten gut, sah ihn oft in Paris und, ich glaube, zum letztenmal bei der Berliner Premiere meines „Oedipus Rex“ (zu der auch Albert Einstein kam, um mich zu begrüßen). Hofmannsthal war ein Mensch von ungeheurer Kultur und ganz persönlichem, elegantem Charme. Ich habe ihn unlängst gelesen, bevor ich nach Hosios Lukas gereist bin: seine Beschreibung des griechischen Klosters, und ich war erfreut, daß er mir immer noch gut gefiel.
Welches ist Ihre Meinung über die Kirchenmusik?
Die Kirche wußte, was schon dem Psalmisten bekannt war: die Musik lobpreist Gott. Musik ist ebenso fähig oder sogar fähiger, „Ihn“ zu loben, als die Kitchenbauten jnjt ihrem eanzen. Schmuck. Sie ist das größte Ornament der Kirche. Glory, Glory, Glory; die Musik der Motette von Orlandus Lassus preist Gott, und dieses besondere „Gloria“ existiert in der weltlichen Musik njeht. Und nicht nur das Gloria, obgleich ich daran zuerst denken muß, weil das Gloria im Laudate, die Freude der Doxologie, alles andere als erloschen ist — auch Gebet, Buße und vieles andere können nicht verweltlicht werden. Das Wesen verschwindet mit der Form. Ich vergleiche nicht den „emotionellen Umfang“ oder die „Varietät“ zwischen geistlicher und weltlicher Musik. Im 19. und 20. Jahrhundert ist die Musik — die ganz weltlichen Charakter hat — „ausdrucksvoll“ und „emotionell“, jenseits von allen Kompositionen früherer Jahrhunderte: zum Beispiel die „Angst“ in Lulu (gory, gory gory) oder die Spannung, die Vereinigung des epitasischen Augenblicks in Schönbergs Musik. Ich sage, daß wir einfach ohne die Kirche, „unseren eigenen Plänen überlassen“, um viele musikalische Formen ärmer sind.
Wenn ich das 19. Jahrhundert „weltlich“ nenne, so meine ich damit, daß man unterscheiden muß zwischen religiös-geistlicher Musik und weltlich-geistlicher Musik. Letztere ist im allgemeinen durch die Humanität, durch die Kunst, durch den Übermenschen, durch Güte und durch weiß Gott noch alles inspiriert. Religiöse Musik ohne Religion ist fast immer vulgär. Auch kann sie langweilig sein. Es gibt solche langweilige Kirchenkompositionen, niemals aber vulgäre Kirchenmusik (natürlich gibt es heute auch vulgäre Kirchenmusik, aber dann kommt sie in Wirklichkeit nicht von der Kirche, noch ist sie für die Kirche geschrieben).
Kam es für Sie in Betracht, Musik für Filme zu schreiben?
Ja, mehrmals. In zwei Fällen habe ich sogar angefangen zu komponieren, freilich keine ..Filmmusik“, die nur das Ohr kitzelt, als gefühlsmäßige Untermalung der Szenerie, sondern Musik für Filmgebrauch. Meine vier norwegischen Impressionen waren ursprünglich einem Film über die Invasion Norwegens zugedacht, und mein Scherzo ä la Russe wurde als Musik zu einem anderen Kriegsfilm, diesmal mit russischem Hintergrund, begonnen. Beide Partituren sind für den Konzertgebrauch unverändert geblieben, nur das Scherzo habe ich später einmal für die Paul-Whitemah-Kapelle neu instrumentiert. Ich konnte Musik für Filme nur als Gelegenheitsmusik auffassen, und die beiden Stücke sind auch nicht mehr als das. Es ist mir durchaus klar, daß diese Auffassung von der Filmindustrie nicht geteilt werden kann, aber mehr kann ich nun einmal nicht zugestehen, und ich darf mich wahrscheinlich nur glücklich schätzen, daß keiner der Vorschläge, die mir Hollywood machte, vertragsreif geworden ist.
Es macht mir übrigens Spaß, mit Filmleuten zu verhandeln; denn sie versuchen ihre wahren Absichten nur selten mit dem Gerede über Kunst zu verbergen. Sie wollen meinen Namen haben, nicht meine Kunst — man hat mir sogar 100.000 Dollar angeboten, falls ich bereit sei, einen Film mit Musik zu polstern, und als ich ablehnte, bedeutete man mir, ich könne das Geld auch dann haben, wenn ich nur den Namen gebe und die Arbeit einem anderen überlasse. Die schönste Hollywoodgeschichte betrifft aber nicht mich, sondern Schönberg. Der große Komponist, dem seine Werke fast nichts einbrachten, wurde aufgefordert, die Musik zu „Die gute Erde“ zu liefern, und zwar für ein Honorar, das ihm wie das Vermögen eines Krösus vorkommen mußte, aber verknüpft mit künstlerisch unmöglichen Bedingungen. Er verzichtete mit dem Ausspruch: „Ihr tötet mich, um mich vor dem Hungertod zu retten.“