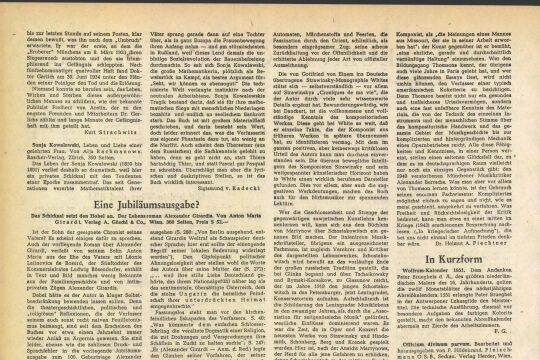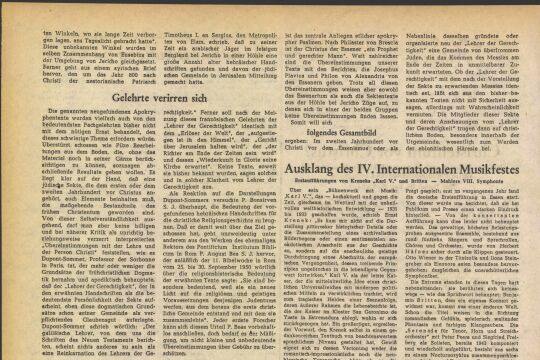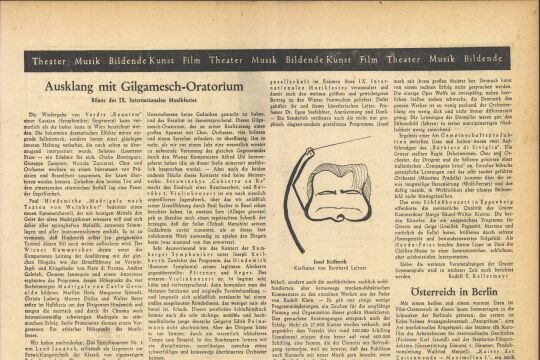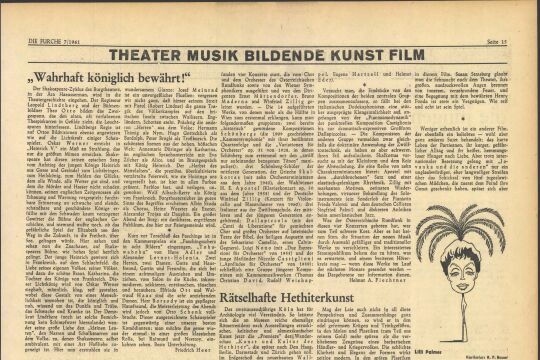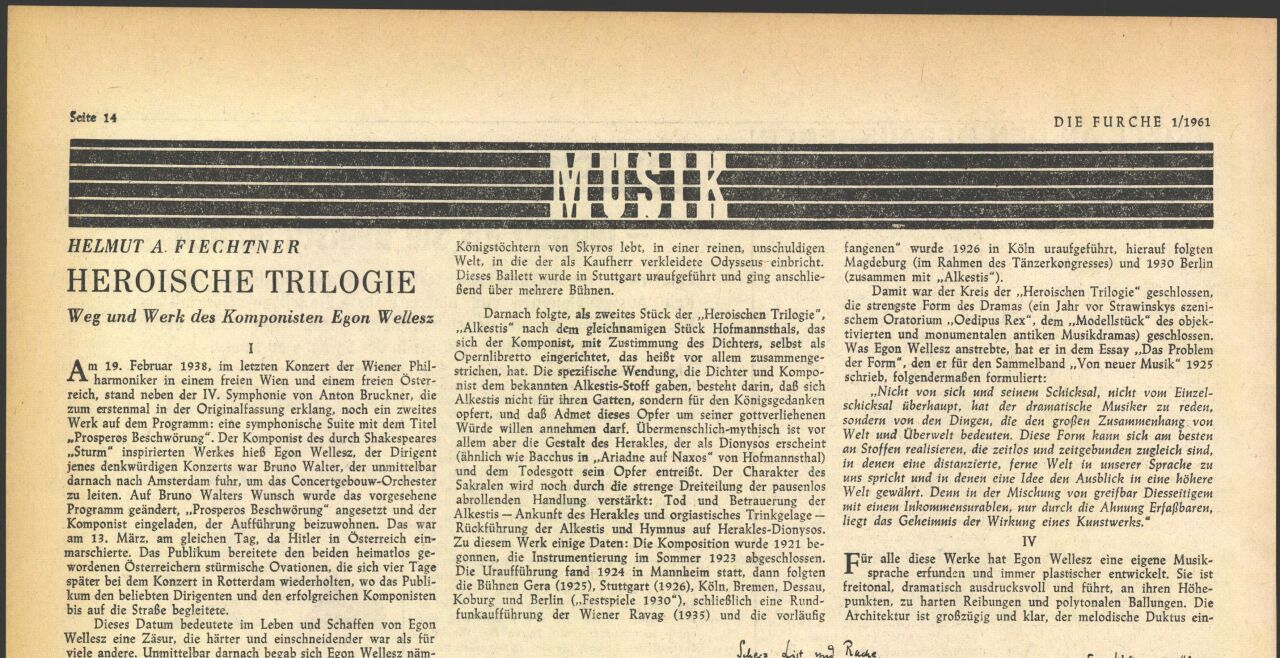
I
Am 19. Februar 1938, im letzten Konzert der Wiener Philharmoniker in einem freien Wien und einem freien Österreich, stand neben der IV. Symphonie von Anton Bruckner, die zum erstenmal in der Originalfassung erklang, noch ein zweites Werk auf dem Programm: eine symphonische Suite mit dem Titel „Prósperos Beschwörung“. Der Komponist des durch Shakespeares „Sturm" inspirierten Werkes hieß Egon Weliesz, der Dirigent jenes denkwürdigen Konzerts war Bruno Walter, der unmittelbar darnach nach Amsterdam fuhr, um das Concertgebouw-Orchester zu leiten. Auf Bruno Walters Wunsch wurde das vorgesehene Programm geändert, „Prósperos Beschwörung“ angesetzt und der Komponist eingeladen, der Aufführung beizuwohnen. Das war am 13. März, am gleichen Tag, da Hitler in Österreich einmarschierte. Das Publikum bereitete den beiden heimatlos gewordenen Österreichern stürmische Ovationen, die sich vier Tage später bei dem Konzert in Rotterdam wiederholten, wo das Publikum den beliebten Dirigenten und den erfolgreichen Komponisten bis auf die Straße begleitete.
Dieses Datum bedeutete im Leben und Schaffen von Egon Weliesz eine Zäsur, die härter und einschneidender war als für viele andere. Unmittelbar darnach begab sich Egon Weliesz nämlich nach Oxford, dessen Universität ihm bereits 1932 das Ehrendoktorat verliehen hatte. Die seltene und in der ganzen wissenschaftlichen Welt hochbegehrte Auszeichnung hatte Weliesz für Forschungen auf dem Gebiet der byzantinischen Musik und für sein kompositorisches Schaffen erhalten: „As a scolar of ancient music and a composer of modern music." — Diese Doppelbegabung, diese Zweigeleisigkeit ist für das gesamte Lebenswerk von Egon Weliesz charakteristisch. Sie wirkte sich zeitweise allerdings auch so aus, daß der Komponist Weliesz in den Schatten des Wissenschaftlers, des Byzantinisten von Weltruf, geriet, der einen neuen Kontinent der Musik entdeckt hatte. Anderseits ermöglichte die akademische Laufbahn, das Lehramt, welches Egon Weliesz seit 1913 als Privatdozent und seit 1930 als Professor ausübte, die materiell unabhängige Existenz des Komponisten.
II
Bei Guido Adler an der Wiener Universität hatte Weliesz Musikwissenschaft studiert. Ebenso stark wie sein hervorragender Lehrer, der — im Unterschied zu manchen anderen seines Faches — auch Kontakt mit der Musik seiner Zeit hielt, mögen die vielerlei Anregungen auf den jungen, sich bildenden Geist gewirkt haben, welche damals die Wiener Kultur ausstrahlte.
In jenem ersten Jahrzehnt nach der Jahrhundertwende, als Schönbergs erste Liederzyklen aufgeführt und das fis-moll- Quartett und die 1. Kammersymphonie die in die Musikgeschichte eingegangenen Skandale bei ihrer Uraufführung hervorriefen, war Egon Weliesz Schüler von Arnold Schönberg und mit dessen Adepten Anton von Webern und Alban Berg befreundet. In den Kriegsjahren wurde Weliesz von diesem Kreis getrennt, aber noch 1920 schrieb er ein Buch über seinen verehrten Lehrer. In seinen ersten Kompositionen (Kammermusikwerken, Klavierstücken und Liedern) stand Egon Weliesz gleichzeitig unter dem Einfluß des französischen Impressionismus. Das bezeugen vor allem die Klavierzyklen: Der Abend op. 4, Drei Skizzen op. 6, Drei Klavierstücke op. 9, Eklogen op. 11 und Epigramme op. 17. In dem Bestreben, aus dem Klavierklang neue Möglichkeiten zu schöpfen, begegneten einander Weliesz und Béla Bartók: Als er ein Kammerkonzert mit eigenen Kompositionen in der „Gruppe der acht“ in Budapest hatte, war Bartók von den Werken des jungen Wiener Komponisten so beeindruckt, daß er eine Drucklegung mehrerer dieser Werke bei seinem eigenen Verleger (Roszavölgyi) veranlaßte. — Es folgten „Lieder der Mädchen“ und „Gebet der Mädchen zur Maria“ nach Texten von R. M. Rilke und, in den Jahren 1912 und 1916, zwei Streichquartette, die bei Simrock gedruckt wurden.
Inzwischen war Schönberg den ihm bestimmten Weg weitergeschritten (die Berührung zwischen Weliesz und Schönberg lag vor dessen dodekaphonischer Zeit) — und in Weliesz war der Musikdramatiker erwacht, der nach ihm gemäßen Stoffen Ausschau hielt. Er fühlte, daß die Oper noch große, unausgeschöpfte Möglichkeiten enthielt, aber auch, daß sie damals von einem „romantischen Idiom“ bestimmt wurde, das für eine Erneuerung nicht geeignet war und auch selbst keine innere Wahrheit mehr besaß. Für Weliesz, den Wissenschaftler und den Künstler, war die Epoche der Wiener Barockoper etwas sehr Lebendiges, und er wollte den Versuch wagen, den seit Gluck und J. J. Fux abgerissenen Faden wieder aufzunehmen und weiterzuspinnen. Diese Erneuerung, so fühlte er, konnte nur vom Tanz her und dmch Anknüpfung an antike beziehungsweise kultische Gegenstände vorgenommen werden.
III
In jener Zeit machte Egon Weliesz eine für seine weitere Entwicklung folgenreiche Bekanntschaft, die Hugo von Hofmannsthals. Mit dem rund zehn Jahre Älteren besprach er künftig seine Pläne und wurde von diesem ermutigt. Auf gemeinsamen Spaziergängen in Alt-Aussee entstand der Plan zu dem Ballett „Achilles auf Skyros“, dessen Libretto Hofmannsthal dem jungen Komponisten zum Geschenk machte. (Mit Rücksicht auf Hofmannsthals damals bereits bestehende enge Verbindung mit Richard Strauss ist das Textbuch zunächst anonym erschienen, jetzt findet es sich in den Gesammelten Werken, Dramen IV.) Hier und in den folgenden Bühnenwerken, die sich zur „Heroischen Trilogie" zusammenschlossen, geht es um ein neues Bild der Antike, um ein neues Menschenbild. Man mag an Hölderlin und seinen heroischen Schicksalsbegriff denken oder an die „tragische Harmonie“ seiner Gestalten. Zwar wurzelt Hofmannsthals Griechenbild in den Forschungen Bachofens und denen der zeitgenössischen Tiefenpsychologie, aber es geht ihm immer auch — und vor allem — um ein Höheres: um das Wunder der Verwandlung, die Monumentalisierung des Menschlichen, um die Darstellung einer höheren Welt.
„Achilles auf Skyros“ zeigt das Hervortreten des Heldischen in dem jungen Achill, der, als Mädchen verkleidet, unter den
Königstöchtern von Skyros lebt, in einer reinen, unschuldigen Welt, in die der als Kaufherr verkleidete Odysseus - einbricht. Dieses Ballett wurde in Stuttgart uraufgeführt und ging anschließend über mehrere Bühnen.
Darnach folgte, als zweites Stück der „Heroischen Trilogie", „Alkestis" nach dem gleichnamigen Stück Hofmannsthals, das sich der Komponist, mit Zustimmung des Dichters, selbst als Opernlibretto eingerichtet, das heißt vor allem zusammengestrichen, hat. Die spezifische Wendung, die Dichter und Komponist dem bekannten Alkestis-Stoff gaben, besteht darin, daß sich Alkestis nicht für ihren Gatten, sondern für den Königsgedanken opfert, und daß Admet dieses Opfer um seiner gottverliehenen Würde willen annehmen darf. Übermenschlich-mythisch ist vor allem aber die Gestalt des Herakles, der als Dionysos erscheint (ähnlich wie Bacchus in „Ariadne auf Naxos" von Hofmannsthal) und dem Todesgott sein Opfer entreißt. Der Charakter des Sakralen wird noch durch die strenge Dreiteilung der pausenlos abrollenden Handlung verstärkt: Tod und Betrauerung der Alkestis — Ankunft des Herakles und orgiastisches Trinkgelage — Rückführung der Alkestis und Hymnus auf Herakles-Dionysos. Zu diesem Werk einige Daten: Die Komposition wurde 1921 begonnen, die Instrumentierung im Sommer 1923 abgeschlossen. Die Uraufführung fand 1924 in Mannheim statt, dann folgten die Bühnen Gera (1925), Stuttgart (1926), Köln, Bremen, Dessau, Koburg und Berlin („Festspiele 1930“), schließlich eine Rimd- funkaufführung der Wiener Ravag (1935) und die vorläufig letzte szenische Wiedergabe auf der Bühne des Akademietheaters durch Schüler der Wiener Staatsakademie für Musik.
Auch die Anregung zum dritten Stück seiner Trilogie dankt, der Komponist dem Dichter Hugö Vöh Hpfmahnsfhäl, der in den vdn ihm redigierten „Neuen Deürtchen ÖeitfägeiP einen aus dem Französischen übersetzten Text Eduard Stuckens (des Verfassers der „Weißen Götter“) veröffentlicht hatte. „Die Opferung des Gefangenen“ basiert auf einem originalen Maskenspiel der Quiche-Indianer. Dessen typisierende Maskentänze entsprachen sehr dem objektivierten musikdramatischen Stil, den man seit der großen Händel-Renaissance wiederentdeckt hatte und zu dem Egon Weliesz schon seit Jahren unterwegs war. Dieses Tanzdrama hat keinerlei „psychologische Handlung“ mehr, sondern ist ein einziges großes Zeremoniell, eine rituelle Opferhandlung. Die Hauptrolle, der gefangene Prinz, wird von einem Tänzer dargestellt. Ihm werden, in einzelnen Bildern, alle Zauber des Lebens noch einmal vorgeführt, aber er weiß, daß er sterben muß. Und als ihn die Krieger mit ihren Schildern getötet haben, sinken alle nieder und verehren in ihm einen neuen Stern. Auch hierzu einige Daten: das Tanzdrama „Die Opferung des Ge fangenen“ wurde 1926 in Köln uraufgeführt, hierauf folgten Magdeburg (im Rahmen des Tänzerkongresses) und 1930 Berlin (zusammen mit „Alkestis“).
Damit war der Kreis der „Heroischen Trilogie“ geschlossen, die strengste Form des Dramas (ein Jahr vor Strawinskys szenischem Oratorium „Oedipus Rex“, dem „Modellstück“ des objektivierten und monumentalen antiken Musikdramas) geschlossen. Was Egon Weliesz anstrebte, hat er in dem Essay „Das Problem der Form“, den er für den Sammelband „Von neuer Musik“ 1925 schrieb, folgendermaßen formuliert:
„Nicht von sich und seinem Schicksal, nicht vom Einzelschicksal überhaupt, hat der dramatische Musiker zu reden, sondern von den Dingen, die den großen Zusammenhang von Welt und Überwelt bedeuten. Diese Form kann sich am besten an Stoffen realisieren, die zeitlos und zeitgebunden zugleich sind, in denen eine distanzierte, ferne Welt in unserer Sprache zu uns spricht und in denen eine Idee den Ausblick in eine höhere Welt gewährt. Denn in der Mischung von greifbar Diesseitigem mit einem Inkommensurablen, nur durch die Ahnung Erfaßbaren, liegt das Geheimnis der Wirkung eines Kunstwerks.“
IV
TZJür alle diese Werke hat Egon Weliesz eine eigene Musik- spräche erfunden und immer plastischer entwickelt. Sie ist freitonal, dramatisch ausdrucksvoll und führt, an ihren Höhepunkten, zu harten Reibungen und polytonalen Ballungen. Die Architektur ist großzügig und klar, der melodische Duktus ein-
prägsam und von ausgeprägter Eigenart. Seine Musik macht keine Anleihen und erinnert an keine andere Sprache vor oder nach ii ihm, (etwa die jüngerer ,Zeitgeno6sen)í iD«n¡Komponist- berichtet» 1 daß er, während er diese Werke schrieb, stets archaische Skulpturen vor Augen hatte. Und von ihrer stilistischen Geschlossenheit, Strenge und Größe ist etwas in seine Musik übergegangen.
Wir haben das erste Bühnenwerk von Egon Weliesz, „Das Wunder der Diana" (1914) und „Die Prinzessin Girnara“ (Weltspiel und Legende, 1918) nach Jakob Wassermann, noch nicht erwähnt. Ferner gibt es ein Kammerwerk mit dem Titel „Persisches Ballett", das 1924 beim Musikfest in Donaueschingen uraufgeführt wurde und dann an 16 Bühnen gegeben wurde. Gewissermaßen „zur Entspannung“ zwischen den heroisch-tragischen Bühnenwerken schrieb Weliesz „Scherz, List und Rache“, die Goethesche Commedia dell’arte auf einen Akt zusammenziehend. Und wir haben „Die Bakchantinnen“ auf einen eigenen Text (nach Eurípides) noch nicht genannt, die geeignet wären, die „Heroische Trilogie“ zu einer Tetralogie zu ergänzen. Sie wurden 1931 an der Wiener Staatsoper unter Clemens Krauß uraufgeführt, aber die Zeiten waren schwieriger geworden, das bedeutende Werk wurde nur insgesamt dreimal im Lauf der Spielzeit 1931 32 gegeben — dann verließ Clemens Krauß Wien… (Diese Oper wurde vor kurzem anläßlich des 75. Geburtstages von Egon Weliesz in einer hervorragenden Einstudierung vom Österreichischen Rundfunk gesendet und an dieser Stelle ausführlich besprochen.)
V
A ber Weliesz ist nicht nur Musikdramatiker. Nach den „Bak-
chantinnen" schrieb er die Kantate „Mitte des Lebens“, eine Messe in f-moll, ein Klavierkonzert, die eingangs erwähnte symphonische Suite „Prósperos Beschwörung“ und die Sonette der Elisabeth Barret-Browning für Sopran und Streichquartett. Nach seiner Emigration trat eine längere Schaffenspause ein. — Dann regte sich der Symphoniker, und seit 1945 sind fünf Symphonien entstanden, ferner die Streichquartette 6, 7 und 8, ein Oktett, die heitere Oper „Incógnita", „The leaden and the golden echo“ nach G. M. Hopkins, schließlich die Kompositionen op. 81—83: ein Quintett, die „Lieder aus Wien“ und eine Klaviersuite. Der Analyse und Würdigung dieser Werke müßte eine eigene Abhandlung gewidmet sein. — Wir wollten aber mit dieser kurzen Studie vor allem auf das Bühnenwerk von Egon Weliesz hinweisen.
Vor kurzem haben wir in Wien „Alkestis“ und, anläßlich des 75. Geburtstages des Komponisten, „Die Bakchantinnen" gehört und bewundert. Diese Aufführungen dürften nicht folgenlos bleiben. Wenn wir gewissermaßen ein Minimalprogramm aufstellen, so müßten die Folgen sein, daß sich die für die Programmierung der Staatsoper und der Salzburger Festspiele Verantwortlichen die Partituren sämtlicher Bühnenwerke von Egon Weliesz ansehen, die einzelnen Stücke auf ihre augenblickliche Besetzbarkeit hin prüfen und sowohl für Salzburg als auch für Wien ein abendfüllendes Programm zusammenstellen. Denn es handelt sich hier um Werke gleichermaßen würdig einer repräsentativen Aufführung in der Wiener Staasoper wie geeignet für die große Bühne im neuen Salzburger Festspielhaus. Und es sind Werke eines Österreichers, dessen eigenes Leben eine „heroische Trilogie“ ist: von den glänzenden Erfolgen seiner Jugend über die Zeit des Fastvergessenseins bis zur letzten Phase eines späten Ruhmes (man spielte während der letzten Wochen Werke von Weliesz in Hamburg, Köln und München, in Oxford und den USA), eines Ruhmes und einer Anerkennung, die wir dem Komponisten Egon Weliesz von Herzen gönnen — und die er verdient hat.