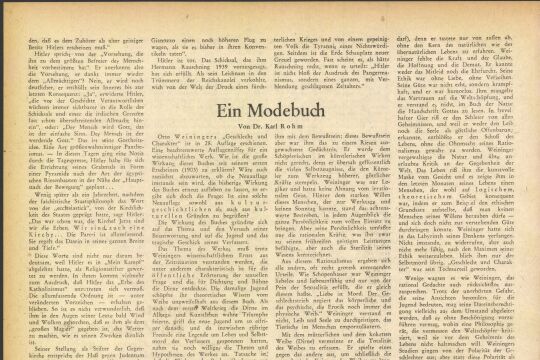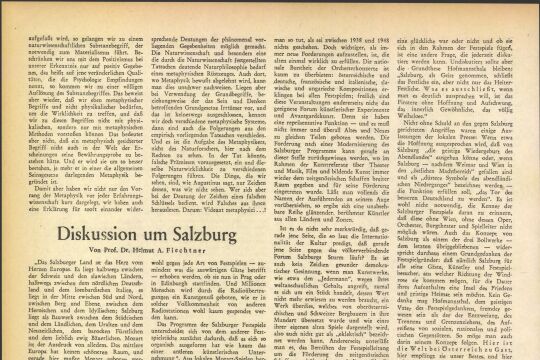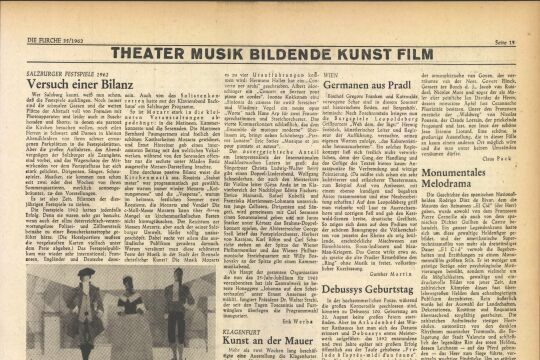Seit dem vergangenen Jahr werden die Salzburger Festspiele mit der Ansprache eines Dichters, Philosophen oder Kulturhistorikers von internationalem Rang eröffnet. Nach Salvador de Madariaga hatte man heuer Gabriel Marcel um ein „Geleitwort“ gebeten. Seine sehr bedeutende, sehr persönliche Ansprache kulminierte in dem Gedankengang: die Musik sei in gewisser Hinsicht die Heimat der Seele, und es sei die höchste Mission der Salzburger Festspiele, diese dem Auge und dem Ohr zugänglich zu machen. Ist doch diese „Heimat“ nur ein tröstlicher Widerschein jener anderen, jenseitigen Heimat, „nach der unsere Augen mit um so innigerer Sehnsucht blicken, als eine universelle Verschwörung unsere irdische Heimat zu entseelen bemüht ist“.
Diese Worte des angesehenen französischen Philosophen, Dramatikers und Kritikers, die auf Gedankengängen Hofmannsthals basieren (zu dem sich Gabriel Marcel in seiner Rede wiederholt bekannte), sind eine Meditation wert und erweisen sich als höchst aktuell.
Inbegriff der Kunst, die auch für den Menschen von heute zur „Heimat der Seele“ werden kann, ist für Marcel — und war für die Gründer der Salzburger Festspiele
— Mozart. Er hat auch künftig im Mittelpunkt des Programms zu stehen. In diesem Jahr waren es drei seiner Opern („Cosi“, „Entführung“ und „Die Gärtnerin aus Liebe“) sowie etwa zwei Dutzend seiner Orchesterwerke. — Nun hat aber Salzburg außer den — relativ
— kleinen Bühnen noch zwei große: die Felsenreitschule und das Neue Festspielhaus, das heuer zum sechstenmal bespielt wurde und sich akustisch und optisch glänzend bewährte. Für diese beiden Bühnen braucht man andere Stücke. Sie verlangen die „große Show“. Und hier beginnt das Dilemma der Salzburger Festspiele.
Diese große Show (ob es sich nun um den „Macbeth“ in der Felsenreitschule oder „Boris Godunow“ im neuen Haus handelt), deren Vorbild weniger das vielzitierte Barocktheater als die Cinemascope-Breitwand ist, kommt offensichtlich dem Bedürfnis einer breiten Publikumsschicht entgegen. Das beweist die Nachfrage nach Karten gerade für diese Veranstaltungen und die Überpreise, die bereitwillig dafür gezahlt werden.
Doch wer ist dieses Salzburger Publikum? Ihm galt Hofmannsthals sorgenvolle Betrachtung im Jahr seines Todes (1929) im letzten Artikel, den er über die Festspiele schrieb: „Es geht zunächst durch dieses Publikum die eine große Spaltung, daß es zur Hälfte großstädtisch, zur anderen nicht geringeren Hälfte ungroßstädtisch ist. Beide Gruppen bestehen; aus beiden zusammen, in unzähligen Variationen, besteht unser Publikum. In ihren unzähligen Individuen sind alle Spielarten der Aufnahmebereitschaft, des Theatersinns, der Schaulust, der Musikalität verteilt... Von so vielen Seiten her, aus allen Richtungen der Windrose, auch geistig, kommen sie, denen in Salzburg eine vorübergehende Heimat geschaffen werden soll. Sie durch das Dargebotene zur Einheit, zu einem Publikum, zusammenzubinden, scheint fast unmöglich...“ Und ist heute noch schwerer möglich als damals. Denn dieses Publikum ist noch differenter, noch viel gesichtsloser, noch schwieriger zu fassen als vor 40 Jahren. Der einzige gemeinsame Nenner ist vielleicht der durch Rundfunk und Schallplatte geweckte Anspruch auf den hohen technischen Standard. Ihm muß zweifellos Rechnung getragen werden, und man kann fast ohne jede Einschränkung sagen, daß dies in Salzburg geschieht. Doch wo geschieht dies heute nicht? Die technische Perfektion ist gewissermaßen global geworden. Daher gilt es, das Augenmerk mehr auf das Was zu richten.
Festliches Theater wollten die Begründer der Salzburger Festspiele, die „Bühne als Traumbild“ (wie der Titel einer Hofmanns-thalschen Abhandlung lautet), durch das den Menschen ein wenig Freude und Heiterkeit geschenkt werden soll. Doch wie sieht heute dieses Programm aus?
Nachdem man am Abend des ersten Tages den Zaren Boris in prunkvoller Gewandung und Umgebung beim Dröhnen der Kremlglocken, in wahnsinniger Angst und von Schuldbewußtsein gefoltert, sterben sah, konnte man sich am nächsten Tag in der Felsenreitschule an den Greueln des Atriden-hauses erfreuen, das blutüberströmte Antlitz des geblendeten Oedipus anschauen und den Verzweiflungsschreien Jokastes lauschen. Nicht weniger heiter ging es tags darauf bei Straussens „Elektra“ zu. Dann hinüber ins Landestheater, zum Europastudio, wo der Festspielgast drei lange Stunden transatlantischen Seelenkrämpfen beiwohnen kann, in deren kunstvoll-gründlicher Aufbereitung O'Neill ein Meister ohnegleichen ist. Nach einer kurzen Erholungspause bei Mozart, in der „Entführung“ und bei Straussens „Ariadne“ —-zurück in die kalte Felsenreitschule, um bei blutigem Fackelschein an der Ermordung König Duncans durch Macbeths Mannen teilzunehmen und auszuharren, bis die böse Lady im Wahn stirbt und Macbeth seinerseits von Macduff abgestochen wird.
Das sieht man auf den großen Bühnen, während „Faust“, erster und zweiter Teil, leider ins kleine Festspielhaus verbannt blieb und im nächsten Jahr, statt ins große neue Haus zu übersiedeln, vom Spielplan gestrichen werden soll. Schade, schade. Stattdessen fanden hier zehn Orchesterkonzerte statt, von denen einige zu den Höhepunkten dieses Festspielsommers gezählt werden können. Zweifellos bietet das neue Haus einen festlichen Rahmen und hat eine ausgezeichnete Akustik — aber gegenüber dem Schauspiel und der Oper müßten konzertante Veranstaltungen an diesem Ort zurücktreten...
Die Konzertprögramme waren bunt und nicht uninteressant — aber ohne jedes Konzept. Die Zehnzahl der Konzerte ruft uns wieder den schon vor zehn Jahren gemachten Vorschlag ins Gedächtnis, sämtliche Bruckner-Symphonien im Verlauf von fünf Wochen zyklisch aufzuführen (wobei die kürzeren durch ein Brandenburgisches Konzert von Bach ergänzt werden könnten) oder — was noch verdienstvoller wäre: die zehn Mahler-Symphonien aufs Festspielprogramm zu setzen...
Doch wir sind in den konzertanten Teil abgeschweift und wollen uns wieder der Oper, dem Theater und den großen Schauplätzen zuwenden. Ihr Spielplan bedarf einer gründlichen Aufhellung. Erfreulicherweise ist in dieser Richtung bereits für 1966 einiges in Aussicht gestellt:
Ins Neue Festspielhaus soll „Carmen“ einziehen, die sich, wie eine vielbeachtete Neuinszenierung an der Pariser Oper vor einigen Jahren sowie die große Carmen-Show in der Arena von Verona erwies, für eine Prunkausstattung bestens eignet. — Ein neues (und sehr altes) Genre wird uns mit der von Hofrat Professor Paumgartner entdeckten „Rappresentatione di Anima e di Corpo“ vorgestellt. Ihr Autor ist Emilio de Cavallieri, der etwa von 1550 bis 1602 in Rom lebte und eine wichtige Rolle in der Entwicklung des Musikdramas spielte, von dem Romain Rolland sogar meinte, Gluck und Wagner seien kaum über Cavallieris Ideen und szenische Phantasie hinausgelangt. Bei der Aufführung in der Felsenreitschule (in italienischer Sprache) wird der Versuch einer Rekonstruktion dieser bedeutenden und großartigen alten Form gemacht werden. Das aus 25 bis 30 Musikern bestehende Orchester wird unsichtbar sein, und neben sechs Solisten und acht Tänzern, welche die Engel darzustellen haben, soll ein Chor von etwa 50 Sängern mitwirken: eine Darbietung jedenfalls, die auf das Interesse der Kenner und Liebhaber in aller Welt wird rechnen können.
Das gleiche darf man wohl auch von der neuen Oper Hans Werner Henzes, „Die Bassaniden“, sagen, die als Auftragswerk für die Salzburger Festspiele geschaffen wurde. Der von Auden und Kallman geschriebene Text basiert auf den „Bakchen“ des Euripides. Abgesehen davon, daß dieses Werk zur so wünschenswerten „Aufhellung“ des Programms kaum beitragen wird, kann man eine bittere Reminiszenz kaum unterdrücken: Gibt es doch ein großartiges Opernwerk mit dem Titel „Die Bakchen“ von dem noch mit Hofmannsthal verbundenen, in Oxford lebenden österreichischen Komponisten Egon Wellesz, das, zwar schon 1930 geschaffen, seine Bewährungsprobe bei der vor einem Jahr stattgefundenen konzertanten
Aufführung im Rundfunk glänzend bestanden hat. Aber um das musikdramatische Werk dieses bedeutenden Österreichers kümmert sich niemand — wahrscheinlich, weil niemand von den Zuständigen es kennt oder sich die Mühe genommen hat, die Partituren der „Heroischen Trilogie“ von Wellesz anzusehen, bevor man einen so riskanten und kostspieligen Auftrag vergab...
Auf dem Gebiet des Schauspiels ist für 1966 Shakespeares „Sommernachtstraum“ angekündigt, und zwar mit der Musik von Mendelssohn. Sie ist genial und zauberhaft, aber völlig undramatisch. Ob das keine Enttäuschung geben wird, zumal wir die faszinierende, bühnenwirksame Musik von Orff zu Shakespeares Zaubermärchen im Ohr haben? „Der Schwierige“ von Hofmannsthal bedeutet eine erfreuliche und organische Bereicherung des Spielplans. Aber wo bleiben Nestroy und Raimund? Und weshalb nicht, im Sinne der vielberufenen Italia-nitä Salzburgs, eine Oper des Deutschitalieners Wolf-Ferrari oder der „Arlecchino“ von Busoni? Warum auch nicht des Salzburgers Gerhard Wimberger „Dame Kobold“ nach Calderön und Hofmannsthal?
Doch Salzburg lebt nicht vom Geist und vom Programm allein. Es braucht auch Attraktionen. Als die stärksten erwiesen sich alle von Karajan geleiteten Veranstaltungen. Sie waren nicht nur ausverkauft, sondern es wurde mit den Karten auch ein schwungvoller Schwarzhandel getrieben. Ein bundesdeutscher Industrieboß legte für zwei Billets zu „Boris Godunow“ einen Tausendmarkschein auf den Tisch, und der Inhaber eines Reisebüros bezahlte für eine gleichfalls auf normalem Weg nicht mehr erhält-lk:,e Karte das doppelte des Preises und belohnte den Mittelsmann, der sie ihm verschaffte, mit einem Gutschein für 14 Tage Adriaaufenthalt in der Luxusklasse... Auch das muß der Chronist, wenn auch nur am Rande, vermerken.
Geht er durch die sommerlichen Straßen dieser schönen Stadt, an den vielen ausverkauften Hotels vorbei, so wird er auf den geschäftlichen Hintergrund ihrer künstlerischen Unternehmungen immer wieder mit der Nase gestoßen. Kaum ein Schaufenster ohne die Photos der Giganten der Stimme und Magier des Taktstockes. Da zeigt, zwischen kostbaren Negliges Grace Bumbry ihre schönen Zähne, dort blickt treuherzig Christa Ludwig hinter bedrucktem Kattun hervor. Und überall der Firmenstempel des betreffenden Schallplattenkonzerns. Nirgends das Bild eines Dichters oder eines Komponisten, mit Ausnahme des armen Mozart auf dem Deckel der Schachteln für die Mozart-Kugeln. Dafür konnte man, wenige Schritte neben seinem Geburtshaus in der Getreidegasse, im Schaufenster der Länderbank, in unmittelbarer Nachbarschaft einer schwarzen Tafel, auf der die neuesten Devisenkurse verzeichnet sind, die mit falschen Perlen und falschen Edelsteinen geschmückte pelzbesetzte Krone des Zaren Boris bewundern, die dieser bei der Aufführung im Neuen Haus trägt...
Da kommen einem Dichterworte in den Sinn. Nicht aus dem „Jedermann“. Der war ein kleiner Mann und wußte noch nichts von „Euro-disc“ und „Cosmotel“. Sie stehen, diese Worte, in der „Heiligen Johanna der Schlachthöfe“ und lauten, vom Fleischkönig Mauler gesprochen: „Ach, in meine arme Brust / ist ein Zwiefaches gestoßen / wie ein Messer bis zum Heft. / Denn es zieht mich zu dem Großen / Selbst- und Nutz- und Vorteilslosen. / Und es zieht mich zum Geschäft / Unbewußt!“ — Möge in Salzburg die niedere Seele über die biedere, die hohe über die rohe nie den Endsieg davontragen.