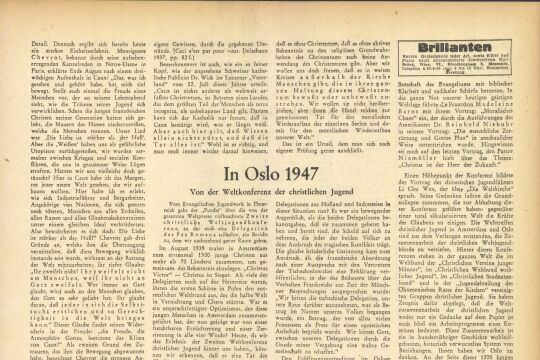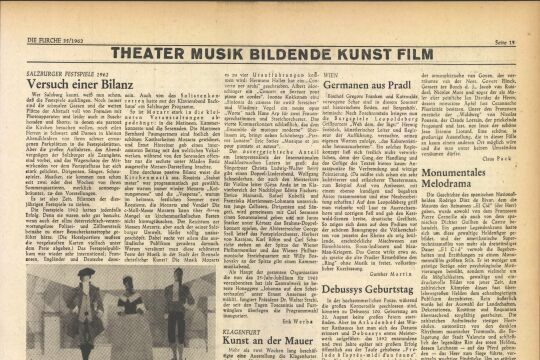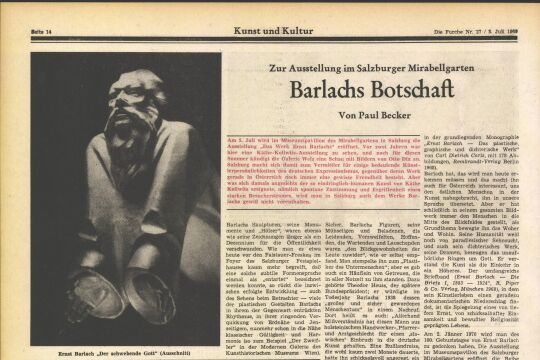Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Die erste Woche
Über der hohen Zeit des Salzburger Jahres herrscht heuer neben dem Sternbild des Genius loci ein zweites, dessen verführerischer Glanz in der ersten Festspielwoche jenes zu überstrahlen schien. Nicht durch die Größe in einer absoluten Wertordnung zwar, immerhin aber durch vollkommene Erfüllung der Idee eines Werkes im Raum der Bühnenwirklichkeit. Großartiger als mit dieser „Ariadne auf Naxos”, die den Opernreigen der Festspiele 1964 eröffnete, und mit diesem „Rosenkavalier” konnte Richard Strauss zu seinem 100. Geburtstag nicht gefeiert werden. Hätte man die gleiche Kunstgesinnung, die gleiche Bemühung um Werktreue, auch an Mozart gewendet — diese ersten sieben Tage wären beglückend gewesen. Aber auf der Suche nach einem Salzburger Mozartstil,
Harlekinade aut „Ariadne auf Naxos’
den Bernhard Paumgartner bei seinem Amtsantritt verhieß, ist man ins Experimentieren und damit auf Holzwege geraten. Mozart kann nur durch selbstlose Liebe gewonnen werden. Experimente mit Mozart, insbesondere das, sich über sein Werk selbst in Szene zu setzen, mögen zunächst vielleicht interessant sein; sie überzeugen auch dann nicht, wenn man sie wiederholt.
Reri Grist; im Orchesterraum Karl Böhm mit den Wiener Philharmonikern, beide vom Geist, von der lebendigen Gegenwart des Meisters durchdrungen und von ihm als ideale Vermittler seiner musikalischen Vorstellungswelt inauguriert. Haben wir in Christa Ludwig (Ariadne) ein Gesangsphänomen zu bewundern, das alle Möglichkeiten der weiblichen Stimme vollendet umfaßt, so ergreift uns Sena Jurinac durch ihre Interpretation der Rolle des Komponisten, die sie mit der Wesensfülle des Urbildes ausstattet. Die Verzweiflung des Künstlers angesichts des Anspruches seiner Umwelt und die göttliche Freude über das Gelingen, über die Aufhebung aller Gegensätze im Werk sind kaum jemals überzeugender ausgedrückt worden. Zierlich und kapriziös in ihrem Übermut, tanzte und sprang die Zerbinetta Reri Grist durch die Komödie. Ihre Koloraturen kamen wie gestochen, mit unfehlbarer Sicherheit; ein leichter gutturaler Schatten gibt der Stimme eigenartigen Reiz. Herrlich im Zusammenklang die drei Nymphen, die Damen Popp, Hellmann und Otto. Den Bacchus sang Jess Thomas mit hallendem Wagner-Organ, statuarisch, doch zu lyrischer Zartheit begabt. Paul Schäffler rührte mit einem liebenswerten, empfindsam gezeichneten Porträt des Musikmeisters. Die Buffopartien der Harlekinade hat man wohl schon in besserer Besetzung gehört, doch behaupteten sich auch diese Szenen im Gesamtbild der Aufführung. Günther Rennerts Regie war frei von krampfhaftem Bemühen um Originalität, und so gelang ihr eine schöne, rhythmisch fein ausgewogene Geschlossenheit des Ablaufs. Nur die Szenenbilder und Kostüme (Ita Maxi- mowna) vermochten nicht ganz zu entsprechen. Sie wirkten antiquiert und glanzlos, wie aus einem aufgelassenen Opernfundus. Immerhin gab es einige hübsche Details. Und vor allem dank Karl Böhm am Pult einen überwältigenden Erfolg, über den man sich nicht nur in Salzburg freuen darf.
Absoluter Gipfel der ersten Phase war die Wiederholung des vorjährigen „Rosenkavaliers” unter Herbert von Karajan und in der Inszenierung Rudolf Hartmanns. Was soll man über das Vollkommene sagen? Zieht man die wunderbare Aufführung von 1963 zum Vergleich heran, wird man die Feststellung nicht unterdrücken können, daß heuer das damals unerreichbar Scheinende noch übertroffen wurde. Elisabeth Schwarzkopf steigerte ihre Gestaltung der Marschallin über die Sphäre des Werkes hinaus in das unmittelbar Menschliche. Hier wurde Kunst in Leben umgesetzt, eine Metamorphose, die in das tiefste Geheimnis des Herzens hinabführt. Und diese Stimme! Ihr Registerreichtum umfaßt alle Stufen, von Altklängen, die an die Callas erinnern, bis zu den ganz unstofflichen, wie ein Lichtstrahl schwebenden kristallreinen Kopftönen. Den Quinquin sang wieder Sena Jurinac. Auch sie singt makellos schön, hat ihre Darstellung dieser Figur noch sublimiert: ein Jüngling voll glühender Leidenschaft, doch in jedem Augenblick der Verpflichtung bewußt, die ihm seine Herkunft auferlegt. Anneliese Rothenberger als Sophie ist die reizendste Erscheinung, die sich für diese Rolle denken läßt. Dem Ochs von Lerchenau Otto Edelmanns ist nachzurühmen, daß er im Vergleich zum Vorjahr weniger grob, dafür ursprünglicher und — auf eine noble Art — humorvoller ist. Eine gültige Gestalt. Alle anderen fügten sich in das Niveau dieser beispielhaften Aufführung. Es gab keine matte Stelle in dem kostbaren Gebilde, die Silberrose entfaltete sich unter Karajans Beschwörung zu traumhafter Blüte. Eine Huldigung für Richard Strauss, wie man sie würdiger nicht wünschen kann, eine Reprise, der man ad infinitum immer wieder begegnen möchte.
Der erste Mozart-Abend war nicht nur eine echte Premiere, sondern sogar eine österreichische Erstaufführung: das festliche Drama per musica „Lucio Silla” in der Bearbeitung von Bernhard Paumgartner. Noch nicht 17jährig, hat Mozart diese Opera šeria mit Ballett zu ;/Hoch- zeat des Erzherzogs ‘Ferdinand geschrieben;’ (Das Textbuch- stammt von Giovanni da Gammera, der sich später durch die italienische Übersetzung der „Zauberflöte” verdient gemacht hat.) Fassungslos stehen wir vor diesem Werk eines Kindes, vor diesem hohen Kunstverstand, vor der Großartigkeit der musikalischen Substanz. In der ursprünglichen Gestalt hatte die Oper eine Aufführungsdauer von viereinhalb Stunden; sie wurde von Bernhard Paumgartner auf zweieinhalb Stunden reduziert. Das zum großen Teil verlorengegangene Ballett blieb ganz weg. Die Bearbeitung darf als vorbildlich bezeichnet werden; sie ist respektvoll und läßt alles Wesentliche unangetastet. Glücklicherweise hörte der Referent das Werk bei der Generalprobe im Residenzhof (die Premiere mußte wegen eines Unwetters in den heißen und schlecht gelüfteten Karabinierisaal verlegt werden), und so wurde der Genuß, die Freude an diesem Wunder durch nichts getrübt. Ein Wunder ist es wahrhaft, was der Knabe Mozart aus diesem dichterisch dünnen Lobgesang auf den Adel des Herzens, auf Gattentreue und Humanität gemacht hat. Ganz aus der Tradition der Opera šeria entstanden, markiert „Lucio Silla” den musikgeschichtlichen Augenblick, da in die statische Masse der Barockoper die Elemente der Spannung und der Bewegung getragen werden. Das Melos, bei Gluck noch Bestandteil der Architektur, wird hier zur Vis dramatis, zur drängenden Kraft, die den Hörer unwiderstehlich mitnimmt durch alle Phasen einer Handlung bis zur Katharsis. Die Inszenierung von Christoph Grosser verzichtet weitgehend auf äußeres Geschehen und zieht die Handlung gewissermaßen nach innen. Eine Lösung, die man sich bei einem Ensemble hervorragender Stimmen gefallen lassen könnte. Das stand aber nicht zur Verfügung, und so blieb die Aufführung etwas schuldig. Gewiß wurde teilweise sehr gut gesungen, etwa von William Dooley (Silla), Donald Grobe (Cecilio) und Melitta Muszely (Giu- nia). Die anderen entsprachen, ohne Außerordentliches zu bieten; aber gerade das verlangt eine solche Inszenierung von allen Partien. Bernhard Conz leitete die Aufführung mit überlegener Konzentration und führte das Mozarteum-Orchester zu einer bravourösen Leistung. Das Bühnenbild Ekkehard Grüblers begnügte sich mit den vorhandenen Riesenarkaden der Stirnwand und in weiser Beschränkung mit der Andeutung eines Triumphbogens.
Auf den sonstigen Anteil Mozarts an diesem ersten Abschnitt des Festspielprogramms werden wir noch zu sprechen kommen. Es sind die alten Inszenierungen von „Figaros Hochzeit” und „Die 1 Zauberflöte”, Reprisen jener eingangs erwähnten Experimente, die nur halb geglückt waren und vielleicht-kein d T capo rechtfertigen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!