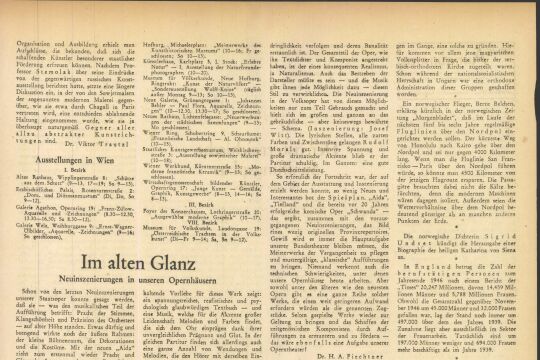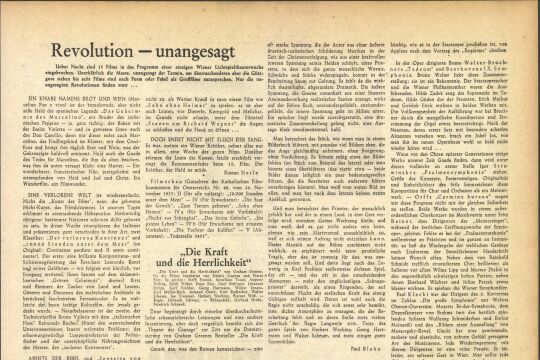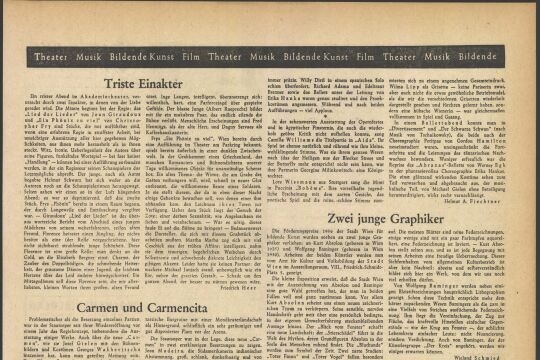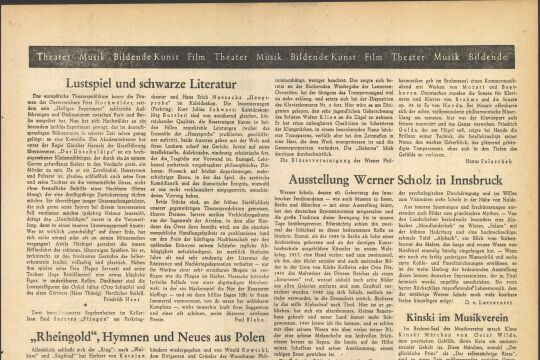Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Frau ohne Schatten“, „Aida“ und „Meistersinger“
Die Kollaboration Strauss-Hofmannsthal, von der „Elektra“ bis zu „Arabella“ umstritten und angefeindet, erweist in der „Frau ohne Schatten“ ihren tiefen und hohen Sinn. Hier wurde Hofmannsthals Ideal — die „Bühne als Traumbild“ — mit Hilfe der Musik vollkommen realisiert. Und Richard Strauss empfing aus der Hand des Dichterfreundes ein Sujet, einen Text, der alle seine reichen Kräfte — mit Ausnahme der Begabung für das Lustspielhaft-Konversationelle — ins Spiel zu bringen vermochte. So wurde gerade dieses Werk den beiden Künstlern besonders teuer.
Die fast ungetrübte Freude an dem gemeinsam Geschaffenen mußten sie mit dem Verzicht auf äußeren Erfolg bezahlen. Denn diese „Frau ohne Schatten“ ist ein enormes Werk, in mehrfacher Hinsicht. Zwar die Fabel, die Grundidee, ist einfach: Ein Geistwesen, die Kaiserin, das, um bei seinem irdischen Gemahl bleiben zu dürfen, Schatten werfen, das heißt ganz Mensch und Mutter werden muß; das die Möglichkeit hätte, einer irdischen Frau den symbolischen Schatten abzulisten; das auf seine eigene Rettung und die seines Gemahls verzichtet und eben dadurch von den „Uebermächten“ gerettet wird. Aber die bedeutende und tiefsinnige Handlung ist allzu breit ausgeführt und mit Symbolen überfrachtet.
Dem enormen szenischen Aufwand mit seinen zehn Verwandlungen entspricht ein ungewöhnlicher musikalischer Apparat (110 Mann im Orchester, vielstimmige Geistertöne, Stimmen der Ungeborenen, Stimmen von oben und Stimmen aus der Tiefe). Enorm sind schließlich auch die Dimensionen des Werkes (vier Stunden Spieldauer), und vielleicht war sein Bühnenschicksal besiegelt, als Strauss den Königsgedanken fallen ließ, der Hofmannsthal sosehr entzückte: Das Ganze sollte eine neue „Zauberflöte“ werden; die obere, die Geistsphäre, nur von einem reduzierten Orchester, etwa dem der „Ariadne“ begleitet, während der dichteren und bunteren Erdatmosphäre das große Strauss-Orchester zugeordnet sein sollte.
Enorm wie das Werk sind die Schwierigkeiten, die jede szenische Realisierung zu meistern hat. Nur die allergrößten Bühnen dürfen sich daranwagen. So gehört „Die Frau ohne Schatten“ zu den am seltensten aufgeführten zeitgenössischen Opern — und erweist auch hierin ihren aristokratischen Charakter. 1917 hatte Strauss die Partitur beendet, aber erst am 10. Oktober 1919 fand an der Wiener Staatsoper die Uraufführung statt (es war übrigens die erste richtige Wiener Strauss-Premiere überhaupt). Franz Schalk hatte das Werk aus der Taufe gehoben, von Roller stammten die Bühnenbilder, Maria Jeritza und Aagard Oestvig stellten das Kaiserpaar, Lotte Lehmann und Richard Mayr den Färber und die Färberin dar. Immer wieder gab es dann lange Pausen zwischen den Aufführungen der „Frau ohne Schatten“ Die letzte dauerte zwölf Jahre, und es ist — schon aus diesem Grunde — sehr erfreulich, daß sich die erneuerte Wiener Staatsoper des Werkes erinnerte.
Die Voraussetzungen für eine ideale Interpretation waren durchaus gegeben. Da ist zunächst die gewaltige Bühne mit ihren modernen technischen Einrichtungen, die jede Art von Zauberei ermöglichen. Der Regisseur i“v;?I Hartmann und der Bühnenbildner Emil Preetorius haben vor allem ihre Dimension gut genützt. Gezaubert und verwandelt wurde leider meist bei herabgelassenem, mit etwas biederen nachtdunklen Wolken versehenem Zwischenvorhang, an dem die vehemente und turbulente Musik einiger Zwischenspiele abprallte. Ein etwas jugendstilmäßiger, immer gleichbleibender Rahmen in Form einer Ornamentleiste faßte zweierlei Bühnenbilder ein. Die schönsten waren offensichtlich von persischen Miniaturen inspiriert (Terrasse über den kaiserlichen Gärten, Falknerhaus, Schlafgemach der Kaiserin). Das Färberhaus, eines jener Riesengewölbe, wie man sie gegenwärtig auf der Bühne besonders zu schätzen scheint, war im naturalistischen Stil gehalten (aber warum hat sich Preetorius die bunten, schreienden Farben entgehen lassen?). Das letzte Bild freilich gehört zu keinem der beiden Typen und war eine Verirrung ins Nordisch-Mythologisch-Wagnerische. Denn Hofmannsthal verlangt „eine schöne Landschaft, in deren Mitte ein goldener Wasserfall rauscht“. Auch die Farben mit dem vorherrschenden Grau und Blau wünschte man sich wesentlich lebhafter. Um so mehr Farbe gab's im Orchester und im Gesang der Solisten. Leonie R y s a n e k, in der Erscheinung mehr ein Burgfräulein als eine Kaiserin, hatte zum Ausgleich eine strahlend schöne, jugendlich-kräftige Stimme einzusetzen, die, sicher geführt, auch die beängstigendsten Spitzentöne und Koloraturen meistert. Hans Hopf, mehr als Forstadjunkt denn als Kaiser der südöstlichen Inseln kostümiert, hatte ebenfalls stimmlich zu kompensieren, was er der äußeren Erscheinung schuldig bleiben mußte. Aus einem Guß dagegen war die Färbersfrau der Christi Goltz, die das Finstere und Leidenschaftliche dieser Figur darstellerisch und stimmlich mit gleicher Vollkommenheit gestaltete. Der gute Barak Ludwig Webers spielt und singt neben ihr genau in jenem Stil, der ihm entspricht: ebenfalls eine schöne, runde Leistung ohne Tadel. Großartig und faszinierend Elisabeth Höngen als Amme, das Dämonische und Groteske, so wie es Hofmannsthal seinem Komponisten wiederholt explizierte, in Spiel und Gesang eindringlich verkörpernd. Erwähnen wir wenigstens noch, als Geistwesen oder Geisterstimmen, Kurt
Böhme, Emmy Loose, Karl Terkal und Judith Hellwig. — Opernfest-, ja Festoperformat erhielt die Aufführung aber vor allem durch das Orchester unter der Leitung von Karl Böhm, dem Jünger und Meisterinterpreten von Richard Strauss.
Mit der „Frau ohne Schatten“ schrieb Strauss eine völlig neuartige Partitur. Sie ist gewaltiger, mächtiger und zugleich kammermusikalischer als die der „Salome“ oder der „Elektra“. An die Stelle der Polyphonie einzelner Stimmen tritt die ganzer thematischer Harmoniekomplexe. Ihre Farbigkeit kennt praktisch keine Grenzen, die Virtuosität der Streicher ist auf die Spitze getrieben, zarte Hölzbläserpassagen und dröhnende Posaunenglissandi (ein hier erstmalig angewendeter Effekt) wechseln mit den geisterhaften Klängen der Glasharmonika. Und doch, und trotzdem! Der orchestrale Aufwand steht nicht immer im rechten Verhältnis zur Substanz — und auch nicht immer zum Inhalt und zum Text. Neben vielen didaktischen und ermüdenden Wiederholungen gibt es Passagen von unüberhörbarer Banalität. Das Geisterhafte der oberen und der unteren Sphäre, das Dämonische, ist nur gelegentlich getroffen. Das Gemüthaft-Menschliche, das Lyrisch-Sentimentale, kurz: der Barak-Ton regiert auf weite Strecken und oft auch dort, wo er nicht am Platz ist. Aus einigen Seiten dieser Partitur aber, aus dem ersten Zwischenspiel zum Beispiel oder aus der Musik zur vorletzten Szene (im unterirdischen Tempel), schlägt das strahlende und vielfarbige Feuer einer genialen Begabung, die, wenn sie mit einem entsprechenden künstlerischen Geschmack ausgestattet gewesen wäre, die Musik ihrer Zeit in unvorstellbarer Weise revolutioniert hätte.
Nach dieser „Rarität“ folgten, als 4. und 5. Neuinszenierung, zwei klassische Erfolgs- und Repertoireopern : „A i d a“ und „Die Meistersinger von Nürnberg“. — In dem geräumigen und imposanten Rahmen agierten die mit noblem Prunk (Robert Kautsky) ausgestatteten Aegypter und das Superballett Erika Hankas. Sehr reizvoll kontrastierte die helle, schöntimbrierte Stimme von Leonie R y s a n e k (Aida) mit der dunklen, etwas rauhen der Südamerikanerin Jean Madeira, die als ägyptische Königstochter eine wahrhaft königliche Erscheinung ist. Ebenso vollkommen war darstellerisch und stimmlich die Leistung von George L o n d o n, dem in kleinem Abstand Hans Hopf als Radames, Oskar Czerwenka als König und Gottlob F r i c k als Oberpriester Ramphis folgten. Tadellos der Chor, nicht frei von kleinen Gewaltstreichen die Regie Adolf Rotts, während sich Rafael K u b e 1 i k am Pult leider als Fehlbesetzung erwies.
Der als Konzertdirigent sehr schätzenswerte Musiker verfügt weder über die erforderliche Routine noch über jene spezifische Kraft, mit der man Orchester und Bühne zusammenhält. So gab es, was gerade in der „Aida“ nicht vorkommen sollte, während' der ersten beiden Akte einige Längen.
Die „M eistersinger“ inszenierte, in etwas traditionell-realistischem Stil, Herbert Graf. Erst im letzten Bild des 3. Aktes — mit den luftigen Holzgerüsten, den bunten Trachten und den vorherrschenden Farben Grün und Gelb — gelang ihm und dem Bühnenbildner Robert Kautsjcy auch optisch etwas Festliches. — In dem glänzenden und routinierten Wiener Meistersingerensemble (Paul Schöffler, Irmgard Seefried, Erich Kunz, Gottlob Frick u. a.) war es für den von auswärts kommenden Junker Stolzing (Hans Beirer) nicht leicht, sich zu behaupten. Aehnlich erging es, in größerem Stil, dem Dirigenten der Aufführung, Fritz Reiner (früher in Dresden, gegenwärtig in Chikago tätig), unter dessen Hand die große Prügelfuge fast in eine musikalische Rauferei zwischen Chor und Orchester ausgeartet wäre. Das festlich gestimmte Publikum bereitete besonders Paul Schöffler stürmische Ovationen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!