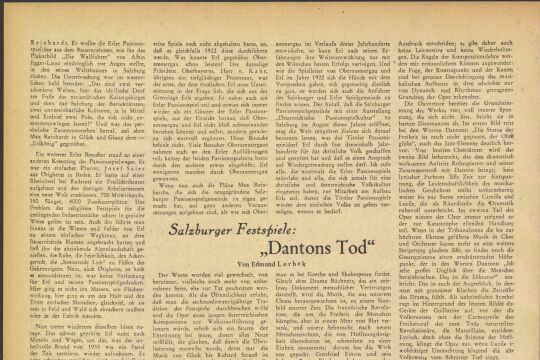Von Venedig nach Damaskus
Die Berliner Festwochen unterscheiden sich von den meisten europäischen Festspielen durch Struktur, Eintrittspreise und Publikum. Weit weniger elitär als etwa Bayreuth, Salzburg, München oder Wien, bemühen sie sich doch um eine größere Breitenwirkung, indem sie nicht nur Konzerte und Bühnenwerke vorstellen, sondern auch wesentlichen künstlerischen Anlässen in Form von Gedächtnisausstellungen Rechnung tragen oder reizvolle Konfrontationen zwischen Vergangenheit und Gegenwart bieten. Die Eintrittspreise der Veranstaltungen werden nicht erhöht, die Konsumenten sind neben zahlreichen Gästen vor allem die Berliner selbst. Durch die Vielfalt der Darbietungen, die sowohl Neuinszenierungen als auch Repertoiretheater umfassen, Gastspiele, Sonderausstellungen und künstlerische Kongresse koordinieren, erhalten die Berliner Festspiele ein eigenes Profil.
Die Berliner Festwochen unterscheiden sich von den meisten europäischen Festspielen durch Struktur, Eintrittspreise und Publikum. Weit weniger elitär als etwa Bayreuth, Salzburg, München oder Wien, bemühen sie sich doch um eine größere Breitenwirkung, indem sie nicht nur Konzerte und Bühnenwerke vorstellen, sondern auch wesentlichen künstlerischen Anlässen in Form von Gedächtnisausstellungen Rechnung tragen oder reizvolle Konfrontationen zwischen Vergangenheit und Gegenwart bieten. Die Eintrittspreise der Veranstaltungen werden nicht erhöht, die Konsumenten sind neben zahlreichen Gästen vor allem die Berliner selbst. Durch die Vielfalt der Darbietungen, die sowohl Neuinszenierungen als auch Repertoiretheater umfassen, Gastspiele, Sonderausstellungen und künstlerische Kongresse koordinieren, erhalten die Berliner Festspiele ein eigenes Profil.
Diesmal lag der Schwerpunkt auf trainierter Körper bot nur exakte Schönberg, dessen 100. Geburtstages Ballettattitüden, fern jeglicher Anin zahlreichen konzertanten und mut und allem Zauber der Persön- Bühnendarbietungen gedacht wurde, lichkeit. Um ihn herum gruppierten Ihm zu Ehren bot man Dokumentą- sich weitere junge Athleten, die zu tionen des „Blauen Reiter” in Ver- Projektionen antiker Standbilder bindung mit dem Musikalischen in olympische Disziplinen exerzierten der Malerei, aber auch zahlreiche Veranstaltungen des experimentellen Theaters und der Musica Nova, sowohl auf sakralem als auch auf profanem Sektor.
Mit Spannung erwartete man das Ingmar-Bergman-Gastspiel mit Strindbergs „Nach Damaskus” und die deutsche Erstaufführung von Benjamin Brittens sechzehnter Oper „Tod in Venedig”. — Wer Thomas Manns berühmte Novelle gelesen und Viscontis Filmdeutung gesehen hatte, mußte voreingenommen, ja, skeptisch dieser Literaturoper-gegenüberstehen. Wo der Dichter seine eigenen Empfindungen in gedankenvolle Betrachtungen über Kunst und Ästhetik projiziert, wo er die homoerotische Liebe eines alternden Schriftstellers zu einem Knaben, dem Idol antiker Schönheit nur erahnen läßt, wo dem Filmzauberer Visconti zum bewußt stummen Spiel seiner Akteure eine traumverhangene, visionäre optische Entsprechung ohnegleichen gelang — hier mußte das Dichterwort —gesungen und gesprochen als ein endloser Monolog — das Werk vergröbern und verfremden.
Mag den schwerkranken Komponisten jener „Tod in Venedig” als Vorahnung seines eigenen Schicksals besonders bewegt haben, mag seine Musik hin und wieder private Seelenzustände voll Schwermut und Sentimentalität reflektieren — mit der Umfunktionierung dieser Novelle zum Opernstoff bewies er keine glückliche Hand.
Das Opemlibretto von Myfanwy Piper, rückübersetzt ins Deutsche von Claus Henneberg und Hans Keller, bietet nur noch das rohe Handlungsgerüst. Thomas Manns Sprache wurde dabei simplifiziert und ist nicht immer frei von Plattitüden. Das Werk krankt vor allem an der Tatsache, daß hier nur eine Person, bar jeglicher Handlungsdramatik und ohne kontrastierenden Sängerpartner den Abend bestreiten muß. Sein Gegenspieler und eigentlich die Hauptfigur des Werkes ist der Knabe Tadzio, halb Kindheit noch, halb bereits erotische Bewußtheit verkörpernd. Der Tänzer Alfonso Pinero aber ließ all diese Eigenschaften schmerzlich vermissen. Sein durch-
Die Phantasielo&igkeit von Ronald Hynd wirkte dabei ebenso ermüdend wie die unsichere Regieführung Anthony Beschs, dem Jürgen Henzes Bühnenbild — fahle, pseudo-venezianische Projektionen ohne Raumtiefe auf knarrenden, aufklappbaren Tafeln — weitgehend jede Aktionsmöglichkeit nahm.
Aus dem Ensemble von 38 Mitwirkenden verdient neben Donald Grobe, der seine Partie mit bewundernswürdiger Disziplin bewältigte, nur Rold Kühne Erwähnung. Unter wechselnden Gestalten — als Reisender, als Gondoliere, Hotelmanager und Friseur, ja, sogar als Dionysos ist er der personifizierte Dämon des Dichters und schließlich sein Tod.
Brittens Partitur verliert sich in konventioneller Tonalität mit seriellen Anklängen. Die Romantik seiner Musik wechselt zwischen Parlando und optischer Illustration, rekapituliert gelegentlich Phrasen seines „Peter Grünes”, malt südliche Stimmungsbilder und vermeidet ängstlich jegliche klangstilistische Kühnheit. Am originellsten wirkt noch die Konfrontation der unsichtbaren Chöre in aleatorischer Fürung zum Sologesang und das parodierende Lied des ältlichen Gecken und der jungen Männer auf der Überfahrt zum Lido.
Gerd Albrecht leitete mit sicherer Hand den präzise funktionierenden Orchesterapparat, dem sich fern- chöre (ein Lob für Walter Hagen- Groll) und Tonbandzuspielungen reibungslos verschmolzen. — Der Gesamteindruck des Abends war enttäuschend. Zuviel Noblesse und Künstlichkeit in der Partitur, zuwenig auf der Szene.
Am nächsten Abend verstand die Deutsche Oper mit jener Eugen-One- gin-Aufführung zu versöhnen, die leider als Austauschgastspiel mit Wien kaum noch zustande kommen wird. — Tschaikowskys Idealbild der russischen Frau, die auf persönliches Glück verzichtet, arbeitete Boleslaw Barlog liebevoll und fast zärtlich in Pilar Lorengürs Tatjana heraus, die mehr Schönheit als jugendliche Naivität verkörperte. Ihre zunächst unterdrückte, dann hemmungslos hervorbrechende Leidenschaft zu dem scheinbar ablehnenden Mann, der in Barlogs Konzeption ihre Neigung nicht nur erwidert, sondern über die vorhandenen Zeiträume hinaus fördert und steigert, vermag einen Abend lang die Spannung der im Grunde genommen skizzenhaften und manchmal bläßlichen Szenen anzuheizen. Die Zweisamkeit und Weltverlorenheit des Paares unterstreicht der Bühnenbüdner durch den bewußt kleingehaltenen Rahmen eines Kabinetts, das der Schlußszene unvergleichliche Intimität sichert. „Wie war einst das Glück so nah.” Hier stockte der Herzschlag, hier wurde der Stillstand der Zeit Ereignis.
Eine durchwegs erstklassige Besetzung in Ton und Darstellung: Pilar Lorengar — blühend, unruhig, strahlend, souverän — eine reiche Gefühlsskala lag in ihrer leicht nervösen, zugleich aber bildschön intonierten Stimme. Bernd Weikl war als
Onegin — wesentlich lebendiger und zugänglicher in seiner Darstellung als in Wien. Der Lenski Horst Laubenthals: Pianokultur in noch etwas schmaler Stimme. Marti Talvela gab als Gremin ein an König Marke gemahnendes Bekenntnis, warm und klangreich im mit Sonderbeifall bedachten Fes’tsaal inmitten der dezent zu Marionetten erstarrten Ballgäste: Herbstfarben in Braungold, viel gedämpftes und flexibles Licht in den Garten- und Interieurszenen. — Am Pult: wieder Gerd Albrecht, der russische Leidenschaft und Temperamentsausbrüche zugunsten eines noblen Orchesterklanges, dem sich makelloser Chorgesang (Hagen- Groll) einfügte, zurücktreten ließ.
Auch die Festwochenpremiere des Schiller-Theaters erging sich mit Tschechows „Ivanov” in Melancholien russischer Seelenlandschaften. Der passive Held des Werkes — von Martin Benrath sensibel und nervös verkörpert — leidet als noch junger Mann an Lebensüberdruß und unsäglicher innerer Leere. Demonstriert ihm die hektische, enttäuschte, vom Tod gezeichnete Gattin, die seinetwegen ihren jüdischen Glauben aufgab (beklemmend virtuos Gisela Stein) bereits die Sinnlosigkeit d i e- s e r Ehe, so flüchtet er sich aus Furcht vor einer weiteren Katastrophe, die ihn in einer neuen Heirat erwartet, an seinem Hochzeitstag in den Selbstmord.
Das Gesellschaftsdrama erhält tragikomische Akzente durch eine Fülle draller Bürger.typen, die sich im Salon der Lebedevs (Vorsitzende: die resolute Berta Drews) treffen. Köstlich der heimliche Säufer Carl Raddatz’, enervierend echt der gelangweilte, senile Graf Martin Heids, der eine reiche Witwe umgurrt, penetrant Stefan Wigger als geldgieriger Schmierfink und peinlich, voll unheimlicher Intensität der Wahrheitsfanatiker und Moralapostel Fritz Lichtenhahns.
Sie alle verstand Hans Lietzau in grellen Kontrasten geschickt durch dieses noch etwas unvergorene Frühwerk Tschechows zu steuern und durch zielsichere Pointierung der Figuren eine gewisse Fadesse des Werkes vergessen zu machen. Achim Freyer unterstrich mit einem grau verschleierten Bühnenbild, hinter dessen Tüllvorhängen man Blüten- bäume erahnen konnte, diese beklemmende Trostlosigkeit und Lebensleere. Ein dankenswerter Abend mit einem zu Unrecht vernachlässigten Tschechow.
Audi Strindbergs Trilogie „Nach Damaskus” deckt die Nachtseiten des Lebens auf. Von Ingmar Bergman erwartet man ein übersteigertes expressionistisches Mysterium, einen zermürbend zelebrierten Geschlechterhaß, einen breit gepflügten Leidensweg von Jerusalem nach Damaskus, auf dem der Unbekannte — Strindberg selbst — vom Saulus zum Paulus geläutert wird. Bergman jedoch arrangierte mit verblüffend leichter Hand, locker und selbstverständlich eine bürgerliche Durchschnittsfamilie mit ganz gewöhnlichen Ehekrisen und Alltagssorgen.
Bergmans konventionelle Regie in sparsamen Teilprojektionen erhält ihre starken Akzente erst im grotesken Gespensterreigen der Bettler und Irren, die Jan-Olof Strandberg, den bis fast zu einer klinischen Studie gedrängten Hauptdarsteller, mit Talmiorden dekorieren. In einem Alptraum sieht sich der Unbekannte auf doppelter Ebene zugleich an einem Wirtshaustisch mit einem Freudenmädchen und als Sterbender mit priesterlicher Assistenz in einem Krankenhaus. Sein Leidensweg endet bei Bergman nicht im Kloster — der dritte Teil der Trilogie wird nicht gespielt.
Für heitere Töne sorgte anderntags wiederum die Deutsche Oper, die Boris Blachers Werte „Preußisches Märchen” mit dem ewig wirksamen Zauber der Montur forsch über die Bühnenrampe defilieren Keß. Parodien und Rollentausch — Dragonerweib vom Mann gesungen {Ivan Sardi), ängstlicher Hausvater von der zierlichen Dorothea Weiß verkörpert —, dazu ein schüchterner Sohn (Manfred Röhrl), dem die geborgte Uniform Löwenmut verleiht — und das Ganze umrahmt von nuancenreicher Musik und feurigen Marschrhythmen unter Preußens bühnen- und abendfüllenden Fahnen. (Regie: Bauernfeind.)
Als Ergänzung dazu lohnte der Besuch einer umfassenden Ausstellung der Gründerjahre in Bildern, Dokumenten und Mobiliar, geboten in der Akademie der Künste. Im gleichen Haus konnte man Schönbergs Lebensweg an Hand von reichem Photomaterial, Schriftstücken, Partituren und einem eindrucksvollen Vergleich seiner sämtlichen Bühneninszenierungen von „Moses und Aron” verfolgen. Auch diesmal stand das bereits 1959 aufgeführte Werk auf dem Spielplan der Deutschen Oper.
Ihm zu Ehren gab es zahlreiche
Konzerte: Maurizio Pollini trug bravourös und poetisch zugleich sein gesamtes Klavierwerk vor, die Solisten des Berliner Philharmonischen Orchesters musizierten mit der Mezzosopranistin Barbara Scherler die „Hängenden Gärten”, nach Gedichten von Stefan George, und selbst Herbert von Karajan zollte dem Jubilar eine angemessene Hommage mit der Tondichtung „Pellėas und Meli- sande”, einem Klanggemälde zwischen Wagner (Tristan) und Gustay Mahler stehend, gigantisch in seinem orchestralen Aufwand (17 Holz-, 18 Blechbläser, zwei Harfen, 64 Streicher) und von rauschhafter Dämonie in seiner mitreißenden Wiedergabe.
Bescheiden wirkten dagegen zahlreiche Klang- und Wortexperimente der zeitgenössischen Musik, wie etwa das „Klangsprechen” Lothar Sclirey- ers, der expressionistisches Theater mit gigantischen farbigen Robotern bereits 1915 vollführte, dessen auf Tonhöhen geschriene, gebrummte, gehauchte oder gestöhnte skandierte Wortfetzen heute jedoch nicht mehr überzeugen. Ein exakter „Pierrot Lunaire” (Schönberg) unter Leitung von Juan-Pablo Izquierdo mit der lebhaften Rezitation von Gisela Saur-Kontarsky riß anschließend das ermüdete Publikum aus seiner Lethargie.
Erwähnt sei noch die Musica Nova Sacra in der Kaiser-Friedrich-Ge- dächtniskirche, die mit ihrem vielseitigen Programm zu fesseln verstand und den Rahmen reiner Kirchenmusik sprengte. Anton von Weberns Streichquartett — mit 22 Jahren komponiert — vermittelte in blühenden Melismen große Klangdichte. Peter Ruzicka beschwor Auschwitz- Visionen in seiner „Todesfuge”, (Text: Paul Celan). Nervöse, affekt- geladene Musik unterstrich die brutalen Rezitationen. Hans Eisler ließ in seiner Fuge „Gegen den Krieg” einen Brecht-Text frei deklamieren, teils chorisch skandiert, teils kanonisch gesungen. Der Psalm „De Profundis” von Schönberg, hebräisch dargeboten, wechselte zwischen reiner Wortdeklamation und Sprechgesang auf fixierte Tonhöhe in pathetischer Steigerung. Das Streichquartett von Alexander von Zemlinsky, dem Lehrer Arnold Schönbergs, zeichnete sich durch ständigen Tempowechsel in eilenden Figurationen und weichen, romantischen Lyrismen aus, die sich wie eine ewige Melodie ohne eigentliche Satzeinschnit’te aneinanderreihten, in ihrem Aussagewert jedoch begrenzt blieben. Dem Assmann-Quartett, dem Dirigenten Peter Schwarz und dem jugendlichen Chor gelangen gute Leistungen. *
„Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen”…Die Berliner Festwochen boten noch vieles, was hier nicht erwähnt werden konnte. Gewiß keine Sensationen, aber einen guten künstlerischen Gesamteindruck.