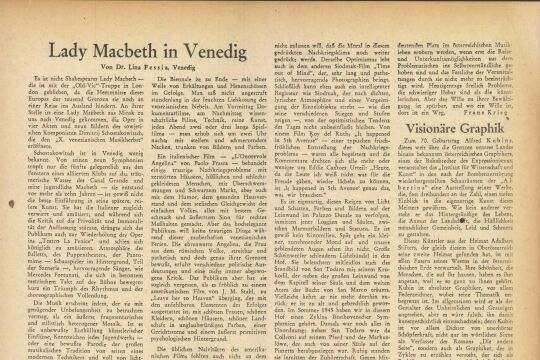„Den guten Wein zuletzt...“
Es war ein Jubiläum von seltener Fülle und Breitenwirkung: Berliner Festwochen, zum 25. Male. Man präsentierte einen Querschnitt durch das Werk Kurt Weills, man veranstaltete einen Zyklus mit der Akademie der Künste, Thema: „Als der Krieg zu Ende war“ — Dokumentationen in Musik, Dichtung, Malerei und Film aus der Zeit zwischen 1945 und 1950 und man zeigte die Welt des Mittelmeeres als Zentrum der Kulturen zwischen Ost und West in dem musiktheatralischen Auftragswerk „Mare Nostrum“ von Mauricio Kagel. Traditionelle Tanz- und Wortgastspiele belebten das imponierende Panorama: New York (La Mama), Tokio (N6), Sevilla, Neapel, Mailand, Paris standen auf dem Programm. Den „guten Wein“ aber hatte man bis zuletzt aufgehoben.
Es war ein Jubiläum von seltener Fülle und Breitenwirkung: Berliner Festwochen, zum 25. Male. Man präsentierte einen Querschnitt durch das Werk Kurt Weills, man veranstaltete einen Zyklus mit der Akademie der Künste, Thema: „Als der Krieg zu Ende war“ — Dokumentationen in Musik, Dichtung, Malerei und Film aus der Zeit zwischen 1945 und 1950 und man zeigte die Welt des Mittelmeeres als Zentrum der Kulturen zwischen Ost und West in dem musiktheatralischen Auftragswerk „Mare Nostrum“ von Mauricio Kagel. Traditionelle Tanz- und Wortgastspiele belebten das imponierende Panorama: New York (La Mama), Tokio (N6), Sevilla, Neapel, Mailand, Paris standen auf dem Programm. Den „guten Wein“ aber hatte man bis zuletzt aufgehoben.
Er floß zunächst in Form reicher Wortkaskaden und mit urkomödiantischer Brillanz aus Giorgio Strehlers Füllhorn: „II Campiello“, jenes schmuddelige, armselige Plätzchen im winterlichen Venedig, das Goldoni mit lebendig-prallen Figuren belebte, erstand in hinreißender, geschwätziger Gassenatmosphäre. Drei alte Weiber, lebendige Zeitungen, wachen über die Tugenden ihrer Töchter, die sie aber doch unter die Haube bringen wollen. Ein fremder Cavaliere genießt den Karneval Venedigs, finanziert die Hochzeitsfeier der einen und schnappt sich verliebt bei der Gelegenheit die zweite Tochter, deren wehmütiger Abschied vom geliebten Campiello einen Hauch von Traurigkeit über das turbulente Geschehen breitet.
Wie Strehler die Spielfläche mit den ärmlichen Hausfassaden Luciano
Damianos gliedert, wie er Detailrealismus in kleinsten Geschehnissen erspürt — wie er mit Gegenlichtwirkung arbeitet und in der Dialogführung dem „Volk aufs Maul schaut“, wie er die vielfältigen Typen charakterisiert und Stimmen weinen, schluchzen, kichern, schreien und schimpfen läßt — das alles wirkt so verblüffend ungekünstelt und lebensecht, daß auch der Nichtitaliener überzeugt ist, jedes Wort verstanden zu haben. Es war ein ungetrübtes Vergnügen — Publikum und Gäste bejubelten einander in vollkommener Übereinstimmung.
Fern aller komödiantischen Leichtigkeit brachten tags darauf Roger Planchon und das Theätre National Populaire des Paris eine aufsehenerregende Deutung von Molieres Tartuffe“ ins Schiller-Theater. Da gab es nur krasse Schwarz-Weiß-Malerei: heuchlerische Verlogenheit dokumentierte sich nicht nur in Christusstatuen, Kreuzesdarstellungen und Flammenschwertengeln auf Bühne und Bühnenvorhang, sondern auch im ohrenzerreißenden Halle-lujah-Gesang, der über Lautsprecher das Theater erfüllte. Aufkommender, aber noch brüchiger bürgerlicher Wohlstand ließ sich nicht nur vom riesigen barocken Fassadenputz und abblätternden Kolossalfresken (Hubert Mönloup) ablesen, sondern üppige Prunkkostüme der ersten Akte wichen saloppen Alltags- und Nachtgewändem im letzten Teil, in dem die unerbittliche Staatsgewalt mit Stricken, Henkerssymbolen, Soldateska und Gewehren ins einstürzende Haus brach. Roger Planchon aber war ein leiser, glatter, fast eleganter Kavalier, der es nicht nötig hatte, um die Gunst der Frauen und Männer zu buhlen: sie fiel ihm in Gestalt des alternden Orgon buchstäblich in den Schoß, und auch die — leider zu junge, daher nicht ganz überzeugende — Gattin schien Tartuffe eher zu verführen, als von ihm bedrängt zu werden. Zwischen stimmungsvollen, malerischen Beleuchtungseffekten und stumpfem Bühnen-Hell-Dunkel vollzog sich ein bitterböses, hartes Stück Gesellschaftskritik in frappanter Mischung aus Morbidität, Demagogie und Dämonie mit einem Höchstmaß an Spannungsgeschehen in den Zwischentönen menschlicher Leidenschaften, Verir-rungen und Versöhnlichkeit. Ein großer Theaterabend!
*
Mit Spannung erwartete man den Berliner Eigenbeitrag im gleichen
Haus. Aber wenig Glück war Hans Lietzau mit seiner Inszenierung von Schillers „Don Karlos' beschieden. Am Tag der Premiere wurden in Spanien fünf Terroristen hingerichtet, in jenem Spanien, das zum Schil-lerschen Sittengemälde des 16. Jahrhunderts noch immer beklemmende Parallelen bietet. Der Mensch als Opfer des Staats — die Konzeption der Leere und Verlorenheit mit graphitgrau überkuppelter Einheitsszene auf karger Bühne, nur bestückt mit rohem, gelegentlich durch einen weißen Schleier verhängten Bretterthron — bietet zunächst bestürzende Aktualität. Hier stammelt Carlos (Fritz Winter), eine unglückliche, verkrampfte, spinnenartige Figur in ledernem Rockerdreß seine Seelenqualen in die kalte Helligkeit der bleifarbenen Bühne und in deren Bretterboden, hier plaudert Posa (Peter Fitz) arglos und bedächtig seine zerdehnten Phrasen, fordert fast beiläufig auch so etwas wie „Gedankenfreiheit“ und zieht dabei vor dem mumienhaft weißgepuderten Totenkopf-König (Erich Schellow) seinen schwarzen Ledermantel aus, wirft ihn auf den Boden und — zieht ihn wieder an, damit eine Verlegenheitsgeste in seinen unendlich sterilen Sermon einbauend... Hier hat sich der Zuschauer bei undifferenzierten Lichtspielen zu exakten geometrischen Auftritten der Akteure jeweils mit viel Phantasie Prunkgemächer, Schlafzimmer, Gärten und Kerker vorzustellen, und einzig die uneinheitlichen Kostüme zwischen konventioneller Theaterpracht, Leder-montur und Tüll — einem Bilderquerschnitt zwischen Velasquez, Brueghel und den Präraffaeliten, serviert von den Herren Frigerio und Squarciapino — beleben zaghaft die Starre der trotz unwülkürlicher Reduktionen noch immer zu breit zelebrierten Schillerschen Verse.
Das durchaus überzeugend angelegte Konzept der tödlichen Erkaltung und eisigen Frustration dieser spanischen Marionetten scheiterte weniger an Lietzaus intellektuellem Kalkül als an der Unzulänglichkeit seiner Interpreten. Erich Scheüows Philipp, dieser “lebende Leichnam, beherrscht seine monoton bramarbasierende oder plötzlich grell aufbellende Stimme ebensowenig wie die piepsende, backfischhafte Eboli in karottenroter Krauskopfperücke (Verinice Rudolph), der meist unhörbar nuschelnde, weinerliche Carlos war genau so kleinkariert wie der joviale Posa, auch Alba (Rudolf Schult) und Domingo (Joachim Ker-zel) unterhielten sich nur „beiseite“. Überzeugender wirkte Bernhard Mi-nettis grausam statuarischer Großinquisitor. Einzig Gisela Stein, straff gekämmt, in strengem Weiß, ließ in ihrer fraulichen Herbheit königliche Würde erkennen und in überlegenem, getragenen Rezitationsduktus Lietzaus Intentionen erahnen: Der Vater-Sohn-Konflikt als lästiges Randgeschehen zu hochaktuellem, verächtlichen Intrigenspiel auf politischer Bühne. In der Gesamtheit aber fehlte sämtlichen Darstellern jenes Staatstheaterformat, das man von Berlins erster Bühne erwarten kann. — Das zwangsläufige Desaster zwischen Buh-Rufen und müdem Beifall wußte der Regisseur mit Anstand zu tragen.
Einen unaufdringlichen Festwochenbeitrag bescherte das Renaissance-Theater mit Terence Ratti-gans „In Praise of Love“, jenem etwas sentimentalen Familienspiel um die todkranke Gattin und Mutter, die ihren Zustand vor den Angehörigen verschweigt, während jene längst darüber im Bilde sind. Unter Boles-law Barlogs dezenter, behutsamer Regie verströmten vor allem Heidemarie Hatheyer und Wolfgang Luk-schy echtes Gefühl und werteten ein mittelstarkes Boulevardstück erfreulich auf.
+
Musik aber glättete die Wogen der Erregung, die über die Sprechbühnen schäumten. Karajan feierte mit den Berliner Philharmonikern wahre Feste: Richard Strauss1 selten gespielte „Metamorphosen“, eine „Studie für 23 Solostreicher“, ein Alterswerk des Meisters, gaben den resignierenden, stimmungsvollen Auftakt zu einem üppigen „Zarathustra“, der schwelgerisch, aber mit gebändigter Kraft in seltener Homogenität in Sternenregionen zu greifen schien.
Dem Himmlischen waren auch Mozarts „Krönungsmesse“ und Bruckners „Te Deum“ zugeeignet. Der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde Wien zelebrierte Mozart edel, aber ein wenig bläßlich und legte sich erst bei Bruckner mit beachtlicher Verve ins Zeug. Die Berliner Philharmoniker assistierten den Gästen mit ungemindertem Wohlklang, und die beifallsfreudigen Zuhörer schlössen sogar das schwache Solistenquartett (Tomotoa-Sintoto, Baltsa, van Dorn und Krenn) in ihren Jubel ein.
In der Deutschen Oper gab es eine Rarität: Pier Francesco Cavallis „La Calisto“, Renaissancemusik des venezianischen Monteverdi-Nachfol-gers in feiner, schwermütiger, eher undramatischer Linienführung. Die Liebes- und Verkleidungskomödie im Götterreich (Jupiter, in Gestalt ihrer Herrin Diana, verführt die Nymphe Calisto) hatte Winfried Bauernfeind zu Jorge Castillos sparsamen Pop-Dekorationen und entsprechenden Kostümen unbeschwert und lok-ker inszeniert.
Zum Festwochenausklag bescherte das gleiche Haus den bang erwarteten „Parsifal“, der von Filippo San-just (Regie und Szene) in eigenwilliger Neudeutung bewußt in Wieland-und Wolfgang-Wagner-Ferne gerückt wurde. — Ein vielversprechender 1. Akt: Waldstimmung mit Bergabstieg zum heiligen See, Blattwerk-Silhouette und Frühnebel, dazwischen lebhafte, ungezwungene Aktion mit Kundrys schreitender Allgegenwart im Hintergrund. Bei der Verwandlung nimmt Sanjust Wagner wörtlich: in Zeit und Raum sieht sich Parsifal vervielfacht, sieht auch visionär bereits das ganze Gralsgeschehen, an dessen betont katholischem Einkleidungszeremoniell des Amfortas-Priesters er auch aktiv teilnimmt, indem er den Wankenden auffängt und seinen zurückgelassenen Mantel küßt. Dadurch aber werden Gurnemanz' tadelnde Worte widersinnig.
Es gibt keinen Gralstempel mehr, nur einen Mittelaltar auf riesiger Treppe und zwei lange Festtafeln für die Gralsritter zu beiden Seiten der Bühne auf gleichhohem Podest. Es gibt aber auch in dem sich zu diffusem Garten wandelnden Klingsor-Turm keine verführerischen Blumenmädchen, sondern nur brave, einheitlich grün gewandete höhere
Töchter mit roten Stolen — höchstens starren Tulpen vergleichbar, die Par-sifals Tugend nicht im mindesten gefährden. Selbst Kundry (Janis Martin), ganz in Schwarz, mußte mit sinnlichem Glanz und prachtvoller Führung ihrer reifen, schönen Stimme den Mangel äußerer Attraktion wettmachen.
Das letzte Bild — die Karfreitagsaue — ertrank in flächigem, gleißendem Grün — wie überhaupt Grün-und Blaufluten oft die Bühne zur Gänze einhüllten. Abstrakte rosa Wolkengebilde wurden dadurch immerhin milde verdeckt. Der Erlö-sungsschluß vollzog sich wieder im nüchternen, modernen Altarraum, wo sich die Hände sämtlicher Gralsritter zum goldbraunen Kelch eindrucksvoll sehnend emporreckten.
Wenn die Szene, in Lichtfluten, die zunächst differenziert aufdämmerten, zu erstarren drohte, setzten die Akteure durch unpathetisches, aber stets teilnahmsvolles Gebärdenspiel ein versöhnliches Gegengewicht Die Stimmen der Hauptdarsteller überboten einander an Wohlklang, Ausdruckskraft und deklamatorischer Deutlichkeit: Gerd Brenneis ist ein differenzierter Parsifal, schafft die Verwandlung vom reinen Toren zum geläuterten Gralspriester überzeugend, Martti Talvela fesselt als profunder Gurnemanz, Gerd Feldhoff liefert fast eine klinische Studie mit seinem dramatisch-packenden Am-fortas, Rolf Kühne erhebt erstmals seit Jahren wieder einen Klingsor zur tragisch bedeutenden Figur des Werkes. Einzig der Schlußchor (Ho-gen-Groll) tönte bei der Premiere nicht in gewohnter Dominanz und detonierte um Nuancen, während das Orchester unter Heinrich Hollreiser gediegen, aber nicht immer mitreißend musizierte.
In den heftigen Schlußbeifall mischten sich böse Buhs für Sanjust. Am pro und contra der feinen Leut', der eleganten Hotevolee aber war mit erfreulicher Genugtuung zu erkennen, daß Berlin seinen legendären Ruhm als Theaterstadt der zwanziger Jahre und des 19. Jahrhunderts noch heute rechtfertigt.