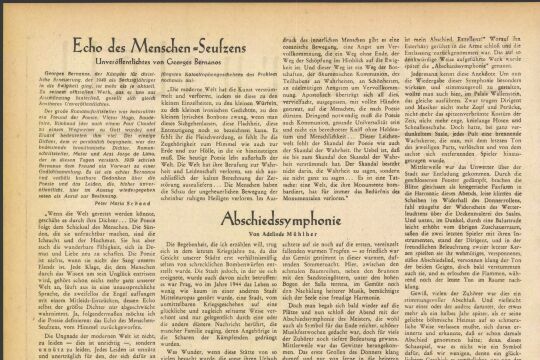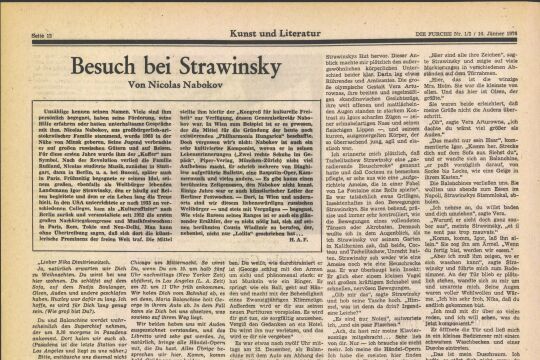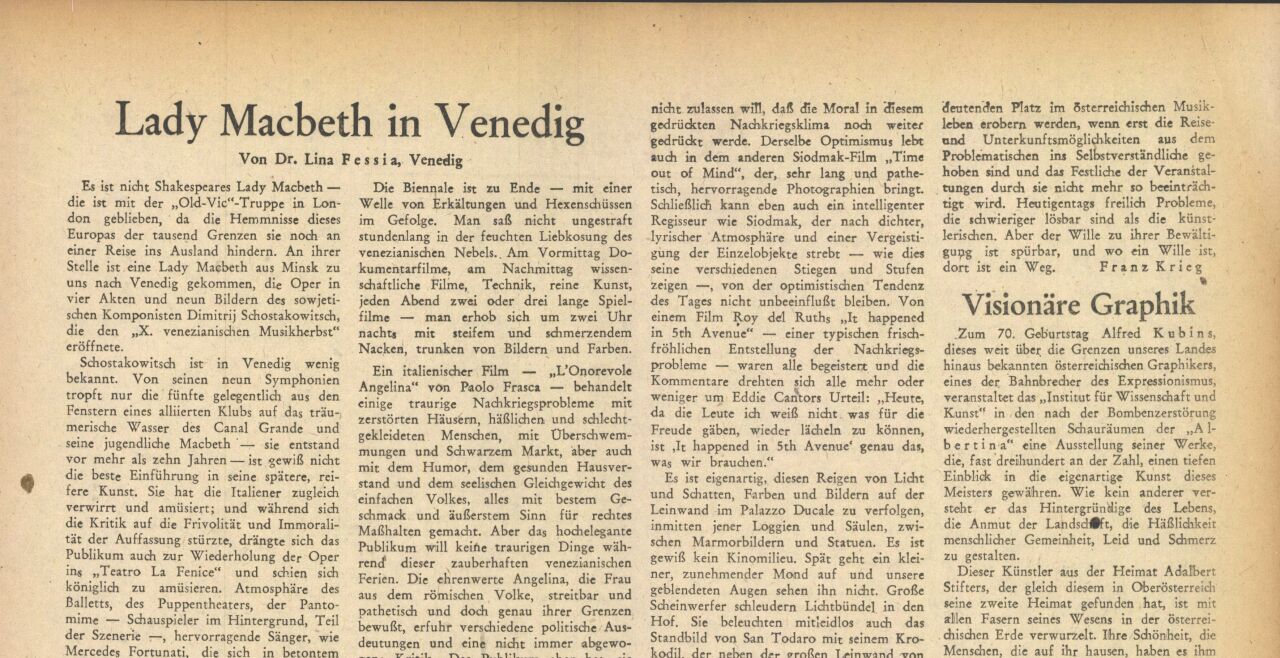
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Lady Macbeth in Venedig
Es ist nicht Shakespeares Lady Macbeth — die ist mit der „01d-Vic“-Truppe in London geblieben, da die Hemmnisse dieses Europas der tausend Grenzen sie noch an einer Reise ins Ausland hindern. An ihrer Stelle ist eine Lady Macbeth aus Minsk zu uns nach Venedig gekommen, die Oper in vier Akten und neun Bildern des sowjetischen Komponisten Dimitrij Schostakowitsch, die den „X. venezianisdien Musikherbst“ eröffnete.
Schostakowitsch ist in Venedig wenig bekannt. Von seinen neun Symphonien tropft nur die fünfte gelegentlich aus den Fenstern eines alliierten Klubs auf das träumerische Wasser des Canal Grande und seine jugendliche Macbeth '— sie entstand vor mehr als zehn Jahren — ist gewiß nicht die beste Einführung in seine spätere, reifere Kunst. Sie hat die Italiener zugleich verwirrt und amüsiert; und während sich die Kritik auf die Frivolität und Immorali-tät der Auffassung stürzte, drängte sich das Publikum auch zur Wiederholung der Oper ins „Teatro La Fenice“ und schien sich königlich zu amüsieren. Atmosphäre des Balletts, des Puppentheaters, der Pantomime — Schauspieler im Hintergrund, Teil der Szenerie —, hervorragende Sänger, wie Mercedes Fortunati, die sich in betontem metrischem Takt auf der Bühne bewegen: kurz ein Triumph des Rhythmus und der dioreographischen Vollendung.
Die Musik erscheint jedem, der sie mit genügender Unbefangenheit zu betrachten vermag, als ein äußerst fragmentarisches und stilistisch heterogenes Mosaik. Ist es die unbewußte Enthüllung künstlerischer Einflüsse, Kennzeichen jedes Jugendwerks — oder eine bewußte Parodie der großen musikalischen Tradition von Seiten eines modernen Technikers und voll von lichtsprühenden Illusionen? Niemand, scheint sich das gefragt zu haben. Gelegentlich hörte man murmeln: „Das ist Wagner... Strauß ... Mussorgskij...“, und an einer Stelle ertönte plötzlich eine vierstimmige Fuge von reinstem hindemithianischem Wasser. Doch all das war mit einer erstaunlichen, alle verblüffenden Könnerschaft in das große Meer volkstümlicher Melodien und Rhythmen getaucht. So wurde die Erfindungsgabe des Komponisten gelobt und das Fehlen einer echten dichterischen Kraft — der „poesia pura“, Wunschbild der italienischen Kritik in den letzten dreißig Jahren — sowie das Fehlen einer lebendigen Wärme beklagt, die auch auf der seelischen Ebene jenes Geflecht von Verbrechen rechtfertigen würde, die auf der Bühne nahezu ungestört abrollen.
Bei der zweiten Aufführung der Oper senkte sich über einige Szenen plötzlich der Vorhang. Als G. B. Shaw sich einst in der Vorrede zu „Mensch und Übermensch“ darüber beklagte, daß jedes Verbrechen auf der Bühne dargestellt werden könne, aHein die Liebe nicht, da dachte er gewiß nicht, daß einmal für einen Abend die altehrwürdige Bühne des Fenice vor einem Publikum von zwanzig Nationen eine mehr als reichliche Portion roher und realistischer Liebe zur Schau stellen würde — unter dem alleinigen zarten Schleier eines langsamen Erlöschens der Lichter.
So ist Lady Macbeth vorübergegangen und das Publikum drängt sich jetzt zu den Konzerten zeitgenössischer Musik, drängt sich zu den Erstaufführungen der Filme im Hof des Palazzo Ducale und drängt sidi auch am Strande des Lido, dessen Umrisse am frühen Morgen ganz in den weichen Septembernebel gehüllt sind.
Für den, der aus Österreich, aus den Bergen Tirols kommt, scheint Venedig fürwahr einer anderen Welt anzugehören. Die Luft ist schwer und feucht und alles bewegt sich langsam und mit überlegter Grazie. Niemand hat Eile: langsam fahren die Schiffe der übriggebliebenen republikanischen Marine ein, während Schwärme von Segelbooten gegen den Wind kreuzen. Die Sprachen aller Nationen der Welt begegnen einander auf den Dampffähren. Die Venezianer beobachten mit Reserve. Die Venezianer sind ja so alt und nichts kann sie mehr in Erstaunen setzen. Durch Jahrhunderte inmitten dieser überirdisdien Schönheit aufgewachsen, wissen sie, daß jeden September die Lagune fast violett wird und jede Farbe in einen zarten Nebelschleier gehüllt ist. Ej ist der Monat der großen Maler der venezianischen Schule, der Musiker, der Dichter und nun, nach einer Pause von sechs Jahren, auch der Mo-rut der Regisseure und des Films.
Die Biennale ist zu Ende — mit einer Welle von Erkältungen und Hexenschüssen im Gefolge. Man saß nicht ungestraft stundenlang in der feuchten Liebkosung des venezianischen Nebels.. Am Vormittag Dokumentarfilme, am Nachmittag wissenschaftliche Filme, Technik, reine Kunst, jeden Abend zwei oder drei lange Spielfilme — man erhob sich um zwei Uhr nachts mit steifem und schmerzendem Nacken, trunken von Bildern und Farben.
Ein italienischer Film — „L'Onorevole Angelina“ von Paolo Frasca — behandelt einige traurige Nachkriegsprobleme mit zerstörten Häusern, häßlichen und schlechtgekleideten Menschen, mit Überschwemmungen und Schwarzem Markt, aber auch mit dem Humor, dem gesunden Hausverstand und dem seelischen Gleichgewicht des einfachen Volkes, alles mit bestem Geschmack und äußerstem Sinn für redites Maßhalten gemadit. Aber das hochelegante Publikum will keine traurigen Dinge während1 dieser zauberhaften venezianischen Ferien. Die ehrenwerte Angelina, die Frau aus dem römischen Volke, streitbar und pathetisch und doch genau ihrer Grenzen bewußt, erfuhr verschiedene politische Ausdeutungen und eine nicht immer abgewogene Kritik. Das Publikum aber hat sie sogleich vergessen, als es fröhlich zu einem amerikanischen Film, von J. M. Stahl, zu „Leave her to Heaven“ überging, der mit den unfehlbaren Elementen des Erfolges ausgestattet ist, mit schönen Frauen, schönen Kleidern, schönen Häusern, schöner Landschaft in unglaubwürdigen Farben, einer Gerichtsszene und einem äußerst primitiven psychologischen Hintergrund.
Die üblichen Naivitäten des amerikanischen Films fehlten auch nicht an dem Abend, der Kurt Siodmak, dem König der psychischen Sensationen, einem deutschen Emigranten und Vertreter der „deutschen psychologischen Schule“, gewidmet war. Langsam und weitschweifig arbeitet dieser Regisseur mit von Anbeginn festgelegten Situationen, so daß es keine echte innere Handlung gibt und jede Entwicklung die Langeweile und die Unerbittlichkeit einer mechanisierten Welt in sich trägt. So etwa in dem Film „The Strange Affair of Uncle Harry“, in dem der pathologische Fall einer krankhaften Geschwisterliche äußerst langsam, doch entschieden zur Katastrophe führt. Das Ende bringt dann eine komische Umkehrung der Situation im optimistischen Sinn, da sich alles als ein wüster Traum entpuppt mit der Bitte, „erzählen Sie das Ende ihren Freunden“, die jeden Verehrer des künstlerischen Films erschaudern läßt. Doch scheint es, daß dieser Abschluß von der Zensur verlangt wurde, die nicht zulassen will, daß die Moral in diesem gedrückten Nachkriegsklima noch weiter gedrückt werde. Derselbe Optimismus lebt auch in dem anderen Siodmak-Film „Time out of Mind“, der, sehr lang und pathetisch, hervorragende Photographien bringt. Schließlich kann eben auch ein intelligenter Regisseur wie Siodmak, der nach dichter, lyrischer Atmosphäre und einer Vergeistigung der Einzelobjekte strebt — wie dies seine verschiedenen Stiegen und Stufen zeigen —, von der optimistischen Tendenz des Tages nicht unbeeinflußt bleiben. Von einem Film Roy dl Ruths „It happened in 5th Avenue“ — einer typischen frisch-fröhlichen Entstellung der Nachkriegs-problemc — waren alle begeistert und die Kommentare drehten sich alle mehr oder weniger um Eddie Cantors Urteil: „Heute, da die Leute ich weiß nicht, was für die Freude gäben, wieder lächeln zu können, ist ,1t happened in 5th Avenue' genau das, was wir brauchen.“
Es ist eigenartig, diesen Reigen von Licht und Schatten, Farben und Bildern auf der Leinwand im Palazzo Ducale zu verfolgen, inmitten jener Loggien und Säulen, zwischen Marmorbildern und Statuen. Es ist gewiß kein Kinomilieu. Spät geht ein kleiner, zunehmender Mond auf und unsere geblendeten Augen sehen ihn nicht. Große Scheinwerfer schleudern Lichtbündel in den Hof. Sie beleuchten mitleidlos auch das Standbild von San Todaro mit seinem Krokodil, der neben der großen Leinwand von dem Kapitell seiner Säule und dem weiten Atem der Bucht von San Marco träumt. Vielleicht kehrt er nie mehr dorthin zurück; er ist zu alt und gebrechlich geworden. Im Sommer 1945 haben wir in diesem Hof einen Zyklus Beethovenscher Symphonien gehört. Damals war noch alles in Unordnung; neben San Todaro war da Colleoni auf seinem Pferd und der Markuslöwe, der auch von seiner Säule auf der Piazetta herabgestiegen war. Ruhig standen sie inmitten der Zuhörerschaft. Gegen Mitternacht ging der riesige Vollmond über dem Bleidach auf und die Ostfassade des Hofes wurde plötzlich ganz weiß und lebendig und strahlend. Es glänzten die Riesen oben auf der Treppe, es glänzten die seltsam schlanken, schmalen und länglichen Fenster mit ihren vollendeten Proportionen des „Veneto Fiorito“, der venezianischen Frührenaissance.
Jetzt ist alles vom Licht überschwemmt und jeden Abend leben Schatten und Phantasmen auf dem großen Wandschirm ihr rasch vergängliches Leben. Bald aber werden die Festwochen vorüber sein. Der große weiße Wandschirm wird verschwinden und in den Herbstnebeln wird in einem Winkel nur mehr San Todaro stehen und von seiner Säule auf der Piazzetto träumen, von dem smaragdenen Grün von San Giorgio Maggiore, von den fernen Inseln und von der Terra ferma, von seinem im Nebel am Horizont versdiwundenen Reich.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!