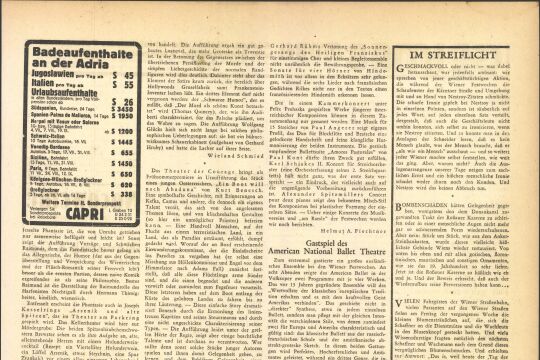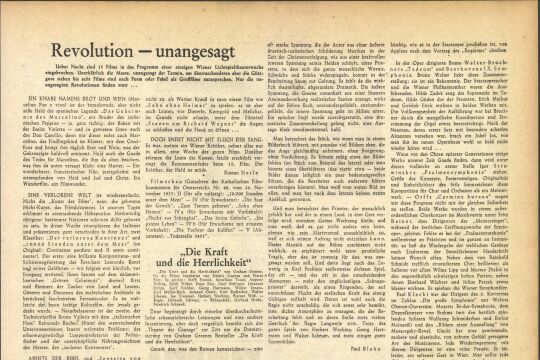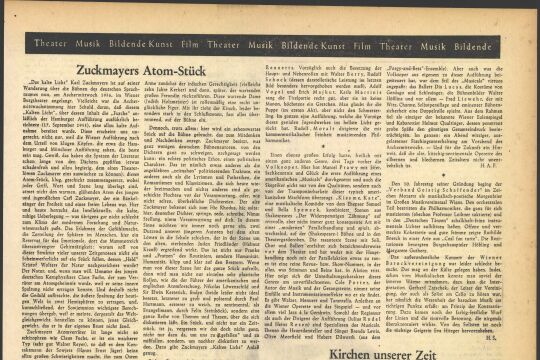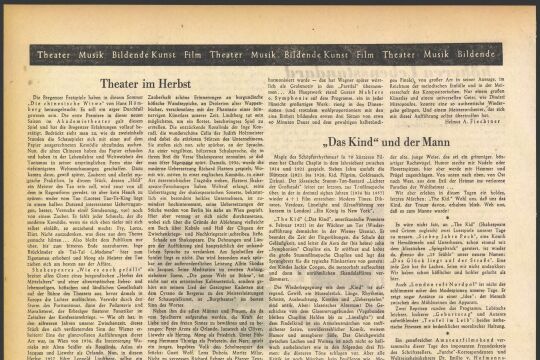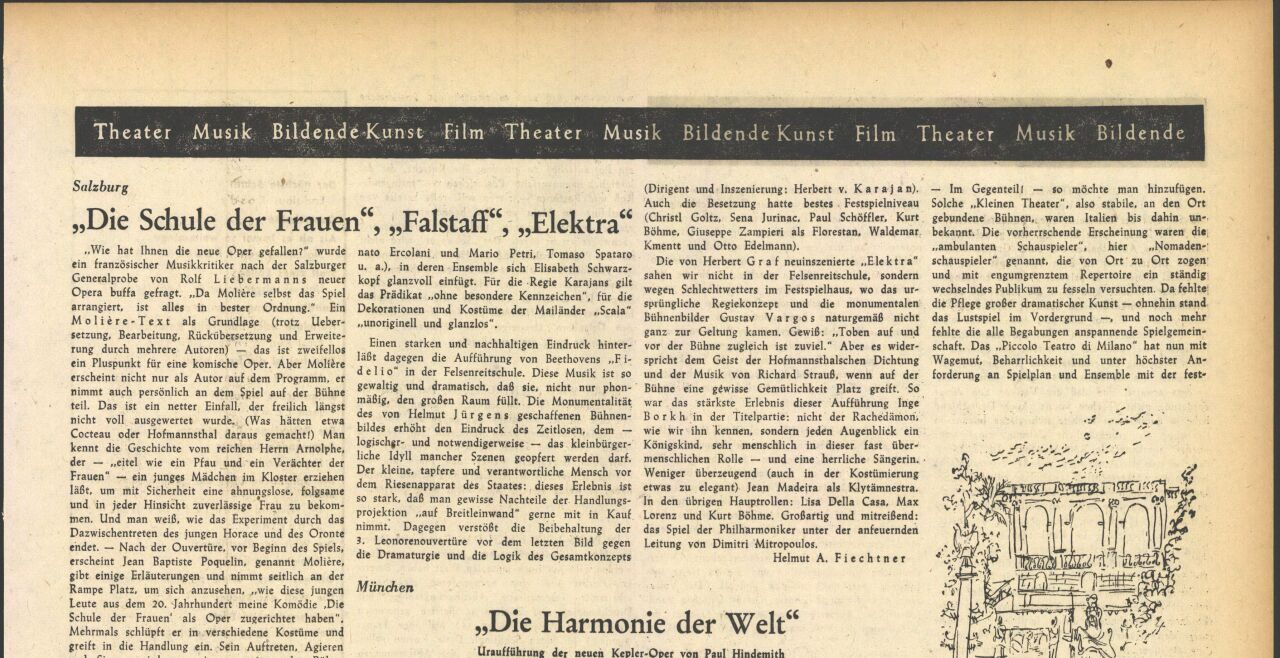
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
„Die Schule der Frauen”, „Falstaff”, „Elektra”
„Wie hat Ihnen die neue Oper gefallen?” wurde ein französischer Musikkritiker nach der Salzburger Generalprobe von Rolf Liebermanns neuer Opera buffa gefragt. „Da Moliėre selbst das Spiel arrangiert, ist alles in bester Ordnung.” Ein Moliere-Text als Grundlage (trotz Ueber- setzung, Bearbeitung, Rückübersetzung und Erweiterung durch mehrere Autoren) — das ist zweifellos ein Pluspunkt für eine komische Oper. Aber Moliėre erscheint nicht nur als Autor auf idem Programm, er nimmt auch persönlich an dem Spiel auf der Bühne teil. Das ist ein netter Einfall, der freilich längst nicht voll ausgewertet wurde. (Was hätten etwa Cocteau oder Hofmannsthal daraus gemacht!) Man kennt die Geschichte vom reichen Herrn Arnolphe, der — „eitel wie ein Pfau und ein Verächter der Frauen” — ein junges Mädchen im Kloster erziehen läßt, um mit Sicherheit eine ahnungslose, folgsame und in jeder Hinsicht zuverlässige Frau zu bekommen. Und man weiß, wie das Experiment durch das Dazwischentreten des jungen Horace und des Oronte endet. — Nach der Ouvertüre, vor Beginn des Spiels, erscheint Jean Baptiste Poquelin, genannt Moliėre, gibt einige Erläuterungen und nimmt seitlich an der Rampe Platz, um sich anzusehen, „wie diese jungen Leute aus dem 20. Jahrhundert meine Komödie ,Die Schule der Frauen’ als Oper zugerichtet haben”. Mehrmals schlüpft er in verschiedene Kostüme und greift in die Handlung ein. Sein Auftreten, Agieren und Singen wird von einem zweiten, der Bühne gegenüber, in der Mittelloge placierten Orchester begleitet, das aus drei Holz- und fünf Blechbläsern besteht. Das „große” Orchester vor der Bühne entspricht in seinem Umfang etwa dem der „Ariadne” und ist mit ähnlicher kammermusikalischer Diskretion behandelt. Rolf L i h e r n? a n n hat mit dieser Partitur (die vor zwei Jahren für Amerika geschrieben und für die Salzburger Festspiele stark erweitert wurde) eine feine und originelle Arbeit geliefert. Das Orchester, dessen Klangfarbe durch den häufigen Gebrauch des Cembalos ein reizvolles altertümliches Timbre erhält, klingt apart, differenziert und durchsichtig. Die Singsfimmen werden nie zugedeckt und auch bei der Begleitung vier- und sechsstimmiger Ensemblesätze sind Orchester- und Singstimmen deutlich hörbar. Deklamation und rhythmische Begleitung sind von großer Variabilität, was man von der Harmonik nicht behaupten kann. Dagegen ist Liebermanns Partitur völlig frei von Grobheiten und Banalitäten. Dafür sind wir dankbar, denn daran kranken die meisten komischen Opern deutschsprachiger Provenienz. — Die leichte und sichere Hand des Komponisten.-zeigt -sich auch bei. der. Führung der Singstimmėn. Hier gibt es sängerisdh-virtuose Paradestücke, die dazu beitragen werden, dem neuen Werk den Weg zu vielen Bühnen frei zu machen. Etwa die parodistische Verzweiflungsarie der Agnes an der (vermeintlichen) Leiche ihres Horace oder das Schlußsextett sind „Schlager” im besten Sinn.
Erfreulich, daß dieses leichte und gefällige ‘Stück in die richtigen Hände kam. Wie fein O. F. Schuh als Spielleiter arbeitete, sah man schon daraus, daß er die einzige Figur, die das Ganze hätte zur Posse vergröbern können, nämlich die tölpelhafte Bediente Georgette, marionettenhaft stilisierte. Der Regisseur zeigt immer wieder Sinn für Witz und Parodie. Nur die umwerfende Komik der Agnes kam am Anfang nicht deutlich heraus. Auch begreift man nicht, weshalb sich die diversen Textautoren die Glanzpartie der Agnes-Partie, das Vorlesen der Ehemaximen, haben entgehen lassen. Aber dies nur am Rande. — Die Bühnenbilder Caspar Nebers, halbdurchsichtig, pastellfarben, leicht, wie aus dem Reich der Mitte (die Franzosen sind ja die Chinesen des Westens) und beweglich, gehören zum Reizendsten, das man sich vorstellen kann, und passen vorzüglich zu Möllere und zu Liebermanns eklektischer Musik. Unter der Leitung von George Szell spielten und sangen: Walter Berry und Kurt Böhme, Anneliese Rothenberger und Nicolai Gedda, Christa Ludwig und Alois Pernerstorfer. Eine wahre Glanzbesetzung.
Im Schlußsextett heißt es: „Voulez-vous donner de 1 esprit ä une sötte. — Enfermez-la!” Auf die Musik das Wort des Beaumarchais anwendend, könnte man variierend sagen: „Debarassez-la de la Dodekaphonie.” Denn Rolf Liebermann hat hier, unseres Wissens zum ersten Male, nicht in Zwölftontechnik geschrieben. Und es ist ihm gut bekommen.
An der Spitze der Mozartaufführungen dieses Jahres steht ohne Zweifel Günther Rennerts Inszenierung von „Figaros Hochzeit”. Das unübertreffliche Solistenensemble Dietrich Fischer- Dieskau, Elisabeth Schwarzkopf, Irmgard Seefried, Erich Kunz, Christa Ludwig und das Orchester der Wiener Philharmoniker wird von Dr. Karl Böhm mit hinreißender Verve und eleganter Leichtigkeit geleitet. Ita Maximo w n a schuf zauberhaft schöne pastellfarbige Bühnenbilder und reizende Kostüme, so daß auch — was auf unseren Bühnen so selten Ist — vom Optischen her kein Wunsch offenbleibt.
Von der gleichen Vollkommenheit des Singens und Musizierens ist auch die Aufführung von Verdis „Falstaff” unter der Leitung Herbert von K a- r a j a n s mit Künstlern der Mailänder „Scala” (Tito Gobi, Giulietta Simionato, Rolando Fanerai, Anna Maria Canali, den beiden Charakterdarstellern Renato Ercolani und Mario Petri, Tomaso Spataro u. a.), in deren Ensemble sich Elisabeth Schwarzkopf glanzvoll einfügt. Für die Regie Karajans gilt das Prädikat „ohne besondere Kennzeichen”, für die Dekorationen und Kostüme der Mailänder „Scala” „unoriginell und glanzlos”.
Einen starken und nachhaltigen Eindruck hinterläßt dagegen die Aufführung von Beethovens „Fidelio” in der Felsenreitschule. Diese Musik ist so gewaltig und dramatisch, daß sie, nicht nur phonmäßig, den großen Raum füllt. Die Monumentalität des von Helmut Jürgens geschaffenen Bühnenbildes erhöht den Eindruck des Zeitlosen, dem — logischer- und notwendigerweise — das kleinbürgerliche Idyll mancher Szenen geopfert werden darf. Der kleine, tapfere und verantwortliche Mensch vor dem Riesenapparat des Staates: dieses Erlebnis ist so stark, daß man gewisse Nachteile der Handlungsprojektion „auf Breitleinwand” gerne mit in Kauf nimmt. Dagegen verstößt die Beibehaltung der 3. Leonorenouvertüre vor dem letzten Bild gegen die Dramaturgie und die Logik des Gesamtkonzepts (Dirigent und Inszenierung: Herbert v. Karajan). Auch die Besetzung hatte bestes Festspielniveau (Christi Goltz, Sena Jurinac, Paul Schöffler, Kurt Böhme, Giuseppe Zampieri als Florestan, Waldemar Kmentt und Otto Edelmann).
Die von Herbert Graf neuinszenierte „Elektra” sahen wir nicht in der Felsenreitschule, sondern wegen Schlechtwetters im Festspielhaus, wo das ursprüngliche Regiekonzept und die monumentalen Bühnenbilder Gustav Vargos naturgemäß nicht ganz zur Geltung kamen. Gewiß: „Toben auf und vor der Bühne zugleich ist zuviel.” Aber es widerspricht dem Geist der Hofmannsthalschen Dichtung und der Musik von Richard Strauß, wenn auf der Bühne eine gewisse Gemütlichkeit Platz greift. So war das stärkste Erlebnis dieser Aufführung Inge Borkh in der Titelpartie: nicht der Rachedämori, wie wir ihn kennen, sondern jeden Augenblick ein Königskind, sehr menschlich in dieser fast übermenschlichen Rolle — und eine herrliche Sängerin. Weniger überzeugend (auch in der Kostümierung etwas zu elegant) Jean Madeira als Klytämnestra. In den übrigen Hauptrollen: Lisa Della Casa, Max Lorenz und Kurt Böhme. Großartig und mitreißend: das Spiel der Philharmoniker unter der anfeuernden Leitung von Dimitri Mitropoulos.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!