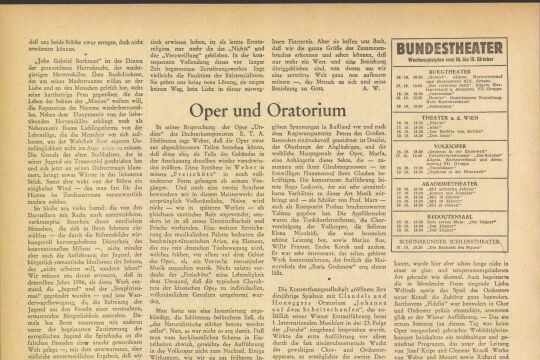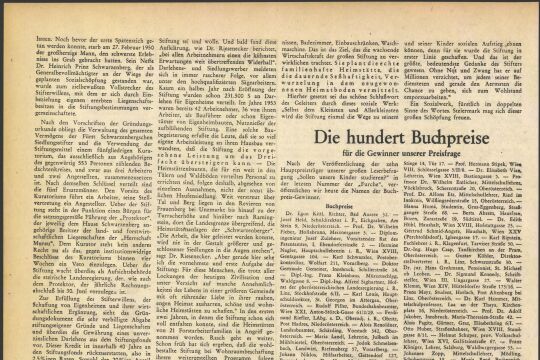Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Großes Opernfest in München
Glanz und Besonderheit können den Münchner Opernfestspielen nur aus einer beharrlichen, künstlerisch beispielhaften und dokumentarisch informativen Pflege des Schaffens von Richard Strauß erwachsen. Die Veranstalter wissen das Sie bieten dem Besucher neben dem traditionellen Festkonzert „in memoriam“ sieben Bühnenwerke des Meisters, nämlich „Feuersnot“ und „Josephslegende“ an einem Abend, den „Rosenkavalier“, „Salome“, „Die Frau ohne Schatten“, „Daphne“ und „Capriccio“; zum Teil in exemplarischen Aufführungen. Die Einmaligkeit einer solchen Uebersicht verleiht München neben Bayreuth und Salzburg das Odium des Besonderen. Damit will der Schreiber allerdings nicht sagen, daß er das Gesamtwerk von Strauß für festspielwürdig hält. Die Theaterleistung der Bayerischen Staatsoper — als Ganzes gesehen — macht in diesem Falle das Festspiel aus.
Mehr noch als das Werk Wagners unterliegt dasjenige von Strauß einem Verschleiß, der aus erheblichen Vorbehalten unserer Zeit gegenüber der musikalischen Mystifizierung höchst diesseitiger erotischer Vorgänge herrührt. Man nehme die polemisch gemeinte „Feuersnot“, das zweite Bühnenwerk Straußens: was für unerträgliche Gleichungen sind da in Ernst von Wolzogens Text wie auch in der Musik aufgestellt. Nicht genug, daß der Komponist sich selber andeutungsweise als einen „Zauberer“ ins Spiel bringt — zu Unrecht übrigens, denn dieses Singgedicht entbehrt des Zaubers der Inspiration —, nicht genug auch, daß das musikalische Pathos hier mit dem Volkslied in eine ganz unleidliche Verbindung gebracht ist: am Ende wird mit gewaltigem Getöse gar eine banale Verführungsszene zur lichtvollen Sternkunde der Kunst erkoren. Rührend ist, wie Strauß Distanz zu seinem in Text und Musik beschworenen Lehrmeister Wagner zu gewinnen sucht, ohne daß es ihm gelänge. Eine Delikatesse war das Bild von Max Bignens — Giebelhäuser mit vorwitzigen Nasen, Augen und Mündern, denen die Klatschsucht im Gemäuer geschrieben stand, erzählten eine traumhafte Geschichte. Regisseur Herbert Graf dagegen verstopfte die Szene mit Chormassen und bedeutete ihnen ohne nennenswerten Erfolg, Fröhlichkeit zu mimen. Auch musikalisch hatte die Aufführung — mit Rudolf Kempe am Pult — nicht das zu fordernde Format. Das war eher bei der .Josephs-legende“ gegeben, die Heinz Rosen choreographisch sehr . überzeugend eingerichtet hatte. In Natascha Trofimowa, Inge Berti und Heino Hall-huber standen ihm Solokräfte von internationalem Rang zur Verfügung. Gemessen an den deutschen Ballettverhältnissen hatte der Abend Seltenheitswert. Auch Jean Pierre Ponnelles Ausstattung war phanta-sievaliv wenngleich nidtrselw'gediegim — doch letztere Mtt ntschuldbar ,beifc*esem Su%t Dagegen hätte, Rudolf Kempe den bombastischen Schwulst der Musik verfeinern können, wenn er sein Musikanten-tum nicht nur effektbewußt, sondern auch klangkorrigierend einzusetzen verstünde.
Wir können jetzt - so angebracht es wäre — Fritz Riegers Leistung nicht dagegenhalten, denn das hieße Mozarts „Entführung aus dem Serail“ auf eine Stufe mit der „Josephslegende“ stellen. Dennoch: was Rieger an feinziselierter Ausarbeitung der instrumentalen Partien — das Staatsorchester spielte so schön wie an keinem anderen Tag—, an kammermusikalischer Delikatesse, an sensibler Abtönung bot,-das war schlechthin überragend. Schade nur. daß er zeitweise die Bühne vergaß, so daß einige Ensembles aus den Fugen zu geraten drohten ... Ungeachtet dieses Mankos möchten wir Salzburg darauf aufmerksam machen, daß hier in Nachbarschaft — Rieger ist bekanntlich Chef der Münchner Philharmoniker — offenkundig ein Mozart-Sachverständiger par excellence wirkt. Erika Köth hatte nicht ihren besten Tag und war trotzdem als Constanze großartig. Ende des Festspiels. Alles andere war nämlich in verschiedenen Graden furchtbar — war Klamauk, Forcieren, Einfalls- und Stillosigkeit.
Die Münchner Mozart- und Wagner-Tradition in Ehren, aber Festspiele werden nun einmal nicht von geschichtlichen Verdiensten, sondern einzig von stets erneuerten Leistungen großer Persönlichkeiten wachgehalten. Es ist doch ziemlich sinnlos, dem zugegebe-nerweise nicht glücklichen Bayreuther „Tristan“ aus der Regiehand Wolfgang Wagners eine exponierte Münchner Inszenierung entgegenzusetzen — es handelte sich um die Eröffnungsvorstellung der Festspiele —, wenn die Voraussetzungen zu unverkennbar eigenem Profil fehlen. Rudolf Hartmanns Regie war belanglos, in einigen Situationen nicht einmal geschickt. Wie der Experte der Strauß-Szene die psychologischen Beziehungen zwischen den Handelnden derart vernachlässigen konnte, ist schwer verständlich. Joseph Keilberth wurde mit Ovationen ausgezeichnet, was aus den Umständen im Zusammenhang mit seiner soeben erfolgten Berufung zum Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, zu erklären sein mag. Mit den Bühnenbildern von Emil Preetorius müßten wir uns ausführlich auseinandersetzen: sie verrieten nicht die gewohnte Sicherheit dieses großen Szenikers, eher einen Hang zum unfruchtbaren Versuch. Ludwig Suthaus ließ als Tristan darstellerisch und gesanglich mehr Wünsche offen, als selbst an einer kleineren Bühne nachzusehen wären; Josef Metternich (Kurwenal) und Walter Kreppel (König Marke) sangen makellos, bekamen die Figuren aber nicht in den Griff. Nur Hertha Töpper als Brangäne wuchs vor allem im zweiten Akt zu großem Wagner-Format, das Martha Mödl als Isolde selbstverständlich hat — aber sie hat es eben hier wie in Bayreuth, wie in Hamburg oder anderenorts.
Der gute Ruf, der der Münchner Aufführung des „Julius Caesar“ von früheren Festspieljahren her anhaftet, bestätigte sich im großen und ganzen aufs neue. Das Publikum jubelte vor allem der als Cleopatra faszinierend aussehenden Lisa Deila Casa zu. Der Chronist hat ihre Salzburger Arabella soeben als schlechthin vollendet apostrophiert — so darf er einwenden, daß ihre Stimmkraft zur idealen Gestaltung der Händel-Partie zumindest an diesem Abend nicht in vollem Maße ausreichte. Erstmalig haben die Münchner Festspiele in diesem Jahre wieder ihr klassisches Gesicht, das der Genius loci geprägt hat: die „Tristan-Neuinszenierung verwies auf die in München erfolgte Uraufführung des Werkes, die „Feuersnot“ in München spielend und atmosphärisch ganz dieser Stadt verhaftet, konnte wohl überhaupt nur hier noch einmal gezeigt werden. Das Cuvillies-Theater endlich, in dem Mozarts „Entführung“ sowie die „Hochzeit des Figaro“ und Strauß' „Capriccio“ aufgeführt werden, ist gleichsam Bestandteil und Ausgangsort der Rokoko-Ausstellung, die den Besucher schönheitstrunken entläßt: die Zeit der Kellertheater scheint nun vorbei — man feiert wieder Feste in Gold und Stuck. Ist es Gewinn?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!