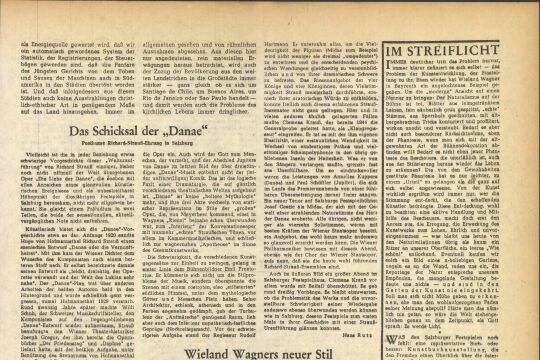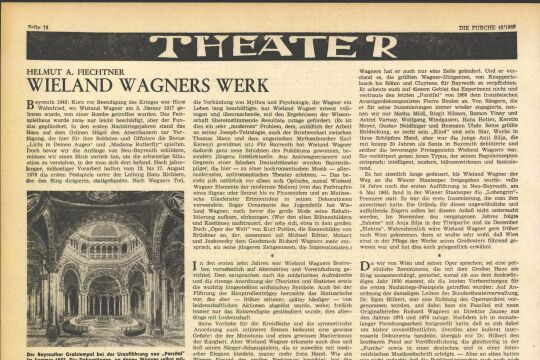Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Wagner und Straub in der Staatsoper
Der „Tristan“ gilt uns nicht nur als Wagners vollkommenstes Werk, er nimmt auch in der gesamten Opernliteratur einen besonderen Platz ein. Wagner stößt darin bis an die äußersten Grenzen des Ausdrucksfähigen vor und steigt in die untersten Tiefen des Gefühls und des Seelischen. Raffinierteres und Komplizierteres wurde freilich nach dem „Tristan“ noch geschrieben, aber nichts Größeres und Einheitlicheres in der Art. Wagner selbst glaubte, daß er in dieser Oper seine Theorien vom Musikdrama und Gesamtkunstwerk am vollkommensten verwirklicht hat. Uns will scheinen, als hätte er — überwältigt von einem Stoff, der das kongruenteste Gefäß für eine einmalige seelische Situation und Stimmung war — seine Theorien und Spekulationen nirgends so weit hinter und unter sich gelassen, wie in diesem Werk.
Wagners theoretische und autobiographische Schriften — diese etwas verschwommenen und steifen Rechtfertigungsversuche — sind ein Kapitel für sich und haben dem Verständnis der Wagnerschcn Musik mehr geschadet als genützt. Sie haben, neben einer Reihe von mißverständlichen Textstellen (König Heinrichs „deutsches Schwert“ und Hans Sachsens gemütlichpatriotische Auslassungen gehören hierher), Wagners Opern in eine schiefe Situation gebracht. Denn wie kaum ein anderes Werk ist das Wagners zweidimensional und hat jene „doppelte Optik“, von der Nietzsche einmal spricht. An seine äußere Schicht — die germanisch—mythologischen Stoffe und den hochgemuten pathetisch - heroischen Ton — hielt sich die vergangene Zeit und reklamierte Wagner für sich. Dringt man zum Kern des Werkes vor, so findet man den „anderen Wagner“: den großen Pessimisten und Leidenden, den Weltflüchtigen und Erlösungssüchtigen, dem das Ich Täuschung und der Tod Befreiung bedeutet und der in Schopenhauers Philosophie seine letzte Rechtfertigung und Bestätigung fand. Wagners Werk wurzelt aber doch auch in romantisch-christlichem Geist, und sowohl der „Fliegende Holländer“ als auch „Tannhäuser“ und „Parsifal“ können als Erlösungsopern bezeichnet werden.
Als Wagner den Tristanstoff ins Auge faßte, schwebte, ihm „etwas Italienisches, Melodiöses und lyrisch Sangbares“ vor, mit wenigen Personen, leicht aufzuführen. Was dabei herauskam, war der „Tristan“, dieses faszinierende, vieldeutige Werk, das nicht nur an die Hörer, sondern auch an die Ausführenden höchste Anforderungen stellt. Aus der Welt des Tages führt der zweite Akt in das weite, dunkle Reich der Nacht. Tm letzten Aufzug schwindet fast jeder reale Bezug, die Athmosphäre wird immer dünner, geistiger; die Musik immer transparenter und löst sich am Schluß „in des Weltatems wehendem All“. Es ist auch bezeichnend, daß Wagner dies Werk in einer gleichsam . vornationalen Sphäre spielen läßt, in der altenglische, normannische und französische Elemente seltsam gemischt sind.
Von ähnlichen Betrachtungen — von der Schale zum Kern vordringend — hätte auch eine Neueinstudierung und Neuinszenierung einer Wagneroper in unserer Zeit auszugehen, indem sie sich vom konventionellen Aufführungsstil der Wagneropern nach Möglichkeit befreit und eine Inszenierung „aus dem Geiste der Musik“ anstrebt. Sie hätte sich gleichermaßen auf die Gestik und das Bühnenbild zu erstrecken und dort anzuknüpfen, wo Gustav Mahler und Roller die Fäden liegenließen. Die Aufführung der Staatsoper war — auch wenn sie in diesem Sinne manchen Wunsch offen ließ — eine sehr gute Gesamtleistung. Dies ist um so mehr anzuerkennen, wenn man die schwierigen akustischen Verhältnisse berücksichtigt, die besonders deutlich bei einem Werk zutage treten, das eine große Orchesterbesetzung verlangt. Professor Krips ist ein guter Operndirigent, der sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Besetzung gemeinsam mit dem Spielleiter Josef Witt eine Aufführung zustande brachte, die der Tradition der Wiener Staatsoper würdig war.
Die „Salome“ von Richard Strauß wurde vor 40 Jahren an der Dresdener Hofoper uraufgeführt und war eine Sensation. Ein ungewöhnlicher Stoff und niegehörte harmonische und instrumentale Effekte lassen uns die Wirkung gut verstehen, die das Werk damals ausübte. Fragen wir uns, was heute davon geblieben ist! Zunächst der Text. Es ist kein sehr erfreuliches und ansprechendes Sujet, das sich Oskar Wilde gewählt hat, aber es entstand unter den Händen des großen englischen Ästheten und Eklektikers ein Werkchen, das in der Geschlossenheit des Stils und der Eindringlichkeit, mit der ein psycho-pathologischer „Fall“ behandelt wird, auf seine Art vollkommen ist. Wilde brachte gleidisam von Haus aus jene „natürliche“ Uberfeinerung und Morbidezza mit, die ihn für diesen Stoff prädestinierten. Auf diesen Text nun stürzte sidi der Musiker Strauß mit einem wilhelminischen Orchester und allen Errungenschaften einer neuen Harmonik und Orchestertechnik. Aus dem Kammerspiel macht Strauß eine „große Oper“, was bei Wilde nur angedeutet ist, wird breit ausgeführt und illustriert: das Theater kommt voll und ganz zu seinem Recht; und mehr als das — es dominiert. Gerade diejenigen Stellen, die zu den musikalisdien Glanzstücken der Oper zählen (Salomes Verführungsszenen und Tanz sowie die Partie des Johanaan) empfinden wir heute als peinlich und stillos. Peinlich ist es zum Beispiel, wenn man an der großen Dreivierteltakt-steile im Tanz der Prinzessin von Judäa vor dem Tetrarchen (im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung!) in fataler Weise an den Valse triste von Sibelius erinnert wird und wenn wir die Partien des Jochanaan als das erkennen, was sie bei Strauß sind: Theater und Pose. Und gerade diese Rolle, aus der die Stimme einer anderen Welt spricht, wünscht man sich gehaltvoller, edler, zum mindesten stilvoller. Hier aber sind die Grenzen nicht nur des Komponisten Strauß, sondern auch jeder „Charakterisierungskunst“. Die Gestalten der Salome, des Herodes und der Herodias mögen als „Fälle“ betrachtet werden. Bei Jochanaan ist das nicht möglich. Diese Gestalt müßte der Komponist erleben. Da er aber weder die einen stilvoll zu verwirklichen noch die andere erlebnismäßig zu gestalten vermag, bleiben wir unbefriedigt und im Zwiespalt. Wagners „Tristan“ ist viel weniger kompliziert und raffiniert, aber er ist von der ersten bis zur letzten Note erlitten und erlebt. Deshalb glaube ich, daß er die Straußsche Oper um viele Dezennien überleben wird.
Die Aufführung im Theater an der Wien, von Rudolf Moralt gewissenhaft einstudiert und mit Schwung dirigiert, steht und fällt mit der Titelpartie Mit ihrer stimmlichen Bewältigung ist nur der eine Teil der Aufgabe gelöst. Alle Haupt- und Nebenrollen waren in guten Händen. Spielleitung und Bühnebilder waren einwandfrei und konventionell, das Orchester ausgezeichnet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!