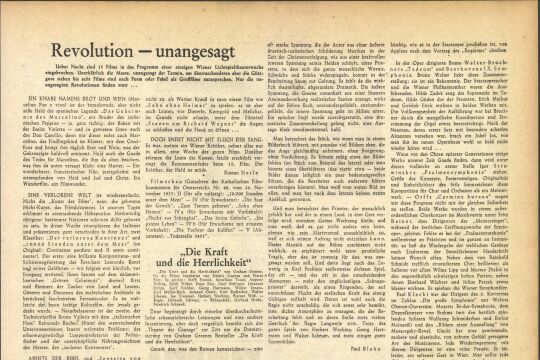Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der neue „Rosenkavalier”
Der Neuinszenierung des „Rosenkavalier” in der Staatsoper sah man nicht ohne Skepsis, nicht ohne Sorge entgegen. Denn die für die Wiener Erstaufführung am 8. April 1911 geschaffenen Bühnenbilder Alfred Rollers, die zuletzt 1967 beim Gastspiel in Montreal gezeigt wurden, sowie die Regie Wilhelm von Wyme- tals sind in Wien nicht nur „Tradition”, sondern waren auch von kaum überbietbarer Schönheit und Noblesse. Wer durfte es wagen, daran zu rühren? Und was die Musik betrifft: bestimmten da nicht, unter welchem Dirigenten auch immer, unsere Philharmoniker den Stil und den Klangcharakter der Wiedergabe? Und gab es keine dringlichere Aufgabe für die Staatsoper, als ein Werk neu auszustaffieren, mit dem ohnedies alle zufrieden waren?
Durch den Gesamteindruck, den wir von der Arbeit des Teams Otto Schenk, Rudolf Heinrich — Ernte Kniepert, Leonard Bernstein empfangen haben, sind alle diese Fragen keineswegs nur positiv beantwortet worden. Daß es ein interessanter Abend werden würde, stand außer Frage. Daß diese Neuinszenierung notwendig und geglückt ist — keineswegs…
Dabei mag gerne konzediert werden, daß jeder der an dieser Premiere Beteiligten sich Gedanken über das zu Leistende gemacht hat und sein Bestes gegeben hat. Der Bühnenbildner Rudolf Heinrich zum Beispiel wollte einen stärkeren Kontrast zwischen dem Salon der Marschallin und dem Palais des Herrn von Faninal deutlich machen. Er tat es durch Verkleinerung des ersteren, der viel intimer und wärmer wirkt, sowie durch dessen gedämpft-noble Farben (Altgold und Grün), im Gegensatz zu dem weiißgoldenen barocken Prunk des weitläufigen Stadtpalais des neugeadelten Herrn von Faninal. Das war nicht nur in der Idee akzeptabel, sondern auch in der Ausführung schön und geschmackvoll (lediglich dem in den Mittelpunkt gerückten Alkoven können wir diese Prädikate nicht zuerkennen). Daß sich dann im dritten Akt das Vorstadtbeisel in eine Pratergrottenbahn verwandelte, geht wohl auf Rechnung der Regie Otto Schenks, der sich in den ersten beiden Akten ziemlich eng an seine großen Vorbilder gehalten hat (er hätte auch nichts besseres tun können).
Von der Wiener Kritik wurde allgemein die „Verjüngung” der beiden Hauptrollen, der Feldmarschallin und des Ochs, gepriesen. Abgesehen davon, daß Christa Ludwig und Walter Berry dem Jugendalter bereits entwachsen sind (wie ihre Vorgänger), sehen wir darin keinen unbedingten Vorteil. Hingegen haben beide ihre Partien prächtig gesungen. Was der ersteren an Persönlichkeit fehlt, um die Marschallin glaubhaft zu machen und ihr unsere Teilnahme zu sichern, kann füglich nicht von ihr gefordert werden. — Die junge Engländerin Gwyneth Jones war sowohl als Oktavian wie als Mariandl ganz reizend, Reri Grist als Sophie ein wenig zu puppenhaft, Erich Kunz als Faninal wirklich amüsant, Margarita Lilowa und Murray Dickie (Annina und Valzacchi) sowie Emmy Loose und Harald Pröglhöf (Duenna und Haushofmeister) vom Regisseur gut geführt und in bester Spiellaune. — Leider wurden die positiven Elindrücke, die man von den ersten beiden Akten empfing, durch den viel zu grob und possenhaft dargebotenen letzten Akt sehr gedämpft. Bereits das Drum und Dran nach der Verwundung des Ochs im zweiten Akt, bei dem Schenk agieren läßt, als handle es sich um einen Mord in einer Meyerbeer- Oper, ließ Schlimmes befürchten. Aber was er an ärgerlicher Turbulenz und an Grottenbahneffekten im Vorstadtbeisel aufbot, war schon jenseits des guten Geschmacks.
Am Dirigentenpult stand Leonard Bernstein, der Star des Abends, der sich diese Oper, die er noch nie dirigiert hat, als zweite Wiener Premiere (nach dem Verdi- schen „Falstaff”) wünschte. Sichtbar und hörbar mehr mit dem Orchester als mit den Sängern auf der Bühne beschäftigt, hat der amerikanische Dirigent die „Entschlackungskur”, der seit 1951 die Partituren Wagners unterzogen werden, nun auch mit der „Rosenkiavalier”-Musik vorgenommen. Sie klingt unter Bernsteins Leitung heller, nuancierter, vielfarbiger, zuweilen greller und heftiger, als wir es gewohnt sind. Bernstein schlägt zuweilen ein besorgniserregend stürmisches Tempo ein. das er unmittelbar darauf, man weiß nicht immer warum, plötzlich zurücknimmt, can in Wohllaut zu schwelgen. Audi in der Dynamik liebt er den plötzlichen Wechsel und zeigt eine Vorliebe für Details — auch was die orchestralen Mittelstimmen betrifft. Dabei werden die Singstimmen zwangsläufig oft zugedeckt. Routine und gepflegte Langeweile gab es an diesem Abend jedenfalls nicht.
Zum zweitenmal dirigierte während dieser Saison im Abonnementzyklus der Wiener Philharmoniker ein zeitgenössischer Komponist ein eigenes Werk: als österreichische Erstaufführung hörten wir Leonhard Bernsteins 1965 vollendeten und ur- aufgeführten Chichester Psalms in drei Sätzen für gemischten Chor, Knabensolo, Streicher, Blechbläser und Schlagwerk. Nach einem kurzen feierlichen Introitus kommt zunächst, auf den Text „Jauchzet dem Herrn, alle Lande”, ein tanzartig bewegtes Allegro, das mit seinen Synkopen und dem flotten Bläsersatz sehr amerikanisch klingt, etwa wie eine Chorszene aus „Porgy and Bess”. Hierauf folgt ein pastorales Andante mit Solostimme (der fromme Hirtenknabe David), das vom Männerchor jäh unterbrochen wird; zum Abschluß: ein nicht nur sehr simpler, sondern auch allzu süßer und gefälliger Chorsatz („Sieh, wie das schön, wie das lieblich ist…”), dessen subjektive Ehrlichkeit nicht an- gezweifelt werden soll. Der Wiener Jeunesse-Cohr und ein Sängerknabe waren die Ausführenden, die unter Bernsteins temperamentvoll-an- feuernder Leitung das populäre, für das allsommerlich stattfindende Chorfestival in der Kathedrale von Cichester geschriebene Werk wirkungsvoll und sehr zum Gefallen des Pubikums aufführten. — Zur Eröffnung hatte Bernstein Mozarts Konzert für Klavier und Orchester G-Dur gespielt und vom Flügel aus dirigiert: sehr natürlich, sehr sentimental, mit viel Charme sowohl als Solist wie als Orchesterleiter. Freilich hat er sich da auch ein ganz bezauberndes Werk ausgesucht, weniger virtuos und dramatisch als lyrisch-idyllisch. Den 2. Teil des Programms bildete Schumanns Symphonie Nr. 2. C-Dur, die der Referent wegen einer anderen Verpflichtung nicht mehr hören konnte.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!