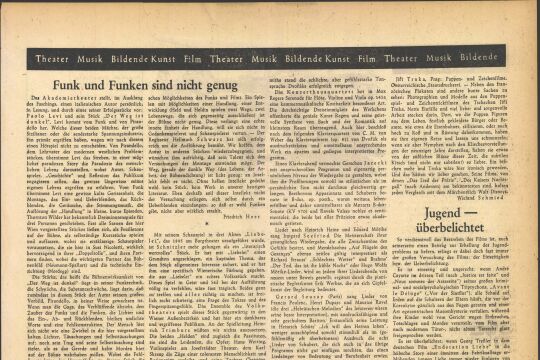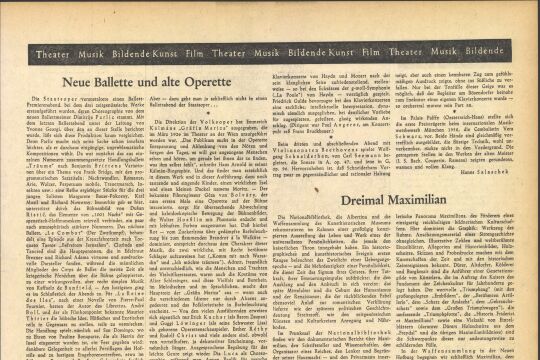Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Maderna-Konzert, Gulda-Jubiläum
In dem — durchaus französischen — Programm des 3. Konzertes im Zyklus „Meisterwerke des 20. Jahrhunderts" (Symphoniker, Jeunesse- Chor unter Leitung von Bruno Maderna) nahmen die drei Stücke aus „Les Choėphores“ von Darius Milhaud einen besonderen Rang ein. Nicht nur, daß man in Wien zum ersten Male mit dieser Komposition konfrontiert wurde; man spürte, daß man hier der griechischen Tragödie in ihrem furchtbaren Ernst näher war als in mancherlei anderen Versuchen. Der rhythmisierte Sprechgesang, von einer Stimme (der Chorführerin) übertönt, wirkt in dieser Art überzeugender als alle gesungenen Melismen. Das Orchester verwendet nur Schlaginstrumente. Im Mittelteil schweigen auch diese, eine Sopranstimme hebt über sechsstimmigen A-cappella-Chor ergreifend zu singen an. Es ist Elektras Totenopfer für Agamemnon. Sprechende un'd singende Solistin war Gerlinde Lorenz, stimmlich und ausdrucksmäßig von Eindringlichkeit und Größe. Exakteste Disziplin (ebenfalls im Sprechen und Singen) erwies der Jeunesse-Chor, der seine enorm schwierige Aufgabe vorbildlich meisterte. — „Der Tod des Sokrates“, das ist der Schlußteil des symphonischen Dramas „Socrate“, von Erik Satie, hier ebenfalls erstmalig gehört, ist eine vergleichslose Komposition. Satie hat den Text aus Platos Dialogen ausgewählt und die Übersetzung von Victor Cousin benützt. Jeder Überschwang ist vermieden, der eigenartig deklamatorische Stil bleibt nüchtern und sachlich. Der Zugang zu diesem Werk ist nicht leicht, obwohl Pierre Mollet seine schöne Baritonstimme voll und leuchtend ein'setzte, blieb eine gewisse Magerkeit bestehen und war nicht zu überwinden. — Maurice Ravels Orchestersuite „Daphnis und Chloe“, endlich einmal ganz aufgeführt, war dagegen voller Leben und Fülle, im raffinierten Orchesterklang ebenso wie im melodischen und tänzerischen Duktus.
Heinz Wallberg dirigierte das 8. Konzert im Bruckner-Zyklus (Tonkünstlerorchester). Im ersten Teil spielten als Solisten die jungen Damen Mitsuko Uchida und Sissy Weißhaar Joh. Seb. Bachs Konzert für zwei Klaviere und Streicher, C-Dur, und machten ihre Sache verblüffend gut und sicher. Klar in Anschlag und Stimmenführung, plastisch in der Durchführung der großen Fuge, lösten sie ihre Aufgabe, technisch zumindest, virtuos. Das Orchester begleitete animiert und unterstützte das solistische Versprechen. Nach der Pause hingegen setzte es alle Kräfte und Disziplin ein in der Wiedergabe von Anton Bruckners 7. Symphonie. Wallberg hat die Tonkünstler zu einer staunenswerten Leistungshöhe gebracht, das Riesenwerk war in der Interpretation steigerungsmäßig gut aufgebaut, in den einzelnen Sätzen charaktermäßig richtig fundiert und in der Gesamtwirkung von Brucknerscher Kraft. Unebenheiten und dunkle Stellen waren wohl da, manches blieb am Äußeren haften, der große Atem schien da und dort auszugehen, aber alles wurde doch wieder überbrückt durch die Begeisterung der Ausführenden, die sich dem Publikum mitteilte.
Eigenartig war auch das Programm, das der Wiener Schubertbund in seinem Konzert vorlegte. Im ersten Teil wurden drei Chöre — Mozarts „Dir, Seele des Weltalls", Schuberts „Wer ist groß?“ und „Gesang der Geister über den Wassern“ — von den Zwischenaktmusiken zu „Rosamunde“ von Schubert umrahmt. Leider sind diese Zwischenaktmusiken nicht sehr bedeutend und auch von den Chören nur der letztere, der „Gesang der Geister“, der zu den besten Chören nicht nur Schuberts gehört. Die Wiedergabe des achtstimmigen Chorsatzes war gut akzentuiert, die instrumentale Begleitung (tiefe Streicher) blieb manches schuldig. Der zweite Teil des Programms bestand in der Uraufführung des Oratoriums „Der Turmbau zu Babel“ von Heinrich Gattermeyer. Ein aus Bibelworten von Erich Benedikt und Walter Sachers zusammengestellter Text war für einen Sprecher, einen Solisten (Bariton), Frauenchor, Männerchor und großes Orchester in Musik gesetzt worden. Diese Musik, in ihrem Duktus von Hindemith und Strawinsky herkommend, aber durchaus eigenständig (ohne sehr persönlich profiliert zu sein), ist geschickt, stellenweise raffiniert und sehr wirksam gesetzt, Steigerungen sind gut vorbereitet und tun ihre Wirkung. Allerdings trennt der Sprecher die einzelnen Teile fast in Nummern, was sie struktiv nicht sind. Axel Wüstenhagen war ein vorzüglicher Sprecher, Rudolf Katz- böck ein Bariton, wie man sich ihn nur wünschen kann, mit schöner, gut geführter Stimme. Der Frauenchor der Wiener Singakademie sowie das Orchester der Wiener Symphoniker hatten große, nicht leichte Aufgaben zu bewältigen. Das Werk wurde verstanden und begeistert aufgenommen, der Komponist konnte für ehrlichen Beifall danken.
Franz Krieg
Am vergangenen Mittwoch gab Friedrich Gulda im Großen Musikvereinssaal einen Soloabend. Im ersten Teil spielte er „mit gewohnter Meisterschaft“, wie man hier wohl einmal sagen darf, Mozarts Sonate A-Dur KV 331 und Beethovens Sonate op. 111. Darnach folgte ein Zyklus von Debussy- Stücken: „Toccata“, „La puerta del vino“, „Terrasse des audiences au clair de lune“ und „Feu d’artifice“.
— Bevor er den zweiten Teil begann, wandte sich Gulda an das zum großen Teil aus jungen Leuten bestehende Publikum und sagte: Vor genau 20 Jahren habe er sein erstes Konzert in diesem Saal gegeben, und auch das „Feuerwerk“ von Debussy habe er damals gespielt. Der Anzug, den er anhatte, nannte er seinen „Jubiläumsanzug“: enge schwarze Jacke mit grauer Weste und Krawatte. • - Aber was nach Debussy kam, konnte er vor 20 Jahren noch nicht gespielt haben: es waren eigene Kompositionen: ein Variationenwerk mit Jazzelementen, hierauf ein Stück, dessen Titel unverständlich war, und zum Schluß einen „Neuen Wiener Walzer“ von bedeutenden Dimensionen, wobei Gulda von einem Schlagwerker und einem Kontrabassisten assistiert wurde, welche letztere auch mit größeren virtuosen Soli hervortraten. Mit gutem Grund hatte Gulda vor seine eigenen Kompositionen einen Debussy-Zyklus gestellt (den er mit zauberhaften instrumentalen Farben ausstattete), denn den französischen Impressionisten verdankt er als Schaffender am meisten, und zwar nicht nur in der Harmonik. Auch sein Wiener Walzer ist näher bei Ravels „Vaisęs nobles et sentimentales“ als bei Johann Strauß. — Ein sehr bescheidenes Jubiläumskonzert, was die äußere Form (lies Formlosigkeit) betrifft, die im umgekehrten Verhältnis zum Gebotenen stand. Fast hatte es den Anschein, als sei Gulda im Augenblick ein wenig isoliert in Wien. Aber ob man ihm was anderes wünschen soll?
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!