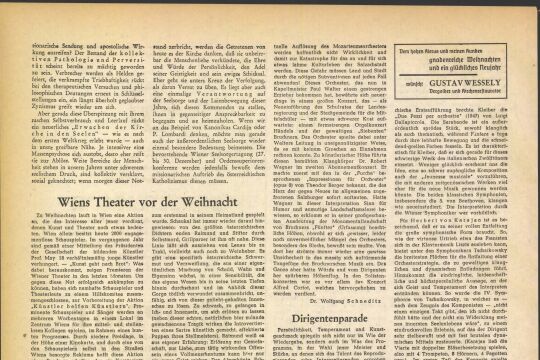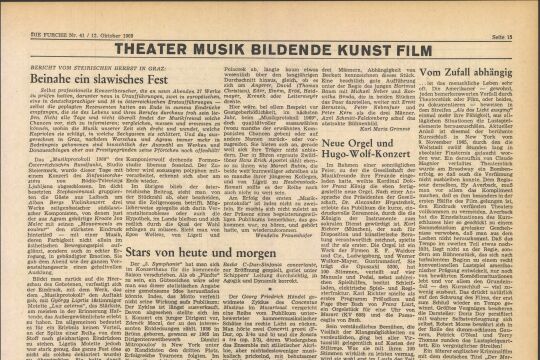Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Werk und Wiedergabe
Im zweiten Konzert des Zyklus „Die große Symphonie“ spielten die Wiener Symphoniker unter Leitung von Charles Münch Schuberts 5. Symphonie (B-Dur) und Beethovens Sechste (Pastorale), dazwischen mit der Solistin Edith Peinemann das 1. Konzert für Violine und Orchester, op. 19 von Serge Proko- fieff, das nicht nur Mittelpunkt des Programms, sondern auch Höhepunkt der Leistung war. Edith Peinemann hat das an technischen Schwierigkeiten reiche Werk nicht nur im Virtuosen, sondern auch ini Geistigen mit einem Elan interpretiert, den man mit Bewunderung zur Kenntnis nahm. Die Komposition gibt der Geige, was ihrer ist, aber nicht ohne weiteres. Seinen lyrischen Grundton voll klingen zu lassen, bedarf es einer seelischen Kraft und Zartheit zugleich. Prokofieff hat das selbst unterstrichen, da er das Soloinstrument niemals mit dem Orchester überdeckt. Schuberts Symphonie wurde mit löblicher Absicht aus dem „Hausmusikalischen“ herausgehoben, Beethovens „Pastorale“ in allen Details wohlausgewogen musiziert. Charles Münch macht alles genau und architektonisch klar. Etwas mehr Wärme wäre freilich erwünscht gewesen. F. K.
Im Großen Saal des Konzerthauses dirigierte Robert Heger das Orchester des österreichischen Rundfunks, Studio Wien. Drei Meisterwerke des 20. Jahrhunderts (wie der Titel dieses Zyklus lautet) standen auf dem Programm: Hindemiths dreiteilige
Symphonie „Mathis der Maler“, „Vier letzte Lieder“ von Richard Strauss und Regers Mozart-Variatio- nen op. 132. — Auch wer nicht die Modellaufführung des Hindemith- Werkes vor einigen Jahren im gleichen Saal durch das Philadelphia Symphony Orchestra unter Ormandy gehört hat, mußte die Wiedergabe am vergangenen Freitag als unbefriedigend empfinden. Zu dieser Welt altfränkisch«1 Stimmungen und lodernder Emotion ein scheint dem Dirigenten der Zugang versagt, und dem Orchester fehlte es sowohl an Präzision wie an Intensität. Wesentlich besser gelang die Begleitung der Strauss-Gesänge, obwohl sie zuweilen ein wenig zu massiv geriet. — Die Überraschung des Abends hieß
Christiane Sorell, die mit tadelloser Technik und natürlichem, nie opern- haftem Ausdruck den überaus schwierigen Sopranpart interpretierte: eine neue Strauss-Sängerin mit einer flexiblen Stimme von angenehmstem Wohllaut.
Uber den russischen Meistercellisten Mstislav Rostropowitsch ist während der vergangenen Woche bereits alles Anerkennende unid Rühmende geschrieben worden, das man über einen Interpreten sagen kann (auch an dieser Stelle, in Nr. 45 der „Furche“). Sein zweiter und letzter Abend in Wien war der anspruchsvollste. Das Konzert begann mit der 2. Sonate von Brahms, bei deren Vortrag der ausgezeichnete Partner am Flügel Alexander Dedjuchin leider nur als Begleiter fungierte. Rostropowitsch spielt Brahms weniger lyrisch und dramatisch als sensibel, zuweilen hypemervös (wobei einige falsche Pizzicato-Töne nicht zu überhören waren). Merkwürdig unruhig wirkte auch J. S. Bachs große Solosuite c-Moll. Am besten gelang die erst 1965 entstandene und Rostropowitsch gewidmete „Suite für Cello allein“ von Benjamin Britten: ein technisch und formal gleicherweise interessantes und fesselndes Werk. Besonders in dem die drei ersten Sätze einleitenden und dem letzten sie beschließenden rhapsodischen „Canto“ erlebte man Augenblicke tiefster Meditation und eines monologischen Musizierens, das den „äußeren Rahmen“ eines großen Konzertsaales vollkommen verschwinden ließ — Schostakowitschs Sonate d-Moll aus dem Jahr 1932 zählt nicht zu den bedeutendsten Werken des Komponisten, ermangelt aber trotzdem nicht der Substanz und gibt dem Soloinstrument, was ihm gebührt — diesem merkwürdigen Instrument, das in der tiefen Lage grunzt und oben quietscht, dem aber Rostropowitsch ganz neue Klangregister abzugewinnen versteht und dessen Ton er, oft fast bis zur Unkenntlichkeit, veredelt.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!