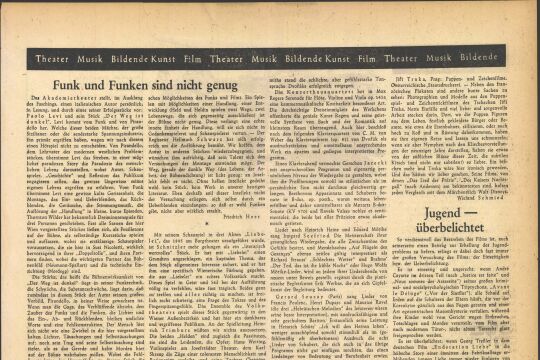Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Parade der Sngerinnen
Gemeinsam mit ihrem Gatten, dem Bariton Thomas Stewart, konnte man Evelyn Lear in den Solopartien von Johannes Brahms' Deutschem Requiem hören. Während Stewart immerhin — bei aller Gepflegtheit der Stimme — etwas blaß blieb, war man von Stimme und Gestaltungskraft Evelyn Lears sehr beeindruckt, wenn auch das rein Lyrische (woran das Werk so reich ist) nicht so voll ausgeschöpft wurde als das zu dramatischeren Akzenten Neigende. Darin wurde sie allerdings durch die Auffassung des Dirigenten, Carl Melles, unterstützt, der dem ganzen Werk einen mehr tragischen als tröstenden Impetus gab, im übrigen jedoch Solisten, Chor und Orchester (Singakademie und Symphoniker) zu einer einheitlichen und lebendigen Wiedergabe inspirierte.
Im Zyklus „Das Volkslied“ sangen Emmy Loose und Kurt Diemann Volks-Uedbearbeitungen von Beethoven für eine oder zwei Stimmen und ein kleines In-strumentar (Walter Weller, Violine, Ludwig Beinl, Violoncello, und Eric Werba, Klavier). In den Zyklus paßte das Programm nicht ganz, denn die Fassungen ¥r *i4> internationalen Volkslieder sind wenig inspiriert und nur als Gelegenheitsarbeit Beethovens aufzufassen. Die schlichte Leuchtkraft des Volksliedes geht dadurch verloren, die Gesänge stehen zwischen Volks- und Kunstlied und vermögen weder im einen noch im anderen Sinn überzeugend zu wirken. Sie bedingten (und erfuhren auch) eine Glätte der Wiedergabe, die nur in einigen wenigen Liedern, wie dem Tiroler Jjdler „I mag die net nehma“, durch die enorme (vorbildlich bewältigte) Schwierigkeit in der Führung der Stimme stärker fesselte. Damit ist bereits gesagt, daß stimmlich alles in Ordnung war. Das gilt ebenso für die Instrumentalisten.
Erika Köth sang ausgewählte Lieder von Mahler, Pfitzner und Richard Strauss. Die von der Oper her bekannte Sängerin hat Stimme, Kultur, Ausdrucksfähigkeit und ehrliches Bemühen — alles von hervorragender Qualität. Dennoch zündete der Funke erst bei den Gesängen von Richard Strauss, die wohl dem Naturell der Sängerin am nächsten liegen. Bei den übrigen Liedern war man irgendwie verwundert, weil eine gewisse Kühle nicht überwunden werden konnte, die bei Pfitzner allerdings (im Gegensatz zu Mahler) nicht leicht zu überwinden ist.
Ausgewählte Lieder von Franz Schubert und Hugo Wolf sang Christa Ludwig und schenkte uns einen der vollkommensten und wertvollsten Liederabende seit langem. Die große warme Stimme mit ihrem Reichtum an Ausdrucksvarianten ist bis ins kleinste beherrscht, biegsam wie ein Rohr und doch stets voller Fülle, den ganzen erstaunlichen Umfang durch von prächtiger Leuchtkraft. Dazukommt der Respekt vor jeder einzelnen Note, die Kenntnis ihrer Bedeutung und der Respekt vor dem Text, der den ganzen Abend lang in jedem Wort klar verständlich blieb. Daß Phrasur und Atemtechnik souverän bewältigt werden, macht auch die Intensität der Deutung möglich, die ohne gestische Hilfsmittel bis zur Erschütterung wirkte („Der Tod und das Mädchen“, „Der König in Thüle“ usw.). Sie trifft den Balladenton ebenso sicher als die Hymne und den dramatischen Aufschwung; ein Kleines weniger den rein lyrischen Bogen. Der Beifall wollte kein Ende nehmen und erzwang Zugaben. Eric Werba war hier und ebenso bei den anderen Liederabenden sicherer Begleiter und diskreter Führer, gelegentlich aber auch einmaliger pianistischer Virtuose.
Im letzten Konzert des vom Österreichischen Rundfunk, Studio Wien, veranstalteten Zyklus, „Wir stellen zur Diskussion“, kamen ausschließlich österreichische Komponisten zu Wort. Karl Rankl, zuletzt Chef der Covent Garden Opera, gehört der älteren Generation an. Mit den von ihm arrangierten und instrumentierten „Vier schottischen Liedern“ war der schätzenswerte Musiker nur als Bearbeiter — und recht schwach — vertreten. Auch der schön timbrierte, ausdrucksvolle Alt von Janet Baker kam kaum zur Entfaltung. Das alles war ein bißchen zu sehr „englisch unterspielt“. — Bemerkenswerte Unterspieler sind auch Fritz Leitermeyer, jener philharmonische Geiger, von dem man zu Beginn dieser Saison im Rahmen eines Philharmonischen Abonnementkonzerts ein interessantes Zwölfminutenwerk hörte, und Wilhelm Hübner, dessen erste, bald nach 1945 aufgeführten Kompositionen einen starken Eindruck hinterließen — und dessen Namen man kaum mehr auf einem Konzertprogramm begegnet. Das neue Werk von Leitermeyer ist ein Konzert für Violine und 21 Bläser. Von den drei knappen Sätzen ist der erste — in Sonatenform — am besten gelungen. Die Chaconne des zweiten Teils — eine schwierige und zur Langeweile tendierende Form übrigens — ist, trotz der Kürze des Satzes, nicht immer mit der /notwendigen.,' Spani,u,iuj,,.,.erfüJlL. .Das. Finale — in freier Rondoform — arbeitet wie die einleitende „Kadenz“ mit Quartenintervallen und ist recht wirkungsvoll. Technisch werden nicht nur an den Solisten (dessen Instrument Leitermeyer ja aus eigener Praxis bestens kennt), sondern auch an die' Bläser hohe Anforderungen gestellt, die von Walter Weller und den Mitgliedern des Rundfunkorchesters unter der Leitung von Prof. Hans Swarowsky nach besten Kräften erfüllt wurden. — Wilhelm Hübner bedient sich (ähnlich wie Theodor Berger oder Gottfried von Einem und im Unterschied zu Leitermeyer, der Zwölftonmusik schreibt) keiner bestimmten kompositorischen Technik. In seinem neuesten Werk, einem dreisätzigen 15-Minuten-Werk mit dem Titel „Sinfonia ritmica“, kommt — wie in früheren Stücken Hübners — der Dramatiker und der großes Orchester lautstark einsetzende Rhythmiker zum Vorschein, der eine sehr energische und charaktervolle (sehr unwienerische) Sprache spricht. — Vergleicht man diese beiden Stücke mit vielem, was man in den europäischen Musikzentren während der letzten Jahre bei den verschiedenen Festivals als Dernier cri zu hören bekommt, so kann man sagen, daß wir — allein mit diesen beiden Komponisten der mittleren Generation — nicht schlecht dastehen.
Selten noch hat man Bachs Chaconne aus der d-Moll-Partita, eines der schwierigsten Werke der Geigenliteratur, so scheinbar mühelos, mit solchei Sicherheit im Technischen gehört wie von dem französischen Geiger Christian Ferras im Großen Konzerthaussaal. Ideales Zusammenspiel mit dem Pianisten Pierre Bar-bizet war in Beethovens Frühlingssonate ebenso zu bewundern wie in Debussys (einziger) Sonate für Violine und Klavier von 1916/17, in der Havanaise von Saint-Saens (einem virtuosen Salonstück) und in Ravels „Tzigane“. Besonders den französischen Stücken kam das Auswendigspielen des Pianisten sehr zustatten, wodurch der Eindruck eines ganz reizenden Improvisando entstand. Ein so ausgezeichneter Geiger Christian Ferras ist — als Künstler vermag er kaum zu fesseln. Hinter den Noten ist nicht mehr als robuste Bürgerlichkeit.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!