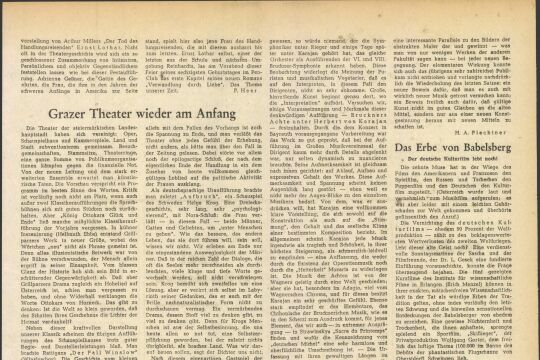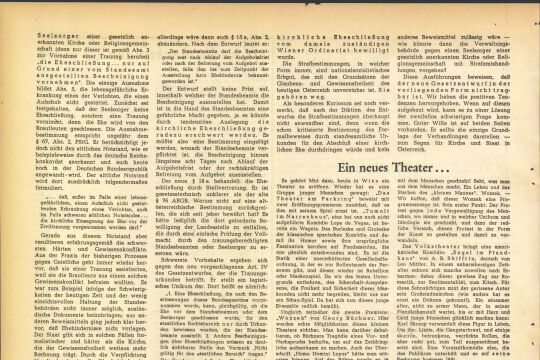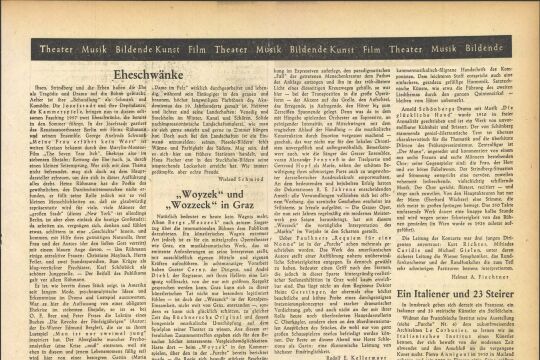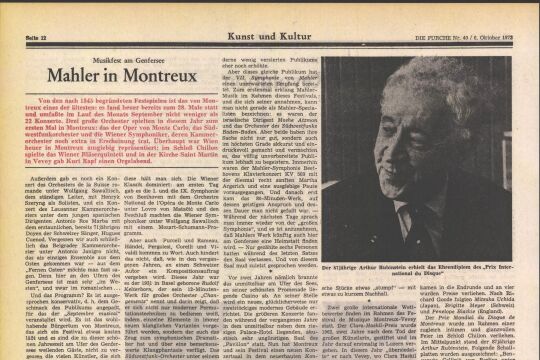Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Eine Konzertfestwoche
Zunächst eine pädagogische Vorbemerkung: Dieses letzte Konzert der Wiener Symphoniker im Zyklus I der Konzerthausgesellschaft, das in einer Voraufführung auch der „musikalischen Jugend“ zugänglich gemacht wurde, war einfach zu lang und überforderte die Aufnahmefähigkeit auch des bestgewillten, ausgeruhtesten Zuhörers. Seit Jahren schon bemüht sich die in Wien residierende Internationale Gustav-Mahler-Gesellschaft (und bezieht in diese ihre Bemühungen auch Anton Bruckner mit ein), daß von den großen, den umfangreichsten Werken der beiden Meister nur jeweils
eines aufs Programm gesetzt wird — und sonst nichts. Bedenkt man, daß
die Spielzeit eines normalen Konzerts durchschnittlich mit 90 Minuten kalkuliert wird, so ist diese Zeit bei den erwähnten Riesensymphonien voll und ganz ausgefüllt — wobei nichts dagegen spricht, zwischen den jeweils ersten Monumentalsätzen und den nachfolgenden eine kleine Pause zu machen. Warum geschieht das eigentlich nicht?
Die Wiener Konzerthausgesellschaft jedenfalls ist leider diesem auf zahlreichen Erfahrungen basierenden Rat nicht gefolgt und
schickte der rund 80 Minuten dauernden 5. Symphonie von Gustav Mahler noch die Ouvertüre zu Beethovens Schauspielmusik zu August von Kotzebues „Die Ruinen von Athen“ voraus, die er, seinen Teplit-zer Kuraufenthalt unterbrechend, für seine geliebten „Schnurrbarte“ in Budapest schrieb. Aber obwohl es sich um eine Gelegenheitskomposition handelt, dürfte man sie nicht so beiläufig spielen, wie es an diesem Abend geschah. Kein größeres amerikanisches, russisches öder englisches Orchester könnte sich das leisten. — Hierauf folgte eine bemerkenswerte Begegnung: die mit dem etwa 32jährigen Ernst Kovacic, der das Violinkonzert G-Dur von Mozart KV 216 spielte: mit fast brillanter Technik, schönem, aber nicht bezauberndem Ton, sorgfältiger Phrasierung und unüberhörbarer Musikalität. Trotz heftigen „Nachstimmens“ nach dem 1. Satz gab es im nachfolgenden Adagio kleine, aber störende, durch die verschiedene Höhe einzelner Töne bedingte Differenzen. Jedenfalls ist Kovacic ein sehr ernst zu nehmender junger Künstler, zumal er derzeit in seiner Heimatstadt kaum Konkurrenz hat.
Doch nun zum Helden des Abends, dem 1942 in der Nähe von Nancy geborenen Jacques Delacote. Man traute seinen Augen nicht recht, als er das Podium ohne Partitur betrat. Und die Überraschung durch das, was wir innerhalb der nächsten 78 Minuten hörten (dies ist die genau nach richtigen Tempi errechnete Gesamtdauer) war ebenso groß! Wie, so fragte man sich zunächst, kommt ein junger Franzose zu Möhler — und zu einer so werkgerechten Interpretation? Nun, Delacote war in den Jahren 1965 bis 1970 Meisterschüler von Professor Swarowsky, dem kompetenten Mahler-Kenner und Interpreten, und er hat mehrere Symphonien Mahlers, der ja — Gott sei Dank — während der letzten zehn Jahre geradezu in Mode gekommen ist, oft auf seinen Progarammen (mit dem London Symphony Orchestra zum Beispiel machte er Mahlers Zweite, mit dem Orchestre de Paris die Fünfte). Delacote „schaffte“ also nicht nur das Riesenwerk, und zwar, wie bereits erwähnt, ohne Partitur, sondern bot auch eine fast authentische Wiedergabe. Vielleicht, daß er manche Sätze, zumindest Einzelheiten, ein wenig verharmloste, so daß im ganzen der Eindruck entstand, es handle sich hier um ein eher „heiteres“ Werk. — Im heiklen Pizzi-cato-Trio des Scherzos gab es nicht die geringste Ungenauigkeit; aber muß die Solotrompete, die mit ihrem Signal den ersten Satz einleitet, so unschön heiser klingen? Hier wäre der Übergang — wenn auch nur für diesen Satz — zu einem anderen Instrumententyp sehr zu überlegen. „Wenn man oft gefragt wird, was denn in Mahlers merkwürdigen Symphonien vorgeht“ — schrieb nach der Wiener Uraufführung der laut Programm „federgewaltige“ Korngold — „so könnte die Antwort einfach lauten: Zwanzigstes Jahrhundert geht vor“. Ja, 20. Jahrhundert von 1904...
Zwei ebenso interessante wie erfreuliche Begegnungen danken wir dem Jeunesse-Chor und dem Mozarteum-Orchester, Salzburg, unter der Leitung von Günther Theuring. — Alexander von Zemlinsky (nur zwei Jahre älter als Schönberg, dessen Lehrer, dem dieser — nach seinen eigenen Worten — alles als Komponist verdankt) ist der Autor von einem halben Dutzend Opern und zahlreicher Chorwerke. Wir hörten, rein intoniert und vom Orchester, dessen einzelne Instrumente Eigenleben haben und doch die Singstimmen nie zudecken, den 13. Psalm: ein nobles 15-Minuten-Werk, das genau zwischen Mahler und Schönberg steht und dem man bald wieder zu begegnen wünscht. — Wie groß die Palette des amerikanischen Originalgenies Charles Yves ist (der übrigens im gleichen Jahr wie Schönberg geboren wurde), zeigten die „Drei Chöre“ mit den Titeln „General Booth betritt den Himmel“, „Serenity“ und „Circus Band“. Während sich in den beiden Eckstücken das Grotesk-Genie des musikalischen Draufgängers austobt, ist „Seelenruhe“ Zeugnis für einen so
intimen, ergreifenden Lyrismus, den wir Yves nicht zugetraut hätten. Den zweiten Teil des Programms bildete Händeis „Dettinger Te Deum“. Als Solisten wirkten mit: Rudolf Scholz, Orgel, Ingemar Korjus mit einem wunderbar timbrierten Baß und Wilhelm Heinrich, ein virtuoser Trompeter.
*
Vor der vollkommenen Leistung senkt der Kritiker mit Freuden den Degen: im Rahmen eines außerordentlichen Konzertes im selbstverständlich völlig ausverkauften Großen Musikvereinssaal sang Christa Ludwig zwei Zyklen von Gnstau-Mahler-Liedern und drei Gruppen von Hugo Wolf: aus den Mörike-Liedern, dem „Spanischen Liederbuch“ und vier Mignon-Lie-der aus „Wilhelm Meister“. Sie wählte die anspruchsvollsten, im Ausdruck schwierigsten, von meist elegischem, ernstem Charakter. — Nach diesem Abend, den Erik Werba als Begleiter und Betreuer am Bösendorfer-Flügel mitgestaltete), wagen wir die Behauptung, daß Christa Ludwig die derzeit beste Liedersängerin des deutschen Sprachraumes ist. — In ihrem noblen, mattgoldenen Kostüm von unverkennbarer Pariser Provenienz, ist sie schöner und interessanter als je zuvor. Die letzten Reste der Eierschalen, die vor Jahren dieses große Talent zu begrenzen schienen, sind von ihr abgefallen. Paris, die neue Umwelt, ist der Frau und der Künstlerin gleichermaßen gut bekommen. Geblieben ist der orphische Wohllaut . ihrer unvergleichlichen Altstimme, die sie — wie der dreimalige Fortissimo-Refrain des Goethe-Liedes „Kennst du das Land“ bewies — keineswegs zu „schonen“ braucht... Helmut A. Fiechtner
Im Palais Schwarzenberg überzeugte der finnische Flötist Tuomas Kaipainen mit Werken des flämischen, französischen und deutschen Barocks durch seine stupende Technik. Das Spielerische gelang besser und sicherer als die langsamen Sätze bei Loeillet de Gant, Georg Philipp Telemann und Händel. Die geringe Aussage bei den Variationen Jakob von Eycks ist in der Substanzarmut des Werkes gelegen, die sich über ein holländisches Volkslied ausbreitet. Der junge Meister seines Instrumentes (Renaissance- und Blockflöte) steht freilich noch dort in den Anfängen, wo der Ton des spröden Instrumentes sich in Musik verwandeln soll. Bis dorthin zeigt sich noch eine gar nicht so lange Wegstrecke* seiner Entwicklung, aber erst dann wird sich seine musikalische Begabung in vollem Umfang bestätigen. Über den unterschiedlichen Wert der vorgetragenen Stücke wäre der bekannte Satz zu variieren, daß auch im Baröckgold der Musik nicht alles Gold ist, was glänzt! — Der ausgezeichnete Techniker konnte sich auf eine gute Zusammenarbeit mit dem Gitarristen Seppo Siirola stürzen, der in den „Pieces breves“ von Frank Martin auch als Solist sein Können unter Beweis stellte. Gerne hätte man neben dem Schweizer Komponisten auch andere moderne Gitarremusik gehört, und der „Übergang“ der Blockflöte wäre sinnvoll ausgeglichen gewesen. Viel Applaus bedankte die beiden sympathischen jungen Finnen.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!