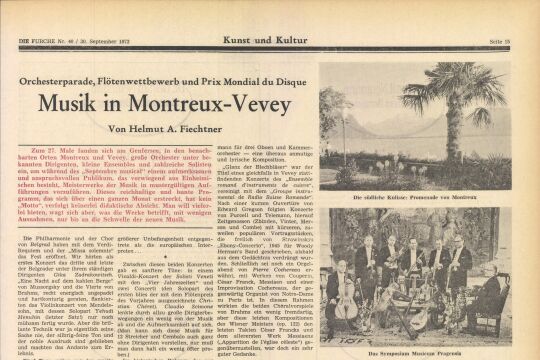Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Von Mozart bis Berio
Wien hatte eine Musikwoche, wie man sie sich öfter wünscht: gehaltvoll und interessant. An zwei Abenden gastierte im Großen Musikvereinssaal unter der Leitung von William Steinberg das berühmte Bostoner Orchester; im 7. Abonnementkonzert der Philharmoniker unter Horst Stein gab es eine Uraufführung; Peter Keuschnig präsentierte im Mozartsaal eines seiner interessanten Programme mit neuer Musik und hatte Cathy Ber- berian als Mitwirkende gewonnen; und auch beim Abend des Senegal- Balletts kam der Musikfreund voll und ganz auf seine Rechnung..
Wien hatte eine Musikwoche, wie man sie sich öfter wünscht: gehaltvoll und interessant. An zwei Abenden gastierte im Großen Musikvereinssaal unter der Leitung von William Steinberg das berühmte Bostoner Orchester; im 7. Abonnementkonzert der Philharmoniker unter Horst Stein gab es eine Uraufführung; Peter Keuschnig präsentierte im Mozartsaal eines seiner interessanten Programme mit neuer Musik und hatte Cathy Ber- berian als Mitwirkende gewonnen; und auch beim Abend des Senegal- Balletts kam der Musikfreund voll und ganz auf seine Rechnung..
Das Boston Symphony Orchestra wurde 1881 gegründet und hatte fol-, gende ständige Dirigenten: Arthur Nikisch, Karl Muck, Pierre Monteux, Serge de Kussewitzky, Charles Münch und Erich Leinsdorf. Seit zwei Jahren ist William Steinberg sein „Direktor”. Er stammt aus Köln und war in führender Stellung in seiner Heimatstadt, in Prag, Frankfurt, in Palästina, New York und zuletzt in Buffalo tätig. — Ein Blick auf die Namensliste der Orchestermitglieder erweckt den Eindruck, daß man es mit einem durchaus „europäischen” Klangkörper zu tun hat. Das bewies dann auch die Interpretation der „Linzer Symphonie”, C-Dur, von Mozart, mit der Steinberg sein Programm eröffnete. Echtes Verständnis, Ruhe und richtige Tempi zeichneten diese Interpretation aus, die nur klanglich etwas dick geriet, was wohl vor allem darauf zurückzuführen ist, daß Dirigent und Musiker an größere Säle gewöhnt sind. — Bei der VII. Symphonie von Gustav Mahler hingegen klang alles deutlich und transparent. In dem selten gehörten Riesenwerk, das fast 80 Minuten dauert (Steinberg schaltete nach dem ersten Satz eine große Pause ein), bewunderte man die aparte, von höchster Meisterschaft und einem überaus sensiblen Ohr bestimmte Instrumentierung, und man müßte ein ganzes Register aufstellen, um alle jene wunderbaren Dinge zu vermerken, die es da zu bewundern gab, besonders im ersten Satz und in den beiden Noc- tumi. Das Finale ist Mahler ein wenig lärmend geraten und klingt nach Schostakowitschs Zehnter. Steinberg ist ein feiner Musiker, der es sich leisten kann, das Orchester mit lockerem Zügel zu lenken. Wie Knappertsbusch läßt er es gern ein wenig allein musizieren, ist aber immer parat, wenn es drauf ankommt. — Der sonore, substanzielle und noble Klang der einzelnen Instrumente sowie des Ensembles sind besonders zu rühmen. Orchester und Dirigent ist dafür zu danken, daß sie die Mühen dieser gigantischen Siebenten nicht gescheut haben, die Mahler im Sommer des Jahres 1905 in Maiernigg am Wörthersee ,,wie in einem Rausch” komponiert hat und deren Uraufführung drei Jahre später in Prag vor einem — begreiflicherweise — verblüfften Publikum stattfand…
In ihrem 7. Abonnementkonzert gedachten die Wiener Philharmoniker zunächst des am 6. April verstorbenen Igor Strawinsky mit dem Adagio für Streicher aus dem Ballett „Apollon Musagėte”. Strawinskys Verhältnis zu Wien war kühl und distanziert. Entsprechend sind auch die bisherigen „In-memoriam”-Veranstal- tungen ausgefallen, und die gutgemeinte der Philharmoniker war mit Stilblüten im Programmheft garniert. Danach dirigierte Horst Stein eine .klanglich sehr fein ausgewogene und sehr eindrucksvolle Wiedergabe der Haydn-Variationen von Brahms. Hierauf folgte die „Musik für Orchester” von Alfred Prinz: dreisätzig, 17 Minuten dauernd, recht gewandt instrumentiert, mit guten Themen in den lebhaften Ecksätzen, aber, was die Handschrift betrifft, „ohne besondere Kennzeichen”, klanglich reizvoll dagegen der langsame Mittelteil (Lento), mit tiefen Klavierakkorden, Pauken, Tamburin und dunklen Streichern geheimnisvoll beginnend und dann in eine reizvolle Siciliana-Melodie übergehend. Prinz, erster Klarinettist der Philharmoniker, hat bereits fünf Symphonien geschrieben, die Josef Krips in Amerika aufzuführen pflegt. Dieses letzte Werk verdankt, wie im Programm zu lesen ist, seine Existenz einem mehrmonatigen Zwangsaufenthalt des Komponisten in einem Lienzer Krankenhaus, wo „die schöpferische Ader völlig zum Durchbruch kam”. — Den zweiten Teil des Programms bildete Bruckners „Sechste”, die der Referent nicht mehr hören konnte.
Im letzten Konzert der „Kontrapunkte” im Mozart-Saal, der dank der Mitwirkung von Cathy Ber- berian fast aus verkauft war, zeigte sich die interessante Künstlerin von ihrer „populären” Seite. Ihren Vortrag der „Pribaoutki” für Singstimme und sieben Instrumente von Igor Strawinsky, 1914 entstanden,
mit Nachklängen aus dem „Sacre” und vorausweisend auf „Les Noces”, widmete sie dem Andenken des großen Komponisten. Mit diesen ebenso raffinierten wie schlagkräftigen Musikstücken verglichen sind die 1964 entstandenen „Folk Songs” von Luciano Berio recht harmlos. Der Komponist bekennt sich offen zu dem „gefälligen Charakter” dieser freien Bearbeitungen für Singstimme und sieben Instrumente nebst Schlagzeug. Sie sind für Cathy Berberian geschrieben und wohl auch von ihr angeregt. Siebenmal wechselt sie bei der Interpretation dieser elf Lieder, die eine knappe halbe Stunde dauern, Sprache, Timbre und Ausdruck — man hält es kaum für möglich. Aber Italienisch und Sizilia- nisch, Amerikanisch und Französisch, Sardinisch, Armenisch und Aserbadjanisch sind ihr gleichermaßen geläufig, besonders im rauhen Timbre und Ausdruck, die beiden letzteren. Die Große Katarina der Neuen Musik wurde wie ein Star gefeiert und dankte für den Applaus mit mehreren Zugaben.
Die beiden Teile des Konzerts des Ensembles „Kontrapunkte” wurden mit zwei Werken der Wiener Schule eingeleitet. Hans Erich Apostels Kammer Symphonie op. 41 ist in den Jahren 1963 bis 1968 entstanden. Eine lange Zeit für ein so kurzes Stück, aber man spürt in jedem Takt die Arbeit des Ziseleurs und Destillateurs: die fünf zwölftönigen Sätzchen sind echte Konzentrate, sowohl was ihre Stimmung wie was ihre Faktur betrifft. Diese ist zeichnerisch und stets durchhörbar. Der Ökonomie der Mittel — je fünf Streich-, Blas- und Schlaginstrumente — entspricht auch die Aussage und die Charakterisierungskunst Apostels, den wir hier auf dem Weg von Schönberg, dessen letzter prominenter Schüler er war, zu Webern sehen. — Keuschnig hat das diffizile Werk sorgfältig einstudiert. Das gilt auch für Alban Bergs Bearbeitung des zweiten Satzes seines Kammerkonzerts von 1925 für Violine, Klarinette und Klavier. So entstand, zehn Jahre später, im Bann Tristanscher Chromatik, dieses breitausge- sungene Adagio, das von Georg Sumpik, Alfred Rose und Rainer Keuschnig klangschön und verständnisvoll gespielt wurde.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!