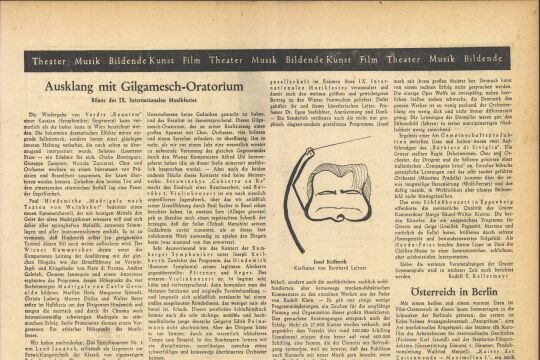Nicolas Nabokov, der künstlerische Leiter der Westberliner Festwochen, hat die vielen Veranstaltungen von Ende September bis Mitte Oktober unter das Motto „Barock“ gestellt. Er meint damit weniger eine ziemlich genau ab- grenzbare Kunstepoche zwischen Renaissance und Rokoko, sondern etwas Allgemeines, eine durch ein bestimmtes Lebensgefühl bestimmte Kunst, den Überschwang in Freude und Trauer, 'die weit ausladende Bewegung, die tiefgreifende Umwälzung in allen Lebensbereichen. — Dem aus dem Süden zureisenden Gast ist der Begriff und sind die entsprechenden Kunstphänomene nicht unvertraut. Aber da er, speziell auf dem Gebiet der Tonkunst, während der letzten Jahre mit allerlei musica antiqua ein wenig überfüttert worden ist, ging er den einschlägigen Konzerten geflissentlich aus dem Wege und hielt sich an die szenischen Darbietungen, einerlei, ab sie das Festwochenmotto illustrierten oder in ganz neue (zumindest als neu intendierte) Bereiche vorstießen.
Ein barockes Fest für Augen und Ohren gab es beim Gastspiel des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatiz, das in der Deutschen Oper Berlin stattfand. — Henry Purcells Ballettoper „Die Feenkönigin“ basiert auf Shakespeares „Sommemachtstraum“. Die Bemühungen um Wiederbelebung der kostbaren Partitur eines der größten englischen Komponisten gehen bis auf das Jahr 1930 zurück. Aber erst Jean-Pierre Ponnelle als Regisseur und Bühnenbildner hat eine gültige Lösung gefunden. Seine in verschiedenen Brauntönen gehaltenen Dekorationen, die gelegentlich auch in festlichem Gold aufleuchten, und die erlesenen Kostüme entsprechen dem noblen Prunk der Purcellschen Musik. Die Semi-Opera „Fairy Queen“ stammt aus dem Jahr 1692, den unbeholfenen und Shakespeare arg verstümmelnden Text schrieb ein Anonymus, aber die fünf großen Balletteinlagen sind motiviert und selhr wirkungsvoll. (Wir sahen sie in der Choreographie Franz Bauer-Pantuoliers.) Neben der aparten Margit Saad, der Gattin des Regisseurs, blieben die übrigen Sänger-Schauspieler ein wenig blaß. Von den Sängerinnen, die sich wiederholt dem Corps de ballet einfügen mußten und dies auch mit bemerkenswertem Geschick taten, fielen besonders Dorothea Christ und Rosl Schwaiger auf. — Das Werk und seine Interpreten (Dirigent war Kurt Eichhorn) wuxden mit einem Beifall bedacht, wie man ihn selten erlebt.
Dieser Applaus hatte, so schien es uns wenigstens, auch etwas Demonstratives. Denn viele, die im Zuschauerraum saßen, waren am Abend vorher bei der Uraufführung von Haubenstock-Ramatis „Amerika“ gewesen, das den Titel „Oper“ nicht ganz zu Recht führt. Lassen wir zunächst den Komponisten selbst sagen, was er mit seinem Werk, das auf Franz Kafkas Romanfragment „Amerika“ basiert, demonstrieren wollte, um jene Zwischenrufe und Gegendemonstrationen besser zu verstehen, zu denen es im Laufe der Aufführung gekommen ist und worüber in den Tageszeitungen ausführlich berichtet wurde: „So wie wir im Traum einerseits dem Realen, Bekannten und Eindeutigen, anderseits aber dem Verwischten, Unklaren und Vieldeutigen begegnen (Dimensionen, die sich nicht nur ergänzen, sondern auf zweierlei Art dasselbe — durch das Bewußte und das Unterbewußte — projizieren), so muß auch hier auf der Bühne diese Trennung des Untrennbaren auf zweierlei Ebenen angestrebt werden. Einerseits das Bewußte: durch die Klarheit und Eindeutigkeit der gezeichneten Geschehnisse, Personen und Dinge; anderseits die Projektionen der gleichen Personen, Dinge und Handlungen ins Unterbewußte, durch das verwischte, unklare und deformierte Bild und vieldeutige, oft absurde Aktionen. Einerseits also: Sprache, Gesang, erkennbare Personen und bekannte Formen als Ausdruck des Realen, des Bewußten; anderseits zerrissene Worte, Monologe und ungenannte Stimmen, Ballettaktionen und absurde Pantomimen, Deformation der Objekfe und abstrakte Projektionen, Finsternis und Spiele mit dem Licht, als Eindruck des Unterbewußten, des Transzendenten.“
Hat der Leser verstanden? Wenn nicht — tant pis pour lui! Uns, die wir der Aufführung beigewohnt haben, ist es nicht anders ergangen. Anstatt also das ohnedies schwierige und mehrdeutige Kafka-Fragment auf seinen Handlungs- kem zu reduzieren oder wenigstens eine Folge möglichst klarer und plastischer Szenen zu bieten, fühlte sich der Komponist bemüßigt — Max Brods durchaus verständliche Bühnenfassung ignorierend —, Kafka noch weiter ziu komplizieren und mit eigenen Spekulationen zu belasten. „Hommage ä Kafka“ heißt der Untertitel des ersten Bildes „Widmung“ mit dem Haupttitel „Apotheose ä la nature morte“, und diese Dedikation ist zweifellos ernst und ehrlich gemeint. Aber hat der Komponist dem großen Dichter mit diesem Werk einen Dienst erwiesen? Er selbst ist jedenfalls bereits über sein Konzept gestolpert. Aber solche radikale Fehler machen anscheinend nur sehr intelligente Künstler, zu denen Roman Haubenstock-Ramati ohne Zweifel gehört. Seine Personalien sind dem Besucher internationaler Festivals bekannt, wo sich der Komponist durch eine Reihe feiner, differenzierter und anspruchsvoller Orchesterstücke und Vokalkompositionen einen geachteten Namen erworben hat: Geboren 1919 in Krakau, Studium der Musikwissenschaft und der Philosophie, nach dem Krieg Leiter der Musikabteilung von Radio Krakau, seit 1950 in Israel, Gründer und Leiter der ersten Musikbibliothek in Tel Aviv, dann beim „Centre des Recherches“ der RTF in Paris, die letzten Jahre als freischaffender Komponisit und Konsulent der Universal Edition in Wien.
Bevor wir von der Musik sprechen, muß von der Inszenierung Deryk Mendels und dem Bühnenbild von Michel Raffaeli die Rede sein, die in engem Kontakt mit dem Komponisten erarbeitet wurden. Da galt es zunächst, die Schwierigkeit der 25 Bilder samt Epilog zu meistern. Die häufig verlangten Szenenwechsel machen eine Realisierung auf einer Drehbühne unmöglich. Man wählte also ein zunächst brauchbar erscheinendes Medium: die Simultanbühne, wie wir sie etwa aus Nestroys „Haus der Temperamente“ oder — auch das ist schon ein Menschenalter her — aus Ferdinand Bruckners „Verbrechern“ kennen. Hier, bei der neuen „Amerika“-Oper, war die Riesenbühne in drei Stockwerke mit je acht kleinen Kammern gegliedert. Das ganze wurde nach dem Prolog hereingeschoben und später wieder hinausgerollt, halb Gefängnis, halb Aquarium, nicht schlecht als „Schiff“, in dem der junge Kari. Rossmann, von seinen Eltern verstoßen, an der Küste des neuen Kontinents landet, brauchbar auch als Symbol eines „dunklen Hauses“, in dem sich ein Großteil der Vorgänge abspielt, unbrauchbar für alle übrigen Szenen und besonders ungeeignet für das große Naturtheater von Oklahoma, in welchem das Romanfragment Kafkas kulminiert. Nichts Traumhaft-Dämmriges, nie der Eindruck des Labyrinthischen oder Vieldeutigen, alles klar Sichtbar und in einzelne kleine Zellen verteilt (mit Ausnahme weniger Szenen). Dazu eine Musik, die sicher mit großer Akribie und einem respektablen Kunstverstand hergestellt ist, die aber in der ständigen Wiederholung der immer gleichen (oder ähnlicher) Effekte bald ermüdet: Vibrato, Tremolo, Glissando, rasches An- und Abschwellen der Töne usw. Auch die stereophonischen Effekte nutzen sich bald ab. Man hört nämlich nur einen Teil der „Musik“ (und zwar den kleineren) aus dem Orchestergraben, wo Bruno Maderna unerschüttert seines Amtes waltete, sondern aus Lautsprechern, die hinter der Bühne, an den Seitenwänden, an der Decke und im Hintengrund des Zuschauerraumes angebracht sind. Und zwar hört man nur ganz selten „normale“ Töne und Akkorde, sondern vielfach verfremdete Klänge, besonders der menschlichen Stimme, die kichert, wispert, lacht, zischelt und schreit, solo und chorisch. Der Musik, soweit von einer solchen die Rede sein kann, fehlt es vielfach an plastischer, einprägsamer Gestaltung — die sehr kühn und sehr neuartig sein kann und keineswegs an Verdi oder Puccini zu erinnern braucht; auch nicht an Hindemith oder Honegger. Das hatten wir nicht erwartet...
Die Künstler exekutierten ihre Partien mit vollem Einsatz und, wenn der Eindruck nicht trog, auch mit einem gewissen Spaß an der Sache. Allen voran Karl Ernst Mercker als Karl Rossmann; mit schwierigsten musikalischen Aufgaben bedacht: Catherina Gayer (Klara und Therese); ein Kabinettstück, besser: ein Kabarettstück ersten Ranges lieferte Patricia Johnson als Brunelda in einer parodistischen und in einer Badewannenszene; in je drei Rollen erwiesen sich als in allen Sätteln gerecht: die Herren Krukowski, Heuer und McDaniel. (Ihre Namen stehen hier für die aller Mitwirkenden.) Die Direktion der Deutschen Oper Berlin, nach den letzten Proben auf Schlimmes gefaßt, hatte in einem Flugblatt gebeten, den Ablauf der Vorstellung nicht zu stören und die Mißfallensäußerungen bis zum Schluß aufzusparen. Der letzten Aufforderung jedenfalls ist das Publikum in seiner Mehrheit folgsam nachgekommen.
Vielerlei Passionen... In Berlin wurde der Leidensweg von Kafkas passivem Helden infolge der Passion des Komponisten fürs Komplizierte auch zur Passion des Publikums. Einige Tage vorher führte man in Brünn die letzte vollendete Oper des 1959 verstorbenen mährischen Komponisten Bohuslav Martinu auf. Sie heißt „Griechische Passion“ und ist nach dem Roman und dem Film gleichen Namens von Nikos Katzantzakis geschrieben. Das Libretto machte sich Martinu selbst, die Uraufführung fand 1961, zwei Jahre nach seinem Tod, unter der Leitung von Dr. Paul Sacher in Zürich statt. Das Sujet in Kürze: In einem kleinen Dorf im griechischen Anatolien werden Passionsspiele vorbereitet und die Rollen durch den Priester Grigoris verteilt.
Ein Zug von Flüchtlingen taucht auf, gleichfalls von einem Priester geführt. Obwohl gleichen Stammes, wollen die Eingeborenen nichts von den „Fremden“ wissen. Nur einer, Manolios, der die ihm zugewiesene Rolle des Jesus ernst nimmt, tritt seinen Mitbewohnern entgegen. Seine Braut Lenio hat er einem Jüngeren abgetreten und den Versuchungen der Witwe Katharina (der Magdalena im Passionsspiel) widerstanden. Manolio wird zuletzt von dem Schmied Panait, der den Judas spielen soll, im Beisein und mit Zustimmung der übrigen Dorfbewohner erschlagen. Denn er hat, von Mitleid bewegt mit den Hungernden und Leidenden, den sterbenden Kindern und den weinenden Müttern, den Reichen und Hartherzigen den Krieg erklärt und wie ein Aufwiegler gehandelt.
Es ist leicht einzusehen, was Bohuslav Martinu zu diesem Stoff zog und daß man gerade zu diesem Werk griff in einer Stadt, die sich, wie einer der vielen sorgfältig redigierten Prospekte in Tschechisch, Deutsch und Englisch stolz vermerkt, „noch zu Zeiten, da Martinu als kosmopolitischer Formalist galt, für sein Werk eingesetzt hat“. Denn der Fall Martinu liegt für seine Landsleute in der heutigen CSSR ein wenig schwierig: Bohuslav Martinu, 1890 als Sohn eines Küsters in dem kleinen mährischen Ort Policka geboren, ging frühzeitig nach Paris, emigrierte von dort nach Amerika und kehrte auch nach 1945 nicht in seine Heimat zurück. Die Choroper „Griechische Passion“ schrieb er in Nizza, New York, Rom und in Prattein bei Basel, wo er 1959 auch starb.
Aber auch für den Kritiker ist Martinu ein schwieriger Fall. Nach der von Miloš Šafranek, dem Freund und Biographen des Komponisten, vorgenommenen Registrierung hart Martinu nicht weniger als 109 Jugendwerke und 284 Kompositionen der Reifezeit hinterlassen, darunter 16 Opern und ein Dutzend Ballette. So waren das runde Dutzend Orchesterwerke, einige Abende mit Kammermusik, zwei Chorkonzerte und zwei Opern, die man in Brünn im Rahmen eines neuntägigen Martinu-Festivals aufführte,, nur Kostproben. Sie wurden von verschiedenen tschechischen Ensembles und der gastierenden Kattowitzer Staatlichen Philharmonie dargeboten und vermittelten das Bild eines keineswegs formalistisch-avantgardistischen Komponisten, sondern eines unentwegt komponierenden Musikanten, der vor allem aus den Quellen der böhmisch-mährischen Volksmusik schöpfte, ohne ein eigentlicher „Folklorist“ zu sein. Bei der Aufführung der „Griechischen Passion“ stand Fran- tišek Jilek am Pult, Oskar Linhart führte Regie und ein ambitioniertes Solistenensemble sowie der wohldisziplinierte Chor der Brünner Oper sang.
Die Aufführung fand in dem neuen, vor genau einem Jahr eingeweihten Janaček-Theater statt (vergleiche hierzu unseren ausführlichen Bericht vom 11. November 1965 auf der Kunstsonderseite). — Zwei Minuten vom neuen Haus entfernt steht das alte Brünner Opernhaus, wo 1895 Leo Slezak als Lohengrin debütierte und wo Maria (damals noch Mitzi)
Jeritza als Choristin ihre Karriere begann. Hier sahen wir an einem Sonntagnachmittag die 50. Aufführung eines echten alten Passionsspieles mit dem Titel „Komödie vom Tod und der glorreichen Auferstehung unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus“, aus dem Spätmittelalter stammend, 1708 wiederentdeckt, 1872 und 1891 gespielt und mit einer neuen Musik (Chöre, Solostimmen, zwei Dutzend Mann im Orchester und eine kleine Blasmusik auf der Bühne) von dem Martinu-Schüler Jan Novak. Das Erstaunliche an dieser Aufführung war, daß keinerlei aufklärerische Zutaten zu bemerken waren und weder im Vorspiel noch im Epilog davon die Rede war, daß es sich hier um ein nur „historisches Dokument“ handle. Wie wir uns berichten ließen, war jede der 50 Aufführungen ausverkauft, in neun Logen und im Parkett saßen ganze Reihen von Bäuerinnen (offensichtlich aus der Umgebung der Stadt) in ihren schönen Trachten und mit weißen Kopftüchern, nicht anders wie in Thiersee oder in Kirchschlag. Und die Ergriffenheit, mit der sie den Vorgängen auf der vielfach geteilten Simultanfoühne folgten, war wohl ebenfalls nicht geringer...