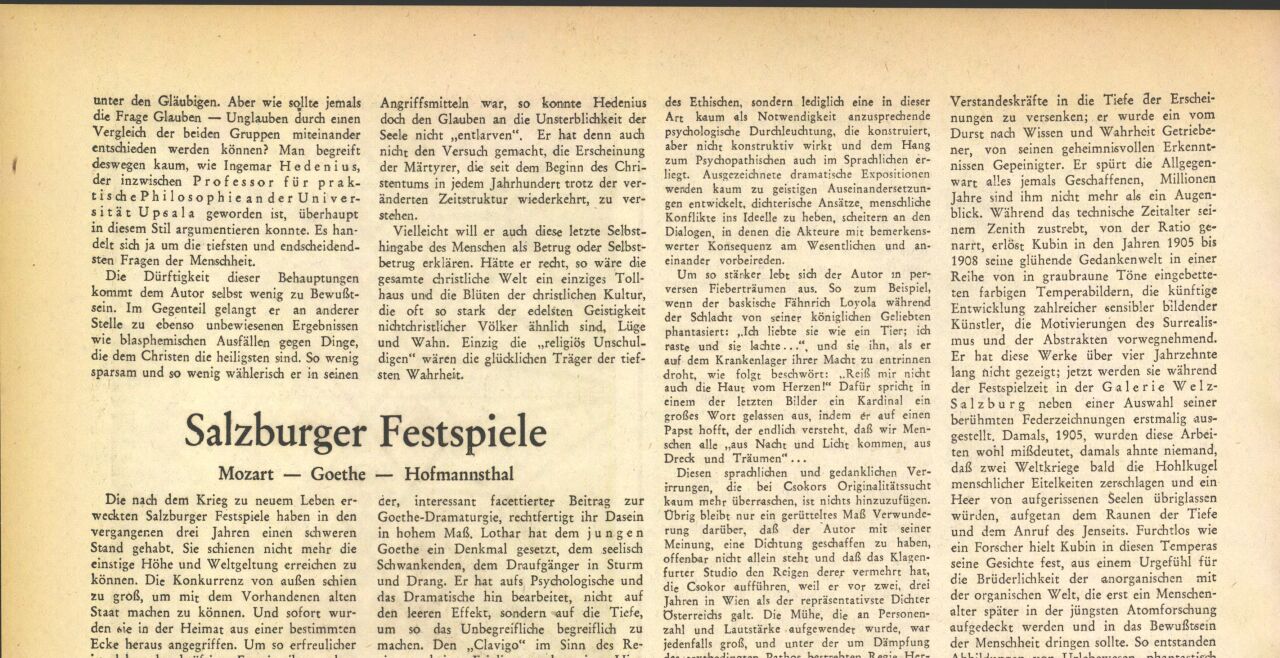
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Salzburger Festspiele
Die nach dem Krieg zu neuem Leben erweckten Salzburger Festspiele haben in den vergangenen drei Jahren einen schweren Stand gehabt. Sie schienen nicht mehr die einstige Höhe und Weltgeltung erreichen zu können. Die Konkurrenz von außen schien zu groß, um mit dem Vorhandenen alten Staat machen zu können. Und sofort wurden sie in der Heimat aus einer bestimmten Ecke heraus angegriffen. Um so erfreulicher in daher der kräftige Erweis ihrer alten Daseinsberechtigung gleich zu Beginn der diesjährigen Aufführungen. Man sieht ein belohntes Bemühen, erkennt, daß nirgends sonst ein Gleiches in solcher Fülle möglich ist und blickt in eine für die Heimat bedeutsame Zukunft.
Schon der Dreiklang Mozart—Goethe— Hofmannsthal war vielversprechend. Die „Z a u b e r f 1 ö 11 e“ sollte endlich wieder in einer nur Salzburg und seinen Festspielen eigenen Prägung ins Programm aufgenommen werden. Man hätte bestimmt, wie das zuerst beabsichtigt war, besser daran getan, diese Oper in dem entzückenden kleinen Haus der Stadt, dem Landestheater, aufzuführen. Wahrscheinlich waren Überlegungen materieller Art maßgebend, die es mit bescheidenen Mitteln möglich machen, drei Fliegen auf einen Schlag in der Felsenreitschule zu erwischen: „Zauberflöte“, „Orpheus und Eurydike“ und Carl Orffs „Antigone“. Die Architektur war schon seit dem vergangenen Jahr vorhanden. Caspar Neher hat sie für den „Orpheus“ geschaffen; eine Salzburger Barockarchitektur mit Arkaden und Pyramiden, die, sei’s, wie es wolle , nicht in die schlichten Felsenarkaden des Hintergrundes eingefügt sein will. Für die „Zauberflöte“ hat man nun eine kühle Märchenatmosphäre mit einigen Goldgirlanden und dem die Bühne beherrschenden strahlenden Sonnenornament als Abzeichen Sarastros bereitet. Ansonsten wandern die Requisiten wie in der Commedia dell’arte auf offener Bühne, was sich heiter ausnimmt, aber nicht ganz zu diesem Werke paßt. Obwohl Schuh sich einen Mozarts würdigen Regiestil zurechtgelegt hat, gelang es ihm doch nicht ganz, die räumlichen Weiten der Bühne zu überwinden, was zu Verzögerungen im Tempo der Aufführung Anlaß gab. Die musikalische Interpretation Wilhelm Furt- wänglers zielte auf die bis in letzte Verästelungen ausstrahlende Durchseelung und Ausschöpfung der Partitur. Ihm ist diese Oper vor allem Weihespiel, Brücke zum Requiem, Brücke bereits nach der anderen Welt. Die Ensembleleistung der Sänger war, im großen gesehen, einheitlich. Führend als edelste Repräsentantin Mozartscher Kan- tilene Irmgard Seefried als Pamina, zu der Walter Ludwigs weicher, kultiviert ansprechender Tenor die wohltuende Ergänzung schuf. Wilma Lipp (Königin der Nacht) verfügt über glasklar perlende Koloraturen und eine verblüffend genaue Stakkatotechnik. Karl Schmitt-Walters Papageno ist im Frankenland, nicht in Wien daheim, war aber intelligent und geschmeidig in der Behandlung seines schlanken, lichten Baritons. Josef Greindls Sarastro bringt viel Erfreuliches mit, doch fehlt ihm noch die letzte Reife, die in hohem Maße der von Furtwängler absichtlich ins Zentrum gestellte Sprecher Paul Schöfflers besitzt. Auch in den kleinsten Partien sowie den sauberen Chören wurden Leistungen von schönem Niveau geboten. —
Ein Experiment zum Goethe-Jahr stellte die „C 1 a v i g o“ - Inszenierung Ernst Lothars dar. Daß sie nach der Premiere nicht mehr als Experiment bezeichnet werden kann, sondern als ein sehr ernst zu nehmen der, interessant facettierter Beitrag zur Goethe-Dramaturgie, rechtfertigt ihr Dasein in hohem Maß. Lothar hat dem jungen Goethe ein Denkmal gesetzt, dem seelisch Schwankenden, dem Draufgänger in Sturm und Drang. Er hat aufs Psychologische und das Dramatische hin bearbeitet, nicht auf den leeren Effekt, sondern auf die Tiefe, um so das Unbegreifliche begreiflich zu machen. Den „Clavigo" im Sinn des Regisseurs, keinen Feigling, sondern einen Hinaufstrebenden mit Wankelmut, goethisch jung und feurig, spielte Will Quadflieg. Ein Bild der tiefsten inneren Zerrissenheit aus Krankheit und Herzensarmut entwarf die wunderbare Käthe Gold, mütterlich assistiert von Vilma Degischer, der warmblütigen Menschendarstellerin. Sarkasmus und seigneurale Überlegenheit mit mephistophelischen Untertönen bot Hans Jaray als Carlos. Karl Paryla war als Beaumarchais der Sprengstoff der Aufführung, dabei ein Schauspieler von wirklichem Geist. Die sanfte häusliche Atmosphäre sicherten Hans Thimigs Buenco und der Guilbert des Fritz Delius. In Bühnenbild und Kostüm fingen Stefan Hlawa und Eva Pohl die Sphäre der Goethe-Zeit ein.
„Jederman n“, immer noch Reinhardts großes Wollen bestätigend, als Dichtung erhaben wie am ersten Tag, wurde außer von Helene Thimig heuer noch von Erwin Faber und Inge Leddhin inszeniert. Diese vielen Köche verdarben den Brei nicht, sondern arbeiteten nach den vermeintlichen Intentionen des unvergessenen Meisters, der selbst bestimmt manches Novum hineingetragen, auf gewisse erstarrte Posen vielleicht verzichtet hätte. Die Kulisse Salzburgs und der mächtigen Domfassade lassen dem „Jedermann“ seinen einst welterobernden Zauber. In der Reihe der schon bekannten Rollenträger standen wieder der saftige, irdisch bemessene Jedermann Attila Hörbigers, der herbe Tod des Ernst Deutsch, Lie- wehrs sonniger Guter Gesell, Lotte Me- delskys Mutter, die reizvolle Buhlschaft Maria Beckers, am stärksten wieder Helene Thimigs Glaube und Alma Seidlers Gute Werke im Vordergrund. Nach fast 30 Jahren war Werner Krauß neuerdings der Teufel, ein elegischer Höllenfürst, sarkastisch müde mit Krone, Hörnern, Klumpfuß, Purpurmäntelchen und langem Bart. Seine unverkennbare Sprache ließ sich auch als Stimme des Herrn — Gott und Teufel also in einem — nicht verleugnen, obwohl das Programm ihn in diesem Fall nur mit drei Sternen auswies.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




































































































