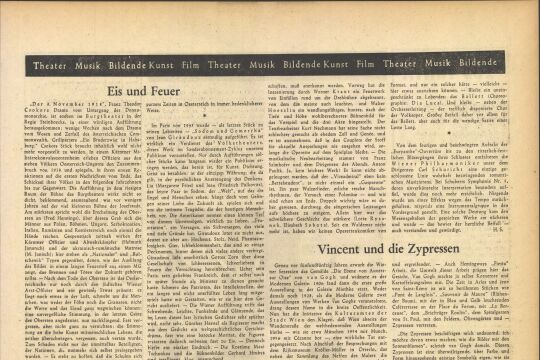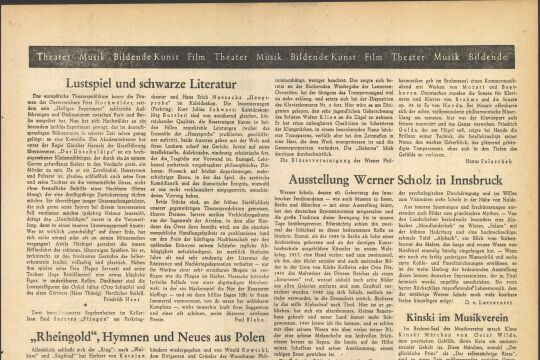Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der „Freischütz” — Festspieloper?
Salzburg, im August
Die Salzburger Festspiele begannen in diesem Jahre — um es relativ harmlos zu sägen — nicht weniger als dreimal. Das „Jedermann“-Spiel vor dem Dom, das wieder Ernst Lothar betreute und das auch, vom „teuflischen“ O. E. Hasse abgesehen, di gleiche Besetzung mit dem immer tiefer gestaltenden Will Quadflieg als reicher Mann und der noch immer große Vorbilder nicht ganz erreichenden Heidemarie Hatheyer als Buhlschaft in den tragenden Partien aufwies, ist schon längst nicht mehr als eine feierliche Handlung, eine Art Schauspielmesse, in die man als versierter Festspielbesucher zu gehen hat. Der zweite Auftakt: Bruckners VIII. Symphonie mit den Wiener Philharmonikern unter Hans Knapperts- busch. Wieder Hinweis auf die religiöse Kraft in der Kunst, hier in ein seltsames, nie ganz zu ergründendes Doppelspiel mit dem deutschen Midiei und dem heiligen Michael versponnen.
Dritter Auftakt, echter Festspielbeginn und zugleich auch zu heftigem Widerspruch herausfordernd: Webers „Freischütz“ im Festspielhaus nicht in der Felsenreitschule, wohin er, wenn in Salzburg, gehörte unter Wilhelm Furtwängler. Ueber die Größe dieses Dirigenten brauchen keine weiteren Worte verschwendet zu werden. Dennoch: die Diskrepanz zwischen seiner auch in der knappsten Arienform zur symphonischen Dehnung ausholenden romantischen Deutung und den sozusagen erbarmungslosen Erfordernissen der Bühne, der Sänger zumal, die atmen müssen, wird immer größer, immer unüberbrückbarer. Der gute Operndirigent ist nun einmal auch Theaterkapellmeister; Furtwängler aber ist der große Individualist mit einem festgefügten musikalischen Weltbild. Seine Alleinherrschaft mußte der Konzeption des Meisterregisseurs Günther Rennert konträr gegenüberstehen. Dabei hat Rennert den für einen „Freischütz“ als Festspieloper immerhin zu erwägenden Schritt zur endgültigen und nur auf solche Weise vielleicht zu erreichenden „gültigen’ Lösung von der Tradition nicht einmal gewagt. Rennert konnte ihn nicht wagen, zumal auch Teo Otto, der Bühnenbildner, den deutschen Wald als Hauptakteur, wenn auch leicht stilisierten, gelten ließ. So spielte der „Freischütz“ auf verschiedenen Ebenen ab; Weber triumphierte, Herr Kind, sein Librettist, dem man wahrhaftig trotz Goethes Mahnung nicht mehr ganz zu folgen vermag, erhielt zu viel Recht, mehr als ihm heutzutage zusteht. Und Rennerts spürbarer Versuch, dennoch dem Theater zu geben, was ihm gehört die spielerische Auflockerung der Chöre war wieder sein Meisterstück! scheiterte im Grundsätzlichen daran, daß Furtwängler ihm und den Sängern zu viel Zeit zur Verfügung stellte. Großartige Einzelleistungen: Elisabeth Grümmer Agathe und Kurt Böhme, in letzter Minute für Gottlob Frick eingesprungen, als Kaspar.
Und — im Grunde — erste echte „Festspieloper“: O. F. Schuhs und Caspar Nehers „Cosi“-Inszenierung im Carabinieri-Saal der Residenz. Musterbeispiel für den einzig echten Mozart-Stil unserer Tage; der Mensch handelt aus Geist und Seele der Musik. Die Marionette ist überwunden. Mozart — das menschliche Genie. Und Karl Böhm, der geborene „Theaterkapellmeister“, mit dem Spürsinn für die Nuance, für die Farblichter, für das innerlich rechte Tempo. Meister- und Musterbesetzung: Irmgard See- fried, Dagmar Hermann, Anton Dermota, Erich Kunz, Paul Schöffler und Lisa Otto. Auch 1954: der Salzburger Sensationserfolg.
Alle Gattungen dieses in diesem Jahre etwas einseitigen „Musikfestspiels“ ohne Schauspiel sind bereits angelaufen: die Serenaden in der Residenz, die Mozart-Matineen, beide im Programm von Bernhard Paum- gartner vorbildlich zusammengestellt und betreut; die Domkonzerte in der Aula academica unter Meßner, der dieses Jahr bereits hauptsächlich an Mozart denkt. Hervorragend auch der Auftakt der Kammerkonzerte mit dem Quartetto Italiano, das Mozart ungewohnt einer geistvollen Italia- nitä zuordnet, Debussy unvorstellbar konzis und Verdi prachtvoll im Schwung vorträgt. Mehr als sonst ist den Solistenkonzerten Aufmerksamkeit geschenkt Zunächst standen einander zwei Pianisten „gegenüber“: Edwin Fischer, der, ein Furtwängler am Klavier, Beethoven zelebrierte, und Geza Anda, der Schumanns „Carnaval“ vielstimmig sezierte, eine Begegnung in grundverschiedener national-seelischer Haltung, wie etwa, wenn Sabata Brahms durchleuchtet.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!