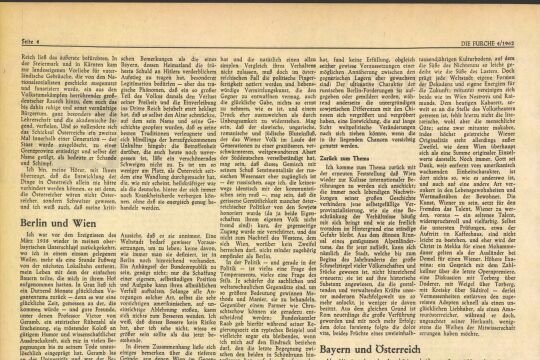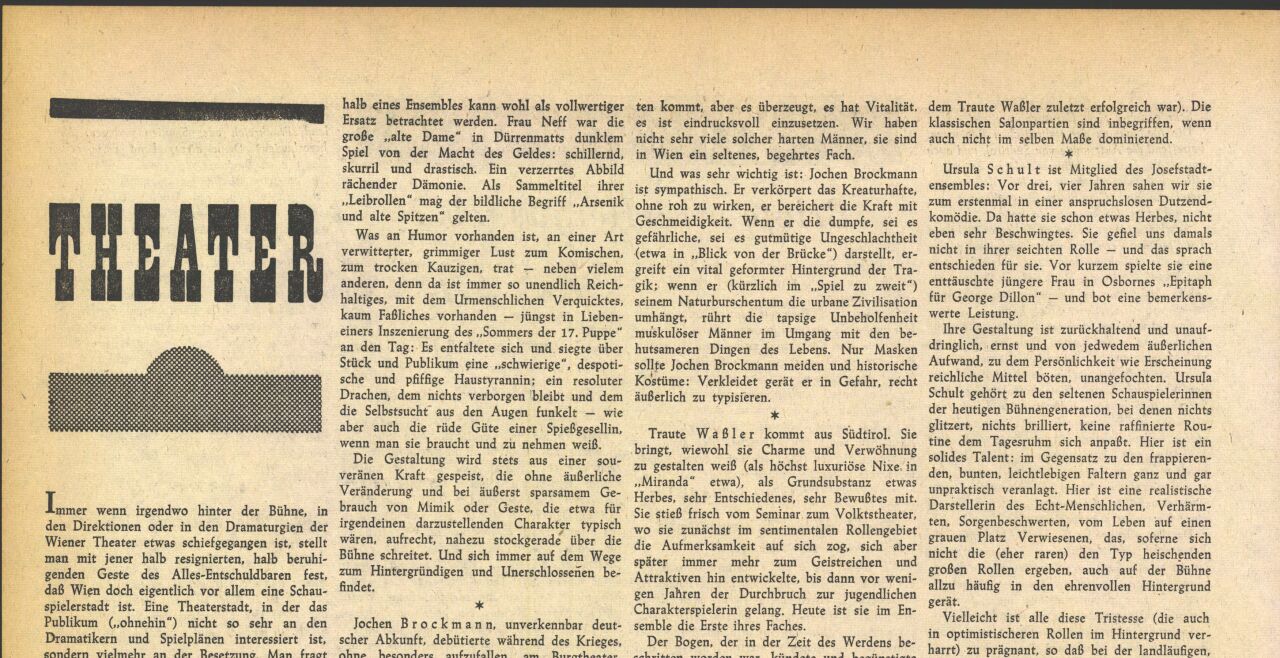
Immer wenn irgendwo hinter der Bühne, in den Direktionen oder in den Dramaturgien der Wiener Theater etwas schiefgegangen ist, stellt man mit jener halb resignierten, halb beruhigenden Geste des Alles-Entschuldbaren fest, daß Wien doch eigentlich vor allem eine Schauspielerstadt ist. Eine Theaterstadt, in der das Publikum („ohnehin”) nicht so sehr an den Dramatikern und Spielplänen interessiert ist, sondern vielmehr an der Besetzung. Man fragt erst in zweiter Linie darnach, ob in einer Saison die Stücke im literarischen Sinn gut oder interessant waren oder nur mittelmäßig — oder wieviel Erst- und Uraufführungen es gegeben hat; vermerkt wird, ob an der Spitze der etwa zwanzig bis dreißig prominenten, beliebten, bevorzugten Schauspieler (zu denen unter anderen Josef Meinrad, Aglaja Schmid und Albin Skoda, Fred Liewehr und Inge Konradi, Anton Edt- hofer, Helene Thimig, Leopold Rudolf und Vilma Degischer, Ernst Waldbrunn und Hans Jaray gehören) das bewußte halbe Dutzend jener ganz großer Majestäten der Schauspielkunst in „schönen” Rollen im Rampenlicht gestanden waren, wegen denen das Wiener Publikum ins Theater geht: Werner Krauß, Käthe Gold, Attila Hörbiger, Alma Seidler, Adrienne Geß- ner, Paula Wessely und Ewald Baiser.
Im Schatten dieser an Zahl wie an Persönlichkeit bedeutenden und hinlänglich gewürdigten Prominenz steht unter den rund 400 in einer Saison an den großen und kleinen Wiener Bühnen auftretenden Schauspielern — und neben der aufstrebenden Jugend, mit Walther Reyer, Bruno Dallansky, Kurt Sowinetz, Edd Stawjanik und Walter Kohut im Vordergrund (mit ihnen werden wir uns in einem zweiten Aufsatz beschäftigen) — jenes große, für Wien so typische Reservoir guter, profilierter Hauptrollendarsteller und Chargenspieler, die den sogenannten „Theateralltag” bestreiten. Sie bilden die Ensembles. Sie sind, wenn etwas schiefgeht in den Direktionen und Dramaturgien und wenn die Prominenz auswärts ist (zum Filmen oder auf einträglichen Gasttourneen), Grundstock und Stütze des Wiener Theaterbetriebes.
In der Spielzeit 1958/59 waren bis Mitte März zu sehen: der große Krauß auf einsamer Höhe als „König Lear”; Hörbiger, der prachtvolle Charakterspieler, in „Fast ein Poet”; überaus reizvoll: Käthe Gold in „Dieser Plato- now”, und Josef Meinrad, ein vollkommener „Zerrissener” — aber wir sahen auch Benno Smyth in den ..Kreuzeischreibern”, Gretl Elb in einer kleinen Rolle in James Lees „Karriere”, Guido Wieland in einer Charakterepisode in Molnars „Miniaturen” und Hanns Obonya am Rande in Firners „Flucht in die Zukunft”. Und das war nicht minder bewunderungswürdig, nicht weniger verdienstvoll, ebenso erstrangig: glänzende, kontinuierliche Schauspielkunst! Und wenn wir diesmal eine Reihe bewährter, interessanter Schauspieler eingehender besprechen, die an der Peripherie der exponierten Ruhmverteilung 1958/59 in Hauptrollen die Aufmerksamkeit auf sich zogen, ist darin keine absolute Wertung zu erblicken: weder im Gegensatz zu den eingangs erwähnten noch gegenüber den ungenannt gebliebenen. Denn die prominenten Plätze in den Reihen der Popularität werden ebenso oft vom Zufall angewiesen, wie der Platz auf Theaterseiten stets von den ehernen Gesetzen des Raummangels.
Da ist beispielsweise Dorothea Neff: Seit vielen Jahren unersetzlich im Ensemble des Volkstheaters. Sie zählt wohl nur als Folge der allzu einseitig konzentrierten Bewunderung (noch) nicht zur „offiziellen” Wiener Spitzenklasse. Aber ein überaus reiches Spielfeld innerhalb eines Ensembles kann wohl als vollwertiger Ersatz betrachtet werden. Frau Neff war die große „alte Dame” in Dürrenmatts dunklem Spiel von der Macht des Geldes: schillernd, skurril und drastisch. Ein verzerrtes Abbild rächender Dämonie. Als Sammeltitel ihrer „Leibrollen” mag der bildliche Begriff „Arsenik und alte Spitzen” gelten.
Was an Humor vorhanden ist, an einer Art verwitterter, grimmiger Lust zum Komischen, zum trocken Kauzigen, trat — neben vielem anderen, denn da ist immer so unendlich Reichhaltiges, mit dem Urmenschlichen Verquicktes, kaum Faßliches vorhanden — jüngst in Liebeneiners Inszenierung des „Sommers der 17. Puppe” an den Tag: Es entfaltete sich und siegte über Stück und Publikum eine „schwierige”, despotische und pfiffige Haustyrannin; ein resoluter Drachen, dem nichts verborgen bleibt und dem die Selbstsucht aus den Augen funkelt — wie aber auch die rüde Güte einer Spießgesellin, wenn man sie braucht und zu nehmen weiß.
Die Gestaltung wird stets aus einer souveränen Kraft gespeist, die ohne äußerliche Veränderung und bei äußerst sparsamem Gebrauch von Mimik oder Geste, die etwa für irgendeinen darzustellenden Charakter typisch wären, aufrecht, nahezu stockgerade über die Bühne schreitet. Und sich immer auf dem Wege zum Hintergründigen und Unerschlossenen befindet.
halb eines Ensembles kann wohl als vollwertiger Ersatz betrachtet werden. Frau Neff war die große „alte Dame” in Dürrenmatts dunklem Spiel von der Macht des Geldes: schillernd, skurril und drastisch. Ein verzerrtes Abbild rächender Dämonie. Als Sammeltitel ihrer „Leibrollen” mag der bildliche Begriff „Arsenik und alte Spitzen” gelten.
Was an Humor vorhanden ist, an einer Art verwitterter, grimmiger Lust zum Komischen, zum trocken Kauzigen, trat — neben vielem anderen, denn da ist immer so unendlich Reichhaltiges, mit dem Urmenschlichen Verquicktes, kaum Faßliches vorhanden — jüngst in Liebeneiners Inszenierung des „Sommers der 17. Puppe” an den Tag: Es entfaltete sich und siegte über Stück und Publikum eine „schwierige”, despotische und pfiffige Haustyrannin; ein resoluter Drachen, dem nichts verborgen bleibt und dem die Selbstsucht aus den Augen funkelt — wie aber auch die rüde Güte einer Spießgesellin, wenn man sie braucht und zu nehmen weiß.
Die Gestaltung wird stets aus einer souveränen Kraft gespeist, die ohne äußerliche Veränderung und bei äußerst sparsamem Gebrauch von Mimik oder Geste, die etwa für irgendeinen darzustellenden Charakter typisch wären, aufrecht, nahezu stockgerade über die Bühne schreitet. Und sich immer auf dem Wege zum Hintergründigen und Unerschlossenen befindet.
Jochen Brockmann, unverkennbar deutscher Abkunft, debütierte während des Krieges, ohne besonders aufzufallen, am Burgtheater.
Dann verlor man ihn in mancher Hinsicht aus den Augen. Vor zwei Jahren kehrte er — nicht wiederzuerkennen, ein ausgereifter Charaktertyp — zurück. Er spielt im Theater in der Josef- i Stadt und ist eine willkommene Bereicherung des Ensembles. Man sah ihn bis jetzt in einer Reihe interessanter Rollen.
Seinen Namen trägt er sehr zu Recht: Da ist ein wahrer Brocken, ein massiver Männerdarsteller für harte Stücke, ein gedrungener Vulkan. Das, was er sprüht, ist zwar nicht immer von jener Klarheit ausgefeilter Sprechkunst, die trotz impulsivem Temperaments zu ihren Rechten kommt, aber es überzeugt, es hat Vitalität, es ist eindrucksvoll einzusetzen. Wir haben nicht sehr viele solcher harten Männer, sie sind in Wien ein seltenes, begehrtes Fach.
Und was sehr wichtig ist: Jochen Brockmann ist sympathisch. Er verkörpert das Kreaturhafte, ohne roh zu wirken, er bereichert die Kraft mit Geschmeidigkeit. Wenn er die dumpfe, sei es gefährliche, sei es gutmütige Ungeschlachtheit (etwa in „Blick von der Brücke”) darstellt, ergreift ein vital geformter Hintergrund der Tragik; wenn er (kürzlich im „Spiel zu zweit”) seinem Naturburschentum die urbane Zivilisation umhängt, rührt die tapsige Unbeholfenheit muskulöser Männer im Umgang mit den behutsameren Dingen des Lebens. Nur Masken sollte Jochen Brockmann meiden und historische Kostüme: Verkleidet gerät er in Gefahr, recht äußerlich zu typisieren.
Traute Waßler kommt aus Südtirol. Sie bringt, wiewohl sie Charme und Verwöhnung zu gestalten weiß (als höchst luxuriöse Nixe, in „Miranda” etwa), als Grundsubstanz etwas Herbes, sehr Entschiedenes, sehr Bewußtes mit. Sie stieß frisch vom Seminar zum Volktstheater, wo sie zunächst im sentimentalen Rollengebiet die Aufmerksamkeit auf sich zog, sich aber später immer mehr zum Geistreichen und Attraktiven hin entwickelte, bis dann vor wenigen Jahren der Durchbruch zur jugendlichen Charakterspielerin gelang. Heute ist sie im Ensemble die Erste ihres Faches.
Der Bogen, der in der Zeit des Werdens beschritten worden war, kündete und begünstigte eine sehr vielseitige Verwendung: Traute Waß- ler ist im heiteren Salon ebenso gewandt, amüsant und reizvoll, wie im weniger freundlichen Milieu ihre starken und intensiven weiblichen Farben dem rigorosen Zeitstück gewachsen sind: Die dekorative „Dame von Welt” tritt in jenes scharfe Licht, in dem den Frauen die’ Welt geläufig ist; das schillernde Temperament verdichtet sich zu explosiver Leidenschaft.
Die Stationen dieser Bewegung im Bereich des weiblichen Charakters liegen sehr augenfällig zwischen der Kurt Goetzschen „Ingeborg” und dem „Blick zurück im Zorn” von Osborne (in dem Traute Waßler zuletzt erfolgreich war). Die klassischen Salonpartien sind inbegriffen, wenn auch nicht im selben Maße dominierend.
Ursula Schult ist Mitglied des Josefstadtensembles: Vor drei, vier Jahren sahen wir sie zum erstenmal in einer anspruchslosen Dutzendkomödie. Da hatte sie schon etwas Herbes, nicht eben sehr Beschwingtes. Sie gefiel uns damals nicht in ihrer seichten Rolle — und das sprach entschieden für sie. Vor kurzem spielte sie eine enttäuschte jüngere Frau in Osbornes „Epitaph für George Dillon” — und bot eine bemerkenswerte Leistung.
Ihre Gestaltung ist zurückhaltend und unaufdringlich, ernst und von jedwedem äußerlichen Aufwand, zu dem Persönlichkeit wie Erscheinung reichliche Mittel böten, unangefochten. Ursula Schult gehört zu den seltenen Schauspielerinnen der heutigen Bühnengeneration, bei denen nichts glitzert, nichts brilliert, keine raffinierte Routine dem Tagesruhm sich anpaßt. Hier ist ein solides Talent: im Gegensatz zu den frappierenden, bunten, leichtlebigen Faltern ganz und gar unpraktisch veranlagt. Hier ist eine realistische Darstellerin des Echt-Menschlichen, Verhärmten, Sorgenbeschwerten, vom Leben auf einen grauen Platz Verwiesenen, das, soferne sich nicht die (eher raren) den Typ heischenden großen Rollen ergeben, auch auf der Bühne allzu häufig in den ehrenvollen Hintergrund gerät.
Vielleicht ist alle diese Tristesse (die auch in optimistischeren Rollen im Hintergrund verharrt) zu prägnant, so daß bei der landläufigen, nicht so „literarisch beladenen” Verwendung der Eindruck einer gewissen Schwerfälligkeit entsteht — oder gar, wenn „zuwenig darzustellen” ist, ein Hauch von Blässe oder zu geringer fraulicher Wärme. Was aber einen auf längere Sicht berechneten Erfolg kaum behindern wird: Frau Schult ist für ihr Fach einfach noch zu jung. Hat auch etwas für sich.
Romuald Pekny, Wiener von Geburt, an deutschen Bühnen (zuletzt in Köln, zur Zeit in München) sehr begehrt, war kürzlich zweimal im Konzerthaustheater der Josefstadt zu sehen: In Musils „Vinzenz” und in James Lees „Karriere”. Er gehört der jüngeren Generation an, sowohl an Alter wie in dem sehr persönlichen Stil seiner Gestaltung. Pekny ist das, was man (nie ganz zu Recht) einen intellektuellen Schauspieler nennen mag — wiewohl er eine gewisse Maniriertheit nicht verschmäht. Er hat sie sich freilich auf eine ganz spezielle Weise zurecht- gerjchtet; so, daß ipajt, sie durchaus modern, reizvoll und pointiert empfindet.
Pekny kombiniert eine betont gewählte, oft leise persiflierende, melodische (und überaus korrekte) Formung seiner Worte mit dem nonchalanten, völlig ungezwungenen, nahezu privaten Auftreten eines gewandten, souveränen, intelligenten Typs. Da ist ein Unterspieler, von dem man stets das Gefühl hat, daß noch mehr zur Verfügung steht, als im Augenblick benötigt wird.
Das Süffisante liegt ihm, das Ironische ist ihm geläufig, das Phlegmatische, skeptisch Melancholische, Intelligente, das sich oft auf Abwegen zu einem „weltbürgerlichen” Zynismus befindet, setzt er mit wissenden, überzeugenden Effekten. Vor allem weiß er die Gewißheit zu verbreiten, daß er seine Rolle nicht nur schauspielerisch (perfekt) beherrscht, sondern daß er jeden Satz, den er sagt, so sehr versteht, als hätte er sich ihn selbst ausgedacht. Dies einer der Gründe dafür, daß man ihm alles glaubt.
Heinrich Trimbur verkörpert die freundlichen, die sympathischen Gesellen, wie aber auch diejenigen, vor denen man sich in acht nehmen sollte. Wenn in einer Rolle beides zusammentrifft, dann ist sie Trimbur auf den Leib geschrieben. Was freilich nicht etwa mit den üblichen Hochstaplerrollen verwechselt werden darf, mit den einnehmenden Elegants, mit dem gewissen Stich ins Aalglatt-Schurkische: dazu ist Trimbur (wiewohl er sicherlich auch solches zusammenbringt) zu männlich, zu sehr Charakterspieler. Zu „modern” in seiner gewandten Saloppheit. Und auch wohl zu sehr echter Komödiant.
Wenn er einen Schurken spielt, dann ist alle Schläue und Gerissenheit höchst glaubwürdig vorhanden, wenn er gutmütig und schüchtern auftritt (wobei meistens sehr viel Humor inbegriffen ist), dann überzeugt er nicht minder, nimmt für sich ein, hat die Zuschauer auf seiner Seite. Als heutiger, schneidender, intelligenter Sprecher zeigt er sich in Rollen, in denen Schärfe und Härte darzustellen sind; als gediegener, beherrschter, guter Schauspieler zeigt er sich in jeder Rolle: Er schreit nie.
Schauspieler wie Heinrich Trimbur sind unerläßlich im Ensemble. Schauspieler wie Heinrich Trimbur sind beliebt, vielseitig verwendbar, gleichmäßig erfolgreich in der Leistung, in großen Rollen ebenso „abendfüllend”, wie in kleineren Rollen profiliert und verläßlich. Schauspieler wie Heinrich Trimbur sind selten.