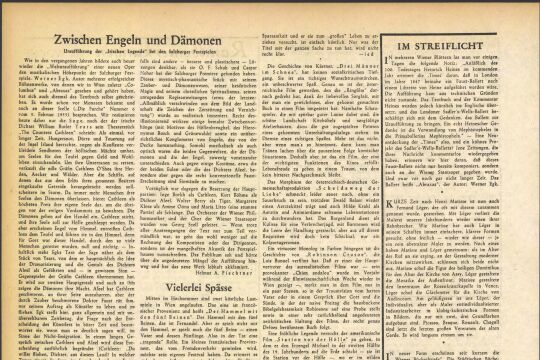Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Profil gesucht
Konzept oder Qualität der Aufführungen: an diesen beiden Eckpfeilern entzünden sich Diskussionen über Festspiele immer wieder. Die diesjährigen Berliner Festwochen enttäuschten in beiderlei Hinsicht etwas. Die Gastspiele schienen einfach bunt zusammengewürfelt — nimm, was du gerade bekommst. Zwei Gastensembles behält man in guter Erinnerung: Londons Young Vic mit Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ und das Pariser Theatre du soleil, dessen Revolutionsspektakel „1789“ Begeisterung hervorrief.
Konzept oder Qualität der Aufführungen: an diesen beiden Eckpfeilern entzünden sich Diskussionen über Festspiele immer wieder. Die diesjährigen Berliner Festwochen enttäuschten in beiderlei Hinsicht etwas. Die Gastspiele schienen einfach bunt zusammengewürfelt — nimm, was du gerade bekommst. Zwei Gastensembles behält man in guter Erinnerung: Londons Young Vic mit Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ und das Pariser Theatre du soleil, dessen Revolutionsspektakel „1789“ Begeisterung hervorrief.
Mäßigen Erfolg hatte Samuel Beckett, der nach dem „Letzten Band“ und „Endspiel“ nun mit „Glückliche Tage“ seine dritte Berliner Regie lieferte, die keineswegs „happy“ machte. Dasselbe ist von zwei New Yorker Off-Off-Broadway- Truppen zu berichten, die neben originellen Einfällen viel Unfertiges erkennen ließen. Auch das Belgrader Theater Atelje 212 kam — mit fünf verschiedenen Programmen •— nicht über einen Achtungserfolg hinaus. Verglichen mit anderen Jahren eine relativ matte Bilanz, die zudem die eigene Note vermissen ließ. So ähnlich werden auch in Wien und Zürich Festwochenprogramme gebastelt. Die Berliner Bühnen halten es mehr mit dem Festwochennachspiel, da sie ihre Premieren — darunter als interessanteste „Hölderlin“ (Peter Weiss), erst zum eigentlichen Saisonbeginn herausbringen.
Zunächst zum Erfreulichen. Der gute Ruf eilte dem Theatre du soleil voraus: aus Mailand, Vincennes und Zürich drang die Kunde von einem seltenen Triumph. In der Berliner Deutschlandhalle wiederholte er sich. Die Revolutions-Collage „1789“ („La revolution doit s’arrėter ä la perfection du bonheur“: Saint Just), von der jugendlichen Leiterin Ariane Mnouchkine in Szene gesetzt, ist Volkstheater im besten Sinne des Wortes. Auf fünf Spielpodien, geschickt im Raum verteilt, agieren die Mimen, überlaufen bei manchen Auftritten geradezu das Publikum, das immer wieder den Standort wechseln muß. Doch seit Ronconis „Rolando furioso“ sind die Berliner derlei gewohnt: Stehvermögen und Flucht in Sekundenschnelle ist ihnen nachzurühmen. Das Verständnis für das Stück wird durch gewisse Sim- plifizierung erleichtert: der Adel ist an dick aufgetragener Schminke und an dicken Bäuchen zu erkennen, cije Unterdrückten haben schwarz geränderte Augenringe. Musik dröhnt aus Lautsprechern überlaut: Händel, Mahler und Beethovens 7. Symphonie. Von ungeheurer Eindruckskraft der „Sturm auf die Bastille“ — die
Darsteller mischen sich unters Volk (sprich: Publikum), künden zuerst flüsternd, dann immer lauter von der Revolution, bis die Frohbotschaft schließlich zum rhythmischen Schreien anschwillt. Jahrmarktseligkeit gibt schließlich der Freude der endlich freien Bevölkerung Ausdruck. Gaukler und Akrobaten wirbeln über die Laufstege. Dazu ein wirksamer Kontrast: Marats einsamer Auftritt — gegen die Bour- geosie, die die Revolution verraten hat.
Die jungen Vollblutschauspieler von Londons Young Vic gewannen sich mit Shakespeares „Der Widerspenstigen Zähmung“ ebenfalls die Sympathie der Zuschauer. Die vom Leiter der Gruppe, Frank Dunlop, gemachte Inszenierung in der Mensa der Technischen Universität quoll über vor Gags. Freilich: die Emanzipationsfrage scheint diesen Engländern ziemlich „schnuppe“ zu sein, doch so sicher bin ich da auch nicht. Es begann damit, daß ein betrunkener Kesselflicker ins Bühnengeschehen platzte und durch Zwischenrufe die Shakespeare-Würde ständig in Frage stellte. Denise Coffey als Bianca brachte allein durch ihr Gekicher die Kartenbesitzer (und auch solche ohne Karte) zur Raserei. Die Kate der Joanna Wake jagte zunächst wie eine Furie übers Parkett. Schließlich wurde sie zum sanften Lämmchen, von Jimes Dales (Petrucchio) stimmlich und darstellerisch gebändigt. Die Zuschauer saßen auf Brettern, die Auftritte der Akteure erfolgten aus allen Richtungen, es gab Zwischenrufe, Gags, Überraschungen noch und noch. Ein Mordsspaß.
Pech hatte Samuel Beckett, sonst sieggewohnter Regisseur eigener Werke, in der Werkstatt des Schiller-Theaters. „Glückliche Tage“ zog er zu sehr in die Länge, legte unnötigerweise eine Pause ein, so daß die Spannung nicht durchhielt. Manche Details entzückten, doch fehlten Ironie und Bosheit, sonst die stärksten Waffen des Iren. Eva
Katharina Schultz als Winnie mühte sich zwar redlich, doch die Erinnerung an Maria Wimmer vermochte sie nicht zu verdrängen. Rudi Schmitt als Willie machte seine Sache brav, mehr nicht. Das Scheitern Becketts an Beckett war — nach zwei Berliner Regietriumphen — eine negative Sensation.
Wie erfrischend Theater selbst für Kinder sein kann, bewies in Berlin vor zwei Jahren das Bread and Puppet Theatre. Heuer scheiterte — ausgerechnet mit einem „Kinderstück“ — die New Yorker Manhattan Company, die „Alice in Wonderland“ spielte. Die Reithalle, ein Nebenbau der Deutschlandhalle, gab dazu einen ungewohnten Rahmen ab. Unter Balken mußte man sich durchzwängen, um ins Innere zu gelangen. Pferdegeruch tat das übrige, um Snobs auf ihre Rechnung kommen zu lassen. Andrė Gregory hat allerdings tüchtige Schauspieler. Am besten gelangen ihnen das Imitieren und „Glossieren“ der verschiedenen Tiere, die verrückte Teegesellschaft und die Unterhaltung mit der Raupe. Doch das Piepsen und Kreischen der Darsteller verscheuchte immer wieder das Kinderland. Eher Alice im Schreckensland, ein Alptraum unbewältigter Ängste.
Enorme Wandlungsfähigkeit zeichnet die Mitglieder des New Yorker La Mama Theatre aus, die von der farbigen, temperamentvollen Intendantin Ellen Stewart, kurz Mama genannt, ganz schön gedrillt wurden. Stimmen haben sie wie ausgebildete Opernsänger, Bewegungsakrobaten sind sie außerdem. Doch wird man den Verdacht nicht los, die Darsteller wollen eigentlich nur beweisen, was für prima Leute sie sind. Die Stückwahl spricht da Bände. An einem der Abende sieht das dann so aus: Vor der Pause eine Art Schauerdrama, „Die einzige Eifersucht der Emer“ nach W. B. Yeats, mit Nebelschwaden und Kerzen. Das entlockte den Besuchern immerhin Husten. Nach der Pause: „Renard“ nach
Strawinsky. Flott getanzt, gespielt, gesungen — nicht ohne Verzicht auf Klamauk. Wenn der Fuchs — mit meterlangem Schwanz — als Nonne verkleidet über die Bühne wedelt, wird’s wirklich unerträglich. Trotzdem gefiel es einigen sehr.
Fünf verschiedene Vorstellungen bot das Atelje-Theater 212 aus Belgrad, von denen ich zwei sah. „Hamlet im Keller“, eine Shakespeare-Adaption von Slobo- danka Aleksič, der auch Regie führte, dauerte knap eine Stunde. Die verschiedenen Rollen wie Hamlet, Ophelia, Laertes usw. werden von allen gespielt, das heißt ständig wechseln die Rollen, was zeitweise amüsant, auf die Dauer jedoch etwas steril wirkt. Songs und Pantomimen würzten das Spiel. Tieferen Sinn entdeckte ich keinen. Problematisch wurde es bei der „Operette“ von Witold Gombrowicz im Hebbel- Theater. Da die Festwochenleitung großzügig auf die Simultananlage verzichtete, verpuffte ein Großteil der Wirkung. Kam dazu, daß die Regie von Bodgan Jerovic zwar durchaus Operette im Stile der „Lustigen Witwe“ spielen ließ, aber das Hintergründige zuwenig hervorkehrte. Barmusik wurde vom Musik- Ensemble „Stari traceri“ jedoch tüchtig gemacht. Zoran Radmilovič (Meister Fior) und Bozidar Pavice- vic-Longa als polternder Revoluzzergraf überzeugten am meisten, Nada Sirnic genoß ihre Nacktheit am Schluß sichtlich. Zu rühmen: die farbenfrohen Kostüme und das Bühnenbild von Vladislav Lalicki. (Wir brachten bereits ein Bild und einen Text Gombrowiczs.)
Die Idee von Festwochenintendant Walter Schmieding, der in den vergangenen Jahren prächtige Ensembles nach Berlin geholt hat, ist, die Festveranstaltungen „kleiner“ zu machen, weniger Aufführungen also! Das ist richtig! Doch sollte man eine spezielle Berliner Note spüren.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!