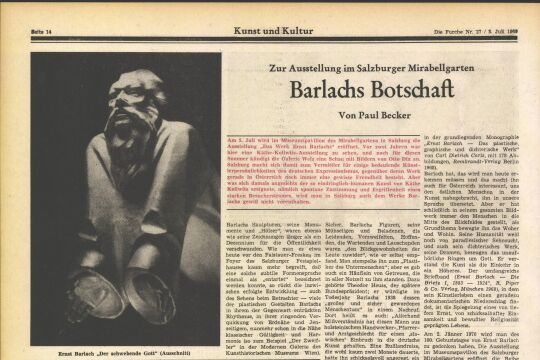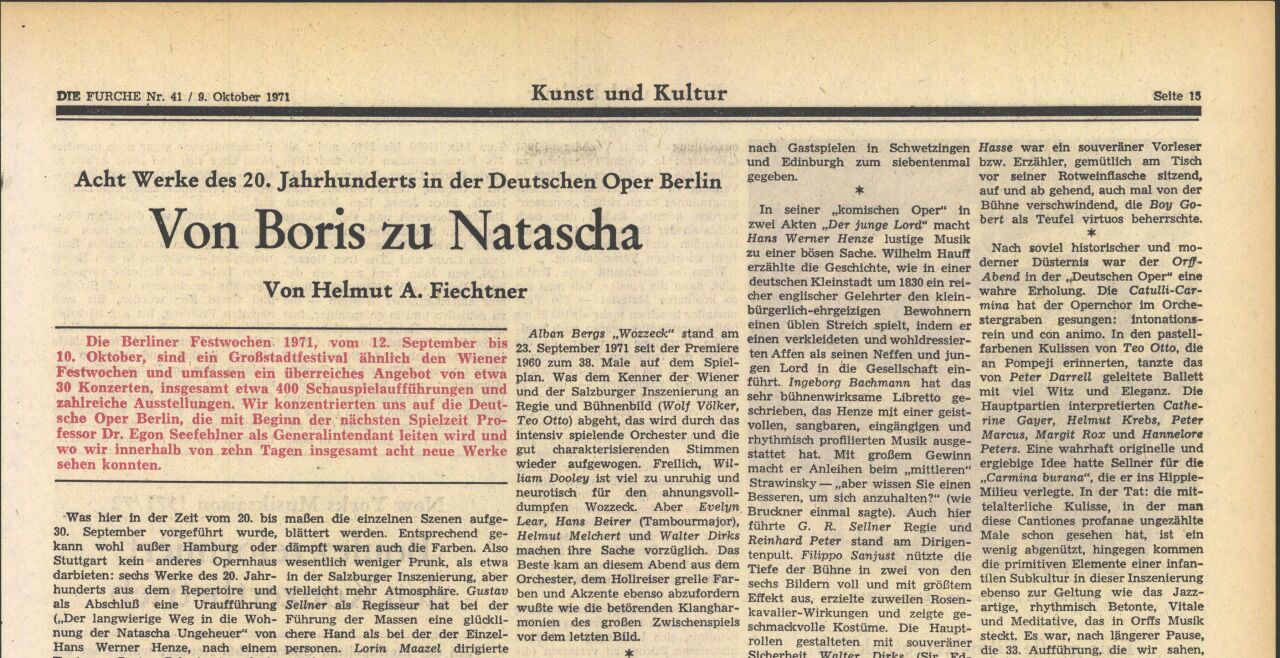
Von Boris zu Natascha
Die Berliner Festwochen 1971, vom 12. September bis 10. Oktober, sind ein Großstadtfestival ähnlich den Wiener Festwochen und umfassen ein überreiches Angebot von etwa 30 Konzerten, insgesamt etwa 400 Schauspielaufführungen und zahlreiche Ausstellungen. Wir konzentrierten uns auf die Deutsche Oper Berlin, die mit Beginn der nächsten Spielzeit Professor Dr. Egon Seefehlner als Generalintendant leiten wird und wo wir innerhalb von zehn Tagen insgesamt acht neue Werke sehen konnten.
Die Berliner Festwochen 1971, vom 12. September bis 10. Oktober, sind ein Großstadtfestival ähnlich den Wiener Festwochen und umfassen ein überreiches Angebot von etwa 30 Konzerten, insgesamt etwa 400 Schauspielaufführungen und zahlreiche Ausstellungen. Wir konzentrierten uns auf die Deutsche Oper Berlin, die mit Beginn der nächsten Spielzeit Professor Dr. Egon Seefehlner als Generalintendant leiten wird und wo wir innerhalb von zehn Tagen insgesamt acht neue Werke sehen konnten.
Was hier in der Zeit vom 20. bis 30. September vorgeführt wurde, kann wohl außer Hamburg oder Stuttgart kein anderes Opernhaus darbieten: sechs Werke des 20. Jahrhunderts aus dem Repertoire und als Abschluß eine Uraufführung („Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer“ von Hans Werner Henze, nach einem Text von Gaston Salvatore) und als Gedachtnisveranstaltung für den in diesem Jahr verstorbenen Strawinsky eine Neuinszenierung der „Geschichte vom Soldaten“. Diese moderne Woche war mit einem neunteiligen Verdi-Zyklus gekoppelt und bildete gleichsam eine Retrospektive der Ära Sellner anläßlich des zehnjährigen Jubiläums des neuen Hauses in der Bismarckstraße.
Eingeleitet wurde die Serie neuer Werke mit dem musikalischen Volksdrama „Boris Godunow“ von Modest Mussorgsky, das in der Bearbeitung Schostakowitschs vorgeführt wurde und das mit seiner Bilderbogentechnik an der Schwelle zum modernen Opemtheater steht Der Bearbeiter, ein großer Bewunderer seines originellen Landsmannes, ließ Rimsky-Korsakows glättende und wirksame Adaptierung unberücksichtigt, ist — natürlich — auf die Urfassung zurückgegangen, hat deren herbe, oft harte Klangfarben und Harmonien nach Möglichkeit belassen und nur offensichtliche Ungeschicklichkeiten der Instrumentation des kompositorischen Dilettanten, der Mussorgsky war, beseitigt bzw. ausgebessert. Selbstverständlich hat Schostakowitsch auch die ursprüngliche Szenenfolge wiederhergestellt. Erstaunlich, was die Deutsche Oper hier an großartigen Stimmen einsetzen konnte, die den Abend beherrschten: Martti Tal- vela als Boris, Helmut Melchert — Fürst Schuiski, ferner Carlo Cos- sutta, William Murray, Bengt Rund- gren und die anmutige Janis Martin als Wojewodentochter Marina. Der Ausstattung durch Michel Raffaelli lag als Konzept .eine alte Chronik zugrunde, in der gewissermaßen die einzelnen Szenen aufgeblättert werden. Entsprechend gedämpft waren auch die Farben. Also wesentlich weniger Prunk, als etwa in der Salzburger Inszenierung, aber vielleicht mehr Atmosphäre. Gustav Sellner als Regisseur hat bei der Führung der Massen eine glücklichere Hand als bei der der Einzelpersonen. Lorin Maazel dirigierte mit bemerkenswerter Intensität das präzise und klangschön spielende Orchester.
Wie sich die Zeiten ändern! Wir erinnern uns noch, als ob es gestern gewesen wäre, an die Erstaufführung von Schönbergs „Moses und Aron“ anno 1959 im alten Haus, dem ehemaligen Theater des Westens. Der Skandal war so heftig, die Demonstrationen so laut und gehässig, daß man Mühe hatte, die Musik im Zusammenhang zu aperzipieren. Damals konnte Hermann Seherchen den Fortgang der Aufführung nur durch den Appell erreichen: „So lassen Sie mich mit meinen Musikern doch endlich arbeiten.“ Das schlug bei den fleißigen Berlinern ein. — „Moses und Aron“ ist inzwischen über viele Bühnen gegangen, auch als Gastspiel der Deutschen Oper, die wir ja auch in Wien gesehen haben. Aber das Werk hat an geistigem Anspruch und Härte seiner Tonsprache nichts eingebüßt. Man hat es den Berlinern in 58 Aufführungen eingehämmert. Nun sitzen sie zwar ruhig und applaudieren. Aber wie es ihnen gefällt, kann man nur fragmentarischen Pausengesprächen entnehmen. Die stilisierende Ausstattung von Michel Raffaelli ist inzwischen klassisch geworden und in manche Schullesebücher eingegangen; immer noch sind Josef Greindl und Helmut Melchert die eindrucksvollen Protagonisten. Dem Dirigenten Harold Byms, der ein gründlicher Kenner der Wiener Schule und ihr überzeugender Interpret ist, hatte man, bevor er von Bruno Madema das Werk übernahm, sechs Proben bewilligt. Das gibt’s wohl auch nur in Berlin…
Albcm Bergs „Wozzeck“ stand am 23. September 1971 seit der Premiere 1960 zum 38. Male auf dem Spielplan. Was dem Kenner der Wiener und der Salzburger Inszenierung an Regie und Bühnenbild (Wolf Völker, Teo Otto) abgeht, das wird durch das intensiv spielende Orchester und die gut charakterisierenden Stimmen wieder aufgewogen. Freilich, William Dooley ist viel zu unruhig und neurotisch für den ahnungsvolldumpfen Wozzeck. Aber Evelyn Lear, Hans Beirer (Tambourmajor), Helmut Melchert und Walter Dirks machen ihre Sache vorzüglich. Das Beste kam an diesem Abend aus dem Orchester, dem Hollreiser grelle Farben und Akzente ebenso abzufordern wußte wie die betörenden Klangharmonien des großen Zwischenspiels vor dem letzten Bild.
Die Oper in vier Akten, „Melusine“, an dieser Stelle anläßlich ihrer Uraufführung im Schloßparktheater zu Schwetzingen bereits besprochen, schrieb der Berliner Komponist Ari bert Reimann auf ein Libretto von Claus Henneberg, das auf dem gleichnamigen Schauspiel von Yvan Goll basiert. Wir hatten uns, dem Sujet entsprechend und nach den bisherigen Berichten, eine „schönere“, das heißt nicht so durchweg dissonante, mehr lyrische und atmosphärische Musik erwartet. Aber Reimann hat seine Grautöne (die dem Ballett „Vogelscheuchen“ angemessen waren) kaum verändert: harte Bläserakkorde und häßliche Glissandi bestimmen das Klangbild des ersten Teils. Erst im 4. Akt gibt es lyrische Stellen von herbem Reiz. Eine großartige Leistung bot die Bulgarin Slavka Todorova Taskova mit halsbrecherischen Koloraturen, die Reimann zuweilen auch Männerstimmen zumutet — wo sie wenig angenehm wirken. (Die Titelpartie sang bei der Premiere Catherine Gayer.) Melusines Mann Oleander war von Donald Grobe glaubwürdig dargestellt und gesungen, Pythia und Oger, die beiden dämonischen Wesen, die Melusines Geschick bestimmen, wurden höchst eindrucksvoll von Martha Modi und Josef Greindl gegeben. Melusines Opfer (Geometer, Maurer und Architekt) waren die Herren Sardi, Lang und Driscoll. Ihr Verehrer, der Graf von Lusignan, war Barry McDaniel. Die Bühnenbilder von Gottfried Pilz vermögen keine Atmosphäre zu schaffen. Ihnen entspricht die Regie von Sellner. Reinhard Peters zeigte sich mit der Partitur bestens vertraut. Vom Ensemble der Deutschen Oper wurde „Melusine“ am 25. September nach Gastspielen in Schwetzingen und Edinburgh zum siebentenmal gegeben.
In seiner „komischen Oper“ in zwei Akten „Der junge Lord“ macht Hans Werner Henze lustige Musik zu einer bösen Sache. Wilhelm Hauff erzählte die Geschichte, wie in einer deutschen Kleinstadt um 1830 ein reicher englischer Gelehrter den kleinbürgerlich-ehrgeizigen Bewohnern einen üblen Streich spielt, indem er einen verkleideten und wohldressierten Affen als seinen Neffen und jungen Lord in die Gesellschaft einführt. Ingeborg Bachmann hat das sehr bühnenwirksame Libretto geschrieben, das Henze mit einer geistvollen, sangbaren, eingängigen und rhythmisch profilierten Musik ausgestattet hat. Mit großem Gewinn macht er Anleihen beim „mittleren“ Strawinsky — „aber wissen Sie einen Besseren, um sich anzuhalten?“ (wie Bruckner einmal sagte). Auch hier führte G. R. Sellner Regie und Reinhard Peter stand am Dirigentenpult. Filippo Sanjust nützte die Tiefe der Bühne in zwei von den sechs Bildern voll und mit größtem Effekt aus, erzielte zuweilen Rosenkavalier-Wirkungen und zeigte geschmackvolle Kostüme. Die Hauptrollen gestalteten mit souveräner Sicherheit Walter Dirks (Sir Edward), Barry McDaniel (als sein kalt-arroganter Sekretär), Loren Driscoll als äffischer Neffe und junger Lord; Luise, dessen anmutiges Opfer, war die hübsche Gerti Zenner, Patricia Johnson gab die ehrgeizige Baronin Grünwiesel. — Wir hörten die 30. Aufführung der Oper, die vom Publikum mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde, obwohl sie den Deutschen recht arg am Zeuge flickt. Das Werk kann jedem leistungsfähigen Opernhaus, also auch dem unseren, bestens empfohlen werden.
Weniger zu empfehlen, ja zu warnen ist vor Henzes jüngstem Opus „Der langwierige Weg in die Wohnung der Natascha Ungeheuer“, zumal es sich nicht um eine Oper, sondern um ein „concerto seenico“ handelt. Der Text des jungen, in Berlin lebenden Chilenen Gaston Salvatore ist weitgehend unverständlich. Das Programm erläutert: es gehe um beziehungsweise gegen den Linksbourgeois, der den Sozialismus verraten habe, nicht zur Revolution finden kann, auf seinem bisherigen Weg umkehren und von vorne anfangen müsse, um in die Wohnung der Natascha Ungeheuer zu gelangen. Eine Frau dieses Namens soll es tatsächlich in Berlin-Kreuzberg geben, aber die Autoren versichern, daß sie deren Namen nur als „Metapher“ (wofür?) benutzt haben. Was wir sahen, waren drei Gruppen kostümierter Instrumentalisten, die aus je fünf Spielern bestanden: Polizisten in Stahlhelmen spielten Blechblasinstrumente, eine weißgekleidete Gruppe von Ärzten mit Kopfverband bildete ein Salonorchester, und im Hintergrund agierte eine Jazz-Combo mit Hammond-Orgel. Den Text sprach (undeutlich, aber dramatisch) William Pearson. Zwischendurch huschte wie ein kleiner schwarzer Teufel der junge Japaner Stomų Yamashta über die Bühne und hämmerte nicht nur auf sein Schlagwerk, sondern auch auf ein Autowrack. — Warum denn die Ärzte Kopfverbände trügen, wurde der Textautor auf einer Pressekonferenz gefragt. Sje repräsentierten die Bourgeoisie, und diese sei krank. Wer denn, seiner Meinung nach, gesund sei? „Eine durchorganisierte kommunistische Gesellschaft.“ Über die Musik Henzes, die Bernhard Lang dirigierte, ist ebensowenig zu sagen wie über diesen Ausspruch. Es ist eine Allerweltsmoderne, die niemanden freut. Ein Teil des Premierenpublikums protestierte heftig.
Den zweiten Teil des Programms bildete Strawinskys „Geschichte vom Soldaten“: von Sellner inszeniert, von Helmut Baumann choreogra- phiert und von Hubert Aratym reizvoll-verspielt ausgestattet. Er griff dabei auf das Konzept der Wanderbühne zurück, für die das Werk ursprünglich (1918) geschrieben war. Unter der Leitung von Caspar Richter spielte ein Septett mit bemerkenswerter Sicherheit die bereits klassisch gewordene Musik. O. E.
Hasse war ein souveräner Vorleser bzw. Erzähler, gemütlich am Tisch vor seiner Rotweinflasche sitzend, auf und ab gehend, auch mal von der Bühne verschwindend, die Boy Go- bert als Teufel virtuos beherrschte.
Nach soviel historischer und moderner Düsternis war der Orff- Abend in der „Deutschen Oper“ eine wahre Erholung. Die Catulli-Car- mina hat der Opemchor im Orchestergraben gesungen: intonationsrein und con animo. In den pastellfarbenen Kulissen von Teo Otto, die an Pompeji erinnerten, tanzte das von Peter Darrell geleitete Ballett mit viel Witz und Eleganz. Die Hauptpartien interpretierten Catherine Gayer, Helmut Krebs, Peter Marcus, Margit Rox und Hannelore Peters. Eine wahrhaft originelle und ergiebige Idee hatte Sellner für die „Carmina burana“, die er ins Hippie- Milieu verlegte. In der Tat: die mittelalterliche Kulisse, in der man diese Cantiones profanae ungezählte Male schon gesehen hat, ist ein wenig abgenützt, hingegen kommen die primitiven Elemente einer infantilen Subkultur in dieser Inszenierung ebenso zur Geltung wie das Jazzartige, rhythmisch Betonte, Vitale und Meditative, das in Orffs Musik steckt. Es war, nach längerer Pause, die 33. Aufführung, die wir sahen, und Heinrich Hollreiser, der das Werk im Opernhaus zum erstenmal dirigierte, erwies nicht nur seine souveräne Beherrschung der Partitur, sondern auch des Riesenapparats von Chor, Sängern und Tänzern. (Von den Solisten seien wenigstens Catherine Gayer und Martin Valentin genannt.)
Obwohl diese Inszenierung bereits 1968 zum erstenmal gezeigt wurde, ist sie wie von heute. Denn erst vor kurzem haben die Hippies den Kurfürstendamm friedlich erobert. Dort sitzen sie in einer mehrere hundert Meter langen Reihe auf dem breiten Gehsteig zwischen Joachimstaler- straße und Kempinski, gegenüber den Luxusläden. Da sitzen sie zwischen Negern, Indern und anderen Farbigen, allein oder zu zweit, die Kinder jener, die Polen überfallen und Frankreich erobert haben, da sitzen sie in der warmen Herbstsonne, langhaarig und papageienbunt gewandet, lebendiger Protest gegen jede Uniform, vor sich auf dem Boden vielerlei selbstfabrizierten Schmuck anbietend. Es ist wie ein orientalischer Trödelmarkt mitten in der Stadt, von der aus einmal die Welt beherrscht werden sollte. „O fortūna“, so beginnt der große Chor in Orffs Carmina burana, „ve- lut luna, statu variabilis…“
Die Berliner haben sich an die langhaarigen jungen Leute gewöhnt. Sie bleiben stehen, lassen sich die einzelnen Kunstwerke erklären, beraten sich, was für die Frau, die Tochter oder die Freundin geeignet sein mag — und kaufen. Das Geschäft floriert, und alle sind zufrieden. Die Polizei wollte vor einigen Wochen den „Ku-Damm“ räumen, aber die „öffentliche Meinung“ war dagegen. Die Berliner sind eben helle Köpfe. Und sie schauen auf die Blumenkinder nicht ohne Sympathie, weil sie etwas tun. Nun hat man sie auch noch auf die Bühne der Deutschen Oper gebracht. Wie sich die Zeiten ändern! „O fortūna, velut luna..