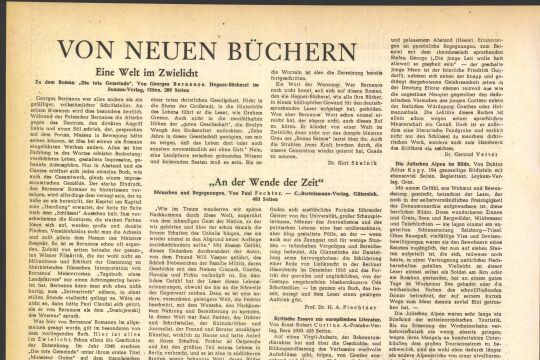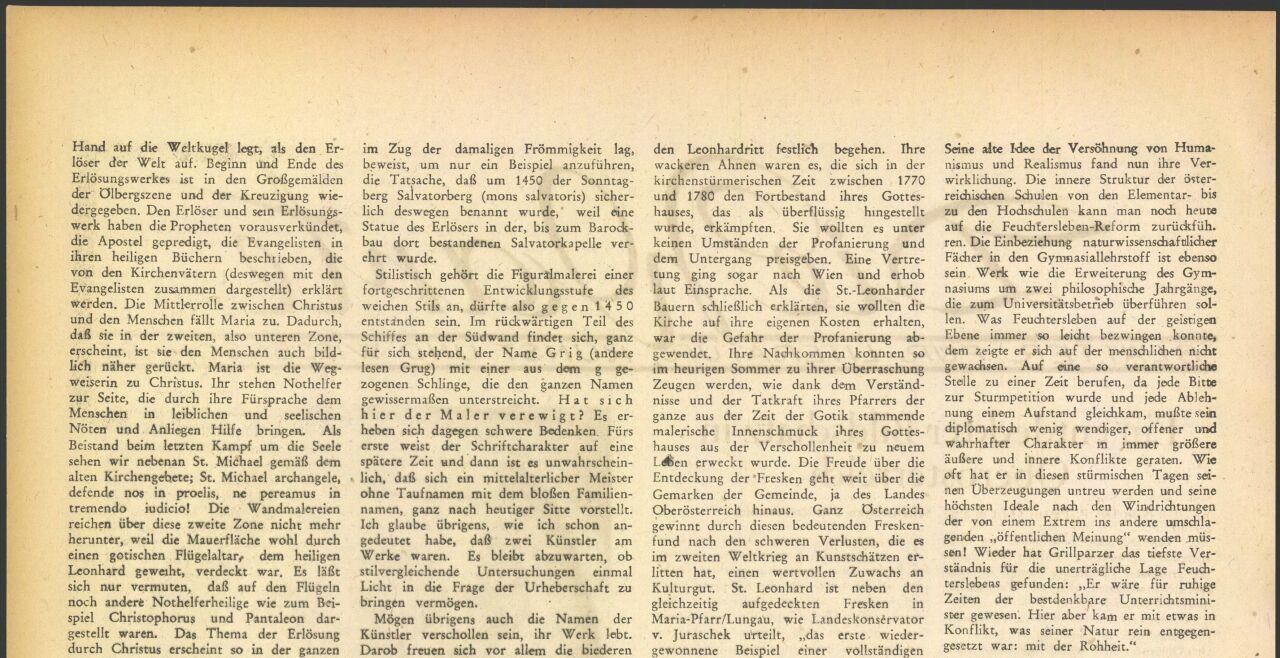
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Osterreichische Landschaft im neueren Gedicht
Nicht von dem Verfahren Lenaus oder Eichendorffs, dessen schönste Naturlieder vielfach der dankbaren Rückerinnerung an erwanderte österreichische Landschaft ihr Leben verdanken, ist hier die Rede, von dem Verfahren, heißt das, landschaftliche Elemente und Motive als stimmungsbildenden Bebel“ zu verwenden, als Typus, Tropus, Figur, um mit Landschaft des Raumes Landschaft nVi Seele zu schaffen:
Der Hirt bläst seine Weise, Von fern ein Schuß rtoch fällt Die Wälder rausdien leise Und Ströme tief irr Feld.
Nur hinter jenem Hügel Noch spielt der Abendschein Oh. hätt' ich, hau' ich Flügel, Zu fliegen da hinein! Nicht davon also, wieEichendorff in dieser seiner „Abendlandschaft“ verfuhr, ist hier die Rede, sondern von den Bemühen der neuen Realisten innerhalb der österreichischen Lyrik der Gegenwart, österreichische Landschaft um ihre- selbst willen, in ihrem Sonder-wer* und “irer Eigenart, unmittelbar und gleichsam als Selbstzweck im Gedichte Bild und Laut werden tu lassen. Wir bekommen es dem-'idi mit, im weitesten Sinne, dinglicher Lyrik zu tun ui d hören uns, weil dieser Gegenhak im Nu vkiles klären wird, zunächst „Im Lößland“ von Theodor Krämer am:
Unterm Laub wohnt der Stamm, unterm Roggen
der Grund,
unterm Rasen Gestein und Gewalt;
jedes Jahr, wann im Herbstwind die Stauden
sich drehn
und die Kleestoppeln schwarz auf den Lößleiten
stehn,
wird urplötzlich das Land wieder alt.
Jedes Bachbett wird steil, jeder Hohlweg wird
tief
(und sie hatten sich grün schon verflacht); aus der Baumgruppe hebt sich der urbare Kern, und die Felsblöcke darben, als wär'n sie von fern in die Eb'ne gerutscht über Nacht.
Mit den Kämmen aus Mergel und Löß reißt der
Pflug
die versteinerten Spitzschnecken frei; durch die Ranken stößt schwärzlich der Fichten-
holzpfahl,
iteigt der Weinberg in streifigen Stufen zu Tal, tancf die Luft teilt ein schartiger Schrei.
Um nun klar zu machen, wie es dazu kam, • dazu kommer mußte, weil es die Geschehensdialektik im Auf und Ab kunstgeschichtlichen Werdens und Vergehens mit ihrer unerbittlichen Logik oder, wer will, Mechanik so verlangte, müssen wir an die geschichtliche Grundlegung unseres Themas heran. Wir wollen sie abrißweise, in gedrängtester Kürze geben.
Die österreichische Lyrik der und nach der Jahrhundertwende, die Lyrik Hofmannsthals und des jungen, weltmännischen Schaukai (vor dessen Abkehr hievön zum Religiösen und Intimen), war symbolistische oder impressionistische Ästhetendichtung. Oder sie war, wie die Lyrik des mittleren Rilke, des Rilke der „Neuen Gedichte“, wenn auch nicht Impressionismus schlechthin, so doch ganz auf Impressionen sich stützende „phänomenologische“ Bild-, Ding- und Gestaltenlyrik. Vor allem anderen aber war sie Kultur, ja Kultus der sprachlichen Form, auch ihre Landschaftslyrik, und das in dem gleichen oder ungefähren Maße wie Georges subtile Naturlyrik etwa des „Jahres der Seele“, die es unternimmt, . zu den Urformen der Natur gestaltend vorzudringen, die denn auch — die Jahreszeiten — hier in Bildern von räumlicher Gegenständlichkeit und zugleich tiefster Seelenhaftigkeit erscheinen, so daß sich, um es annähernd mit Gundolf zu sagen, Natur und Seele in ursprünglicher Einheit aussprechen, Urformen der Natur sich als Urformen der Seele offenbaren, Stimmungsbilder zu Schicksalsbildern werden. Der Leser entscheide selbst, welchem der beiden eingangs angedeuteten Verfahren diese Dichter notwendigerweise nahebleibcn. Er bedenke aber auch die große Gefahr, die für, die kleineren Geister in der Nachfolge dieser Meister damit zu drohen begann, die Gefahr des gefällig glatten Leerlaufes der verabsolutierten Form.
Nodi vor dem Kriege kulminiert der österreichische E x prcssionisnius in der I.yrik des Salzburgers Georg T r a k 1. Damit nun wird eine Entwicklung eingeleitet, die, zumal als Spätexpressionismus noch der ersten Nachkriegsjahre, wieder eine andere Gefahr heraufbeschwören mußte, die Gefahr der völligen Verflüchtigung im Ideelen und Subjektivistischen. Schon wenn Trakl singt:
Voll Früchten der Holunder;
ruhig wohnt die Kindheit in blauer Höhle —
so ist bei alledem, wie hier Naturdinge oder -Vorgänge auf den ersten Anschein hin noch deutlich und mit ausdrücklichen Namen genannt und benannt werden, dennoch nur mehr ein — Geistiges darunter gemeint und zu verstehen. Mählich wurde so die Lyrik einer nahen Vergangenheit immer vergeistigter oder auch nur versponnener, jedenfalls immer substanzloser und unanschaulidier, nur mehr wenigen nacherlebbar, ja oft nur mehr sich selbst verständlich. Wieder einmal geriet sie in Gefahr, völlig den Boden unter den Füßen zu verlieren.
Mithin war es folgerichtig, wenn dagegen dingfromm und naturnah angelegte und überdies dem bäuerlichen Leben noch stark verbundene Künstler sich für die Umkehr zu erdiger Gegenständlichkeit — ein Gedichtbuch dieser Art, das Hans Deissingers, heißt bezeichnenderweise „Erde, wir lassen didi nicht!“ — zu gebundener, objektiver Bodenständigkeit entschieden: der neue Realismus auch im lyrisdien Gedichte wird geboren. Hier leiten ihn Felix Braun und Max Meli in die Wege. So vorbereitet, höre man sich einige Strophen aus Brauns Gedicht „Die Berge“ an:
Da ragten Berge himmelan,
Grünmoosig und felsigkahl,
Und einzelne Fichten hingen daran,
Und ein Wasser stürzte zu Tal.
Das Wasser, ja, das brauste so laut,
Weiß schieiernd mit gläsernem Bug,
Kalt war's — mir sdiauderte Mark und Haut.
Dumpf fort stampfte der Zug.
Und höher und höher stieg das Gewänd. Woher so viel Wasser quoll?
Es floß vielleicht aus dem Firmament,
Dunkelblau und wolkenvoll. „Das ist das Gesäuse“, sprach jemand Meine Mutter nickte bloß. , Heftig griff sie nach meiner Hnad Und ließ sie nicht mehr los.
Und die Berge blieben. Zum erstenmal
Im Sommer sah ich Schnee.
„Eine Gemse!“ rief meine Mutter. „Da!“
Aber es war nur ein Reh.
Unter hölzerner Brücke die Ache warf
Grünweißen Wellengischt.
Ah, wehte die Luft eisigkühl und scharf,
Mit Nadel- und Harzduft vermischt! — •
Und man ermesse, was Max Meli mit den Mitteln der Sprache zu bilden gelang, an einem Gedichte, wie „Dachstein von Aussee“.
Als ob in Trümmer gespalten Ein göttlicher Wohnsitz war', Fielen Berggestalten Wahllos umher.
Jede mit einsamen, hagern Flanken für sich allein; Wie sich Raubtiere lagern Im Sonnenschein.
Wächter für einen König, Schläfernd im Licht. Doch wie er selber wenig Zu Dienern spricht.
Zu seiner Ferne wendet Er sich ab vom Tal. Der weiße Mantel blendet Manchesmal.
Und manchmal tief mit Schleiern Hüllt er sich ein. Sich selbst geheim zu feiern, Bleibt er allein.
Und etwas drin beim Schimmer Begibt sich dort.
Als sank es noch mehr in Trümmer, Träumt alles fort.
Mit rein-sachlicher oder beseelt-sachlicher Landschaftsdichtung gesellten sich ihnen bald Jüngere bei. Mit einem Weitblicke, der nur dem wesentlichen Talente eignet, sah Theodor Kramer, was zunächst zu tun war, wobei seiner Kunstabsicht die eigene Anlage vorteilhaft entgegenkam. Er ist reiner Realist, im Sjnne und Stile der „neuen Sachlichkeit“, er verfährt am konsequentesten, weil er einmal weltanschaulich sich mit dem Positivismus bescheidet; darüber nicht hinausgeht, dann aber, formal, indem er seine Diktion zu äußerster Härte und Unerbittlichkeit erzieht. Sie wirkt bisweilen geradezu spröde, verzichtet auf alles Geschleckte und Gestriegelte, scheut selbst vor brutalen Prosaismen mitten im Vers und in der Strophe nicht zurück. Auch bevorzugt er, das liegt in der Natur der Sache, die Grenzgebiete und -formen zwischen Lyrik und Epik anstatt der reinen Lyrik, die mehr von der Sprache an sich her lebt.
Richard B i 11 i n g e r hingegen, und die Folgenden, zählen schon zur beseelt realistischen Richtung. Aus verschiedenen Quellen stammen die hiefür notwendigen weltanschaulichen Zuflüsse. Bei Billinger selbst aus seiner etwas verqueren, barocken Katho-lizität. Be' Hans L e i f h e 1 m, wenn ihn nicht sein Hang zur Wissenschaftlichkeit bis zum ausgesprochenen Lehrgedicht treibt,also m seinen ganz Melodie, ganz Musik gewordenen rein-lyrischen Naturgedichten, aus der Philosophie Schellings. Bei Hans D e i s s i n g e r aus dem Pantheismus. Bei Guido Zernatto — wir müssen uns hier auf cüe bedeutendsten Erscheinungen beschränken — aus einer (bewußt oder unbewußt, gleichviel) Plotin benachbarten, leicht mystischen Chrisrjlichkeit.
Gemeinsam ist dieser neurealistischen Landschaftsdichtung in Österreich der Widerstand und Widerwille gegen die expressionistischen Exzesse der Unsachlichkeit in der, ihrer eigenen vorangegangenen, von ihnen überwundenen Epoche, aber auch gegen den formalistischen Leerlauf und die etwas morbide Verzärtelung der Dinge und Formen, wie sie die Rilke-Nachfolge mit sich brachte. Freilich, die Gefahren, die den neuen Realismus im lyrischen Gedicht seinerseits umstellen, sind nicht minder ernsthaft und groß. Vor allem die. der Verabsolutierung des Stofflichen (auf Kosten des geistigen Gehalts und der vollkommenen Form), der unmäßigen Überschätzung des S t o f f e s, als wäre dieser von sich aus schon Kunstausdruck, und die immerwährende Gefahr, zuviel epische Elemente in die Lyrik mit einzuführen. Und so.ist es verständlich, daß gerade in östereich die Reaktion auf ihn selbst zu erstehen begann in der neuen Klassik Josef Weinhebers.
Den Gefahren des realistischen Kunststils in der Lyrik sind die führenden Künstlerpersönlichkeiten eben als Persönlichkeiten mit vielen Gedichten entronnen. Am glücklichsten Zernatto, was mich schon 1932 in meiner Schrift „Die neue Lyrik in östereich“ bestimmen mußte, in ihm einen Gipfel zu sehen. Er ist zugleich der — Umsdilag. Denn Zernattos im Irdischen so lebenssicher und stämmig wie Bäume wurzelnder Gedichte — wiegen manchmal ihre Kronen schon wieder in göttlicher Überdinglichkeit und Überwirklichkeit. Sie ziehen zu gleicher, Zeit ihre Nahrung aus Rationalem und Irrationalem, Zeitlichem und Außerzeitlichem. Hinter dem vordergründig transparenten Bild leuchtet wie selbstverständlich wieder ein ewiger Sinn; ein mehr als immanenter, ein transzendenter. Am augenfälligsten wird dieser Vorgang, wenn er sich, schrittweise, in einem und demselben Gedichte vollzieht, wenn etwa, in einem Gedichte, wie „Wegen des Unfriedens in mir“, der Beginn ganz in irdischer Landsdiaft und Heimat wurzelt, während es, bis zum Ende, hinauf in die des Geistes erwächst:
Im Türkenstroh hinter dem Stall schläft der
Hund,
Ich hör' sein Gebell in der Nacht jede Stund'. Wenn einer vom Bach gegen's Dorf abwärts geht Oder einer beim Brunnen am Holzersteig steht.
Denn der Weg von tief innen ist weit bis zum
Wort,
Das ich sagen möcht'. bis ich es sag, ist es fort, Bin verschlossen, und doch treibt's gewaltig in
mir. '
Ich ertrag's nicht, ich habe den Himmel in mir.
Der aufmerksame Leser merkt, wie sich hier auch Anfang und Ende dieses Aufsatzes wieder leise berühren. Das wird ihm zu denken geben.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!