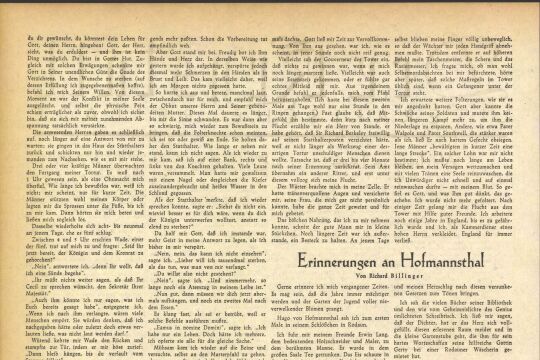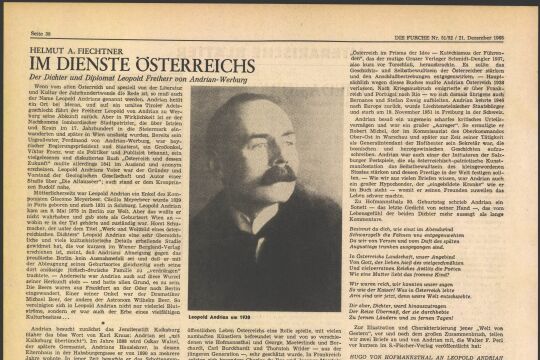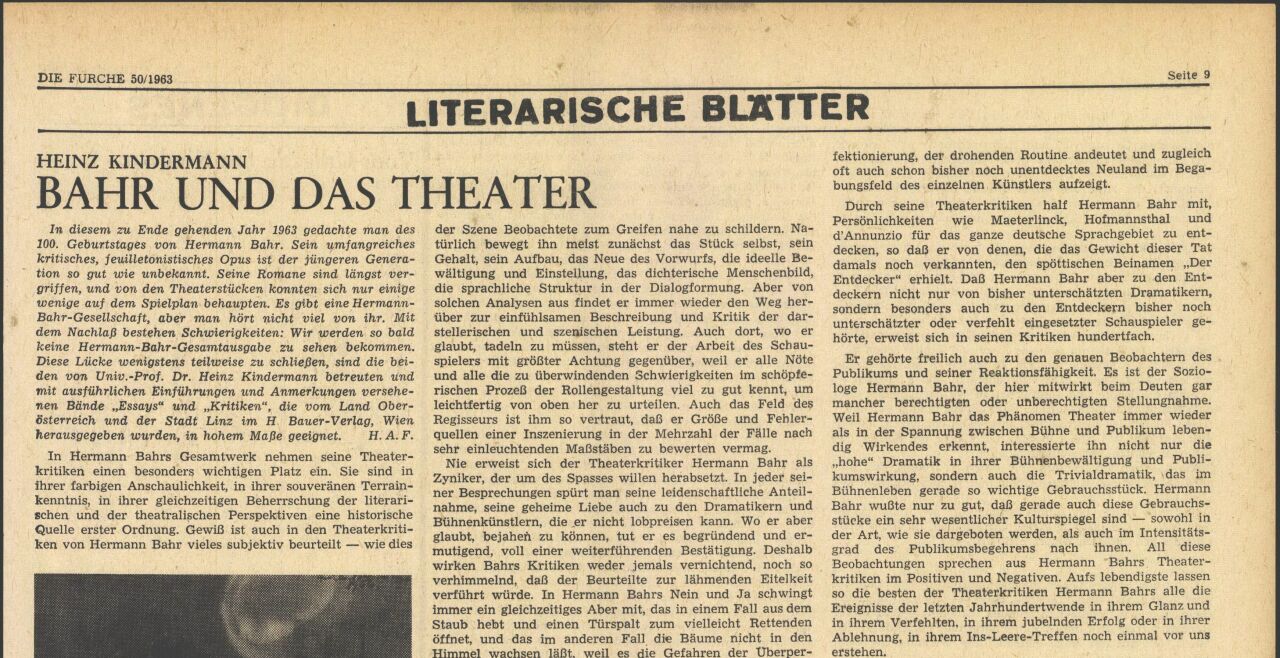
Herbst 1896, ein Abend bei Leopold Andrian in der Habsburgergasse 5. Ich, ein Zwanzigjähriger, sitze in meiner hellblauen bosnischen Leutnantsuniform da und soll in den nächsten Augenblicken „den größten österreichischen Dichter” kennenlernen. Hofmannsthal hatte damals gerade sein Einjährigenjahr bei den Dragonern beendet, und die Vorstellung, daß „der größte Dichter” als Korporal ins Zimmer eintreten könnte, mag die Benommenheit des jungen Offiziers noch gesteigert haben. Hatte ich doch einige Wochen vorher noch kaum eine Ahnung davon, daß in der Gegenwart auch noch wirkliche Dichter leben. Wohl waren mir gleich in der ersten Zeit meiner Garnisonierung in Wien einige Arbeiten Hermann Bahrs vor Augen gekommen, die mich durch die Art, wie sie sich mit dem gegenwärtigen Leben auseinandersetzten, lebhaft berührt hatten, und dann hatte ich Leopold Andrians „Garten der Erkenntnis” kennengelernt, und da war es mir offenbar geworden, daß die Quelle österreichischer Dichtung mit dem Tode Grillparzers, Lenaus, Anastasius Grüns noch nicht .yersiegt war. An diesem Abend nun bereitete mich Andrian für die bedeutungsvolle Begegnung aufs glücklichste vor, indem er mir aus dem Gedächtnis einige frühe Gedichte Hofmannsthals vorsprach und einige Verse aus „Der Tor und der Tod”.
Jede Beklemmung ist sofort gewichen, als ich in Hofmannsthals Augen blickte, die, gütig und beredt, weit rascher eine Verständigung ermöglichen, als es Worte vermögen. Des Gesprochenen von jener ersten Begegnung kann ich mich nicht mehr entsinnen, nur das Gefühl einer großen Beglückung blieb in mir lebendig und die schöne Gewißheit einer Freundschaft fürs Leben, die schon in dieser Stunde durch das gegenseitige Du besiegelt wurde. Obwohl im Gespräch seine dichterischen Arbeiten kaum berührt wurden, ergab es sich doch zum Schluß, daß ich die neuen Manuskripte von „Der Kaiser und die Hexe” und „Der weiße Fächer” mitnehmen durfte und daß ihm Andrian ein Tagebuch von mir mitgab.
Bei der ersten Lektüre Hofmannsthals ist es mir sonderbar ergangen. Ich war von der Pracht und Glut seiner Sprache so überwältigt und geblendet, daß ich vorerst nicht zu einem reinen Genuß am Inhalt kommen konnte. Da geschah es, daß mich die Stelle in „Der weiße Fächer”: „ Lerchen sitzen nie auf Büschen, Lerchen sind entweder hoch in der Luft oder ganz am Boden zwischen den Schollen”, zur Besinnung brachte. Ich freute mich an dieser Beobachtung aus der alltäglichen Natur, und damit waren wie durch einen Zauber plötzlich alle Hemmungen beseitigt. Das ist ein psychologischer Prozeß, der sich ähnlich wohl bei den meisten Lesern Hofmannsthals durchsetzen mußte, der aber bei der großen Masse sich nur allmählich vollziehen konnte. Deshalb ist zu verstehen, wenn erst nach vielen Jahren die Zahl jener in raschem Zunehmen begriffen war, die sich durch die unvergleichliche Schönheit der Hofmannsthalschen Dichtungen nicht behindern ließen, bis zu ihrem köstlichen Kern zu dringen.
Meine angeborene große Schüchternheit, die unsere erste Begegnung hätte unangenehm beeinträchtigen können, blieb auch bei den nächsten Zusammenkünften dank der eindringlichen, dabei aber zarten Anteilnahme Hofmannsthals an allem, was mich bewegte, zurückgestaut. Daß mich Hofmannsthal nach der Lektüre meines jugendlichen Tagebuches als Dichter ansprach, löste diese Schüchternheit noch mehr.
Nicht lange darnach wurde ich für längere Zeit nach Bosnien versetzt. Als ich von dort Urlaub nahm und meine ersten bosnischen Erzählungen mitbrachte, las ich eine davon, „Her-
zegowinische Hirten”, auch Hofmannsthal vor. Leopold Andrian und Richard Beer-Hofmann waren die anderen Zuhörer. Da war es nun wunderbar, wie durch Hofmannsthals ableuchtende Worte die Arbeit für mich erst die richtige Geltung bekam. Ich erinnere mich noch seiner letzten Worte darüber: „So würde offenbar Adalbert Stifter schreiben, wenn er heute lebte.” Wenn späterhin von anderer Seite manchmal auf eine gewisse Wesensverwandtschaft zwischen Stifter und mir hingewiesen wurde, empfand ich dies jedesmal mehr als eine Auswirkung jenes Wortes von Hofmannsthal, denn als eine neue Einsicht: so sehr war ich von der magisch fortwirkenden Kraft jedes seiner Worte überzeugt, auch wenn sie nur gesprochen wurden.
Es war wohl im Café Griensteidl gewesen, in der Mitte der neunziger Jahre. Ich saß mit Hofmannsthal und Baron F. beisammen, und einer von ihnen machte den Vorschlag, daß wir drei einmal als einfache Soldaten verkleidet auf den Laaerberg gehen müßten. Dort war hinter dem Favojfitner Arbeiterviertel zwischen den Ziegeleien auf den grünen Hügeln eine Art Wurstelprater, aber ohne die Beimengung des bürgerlichen Elementes, die der eigentliche Volksprater aufweist. Ich war damals Leutnant bei den Viererbosniaken, und so konnte ich die Aufgabe übernehmen, die Mannschaftsuniformen für uns drei zu besorgen.
Am nächsten Nachmittag kamen beide zu mir in meine Wohnung in die Wiener Alserkaserne, und ich hatte schon mit meinem Feldwebel eine Anzahl Uniformstücke zur Auswahl bereitgestellt.
Hofmannsthal und F. hatten eben ihr Einjährigenjahr bei einem Kavallerieregiment absolviert, so war nicht zu befürchten, daß sie durch unmilitärisches Benehmen auffallen könnten. Da aber keiner von ihnen bosnisch sprach, war es bedenklich, sie an der Torwache passieren zu lassen. Um jede Gefahr zu vermeiden, verzichtete ich schließlich auf den Ausflug, weil ich ihnen so sicherer aus der Kaserne hinaushelfen konnte.
Die beiden sahen in der Uniform bosnischer Infanteristen ausgezeichnet aus. Baron F. mit seiner hohen schlanken Ge-
stalt und der mächtigen Adlernase kam mir trotz seiner Blondheit wie ein Herzegowze aus den Bergen an der montenegrinischen Grenze vor, und Hofmannsthal war etwa wie ein katholischer Bauer aus dem bosnischen Mittelgebirge, dessen südslawisches Blut mit moslemischem gemengt ist: traumhaft der Ausdruck seiner Augen, das Profil edel geformt, ein dünner, an den Mundwinkeln herabhängender Schnurrbart, blanke Zähne hinter herabhängender Unterlippe.
Die Zivilkleider wurden in ein Kommißleintuch gebunden. Hofmannsthal schwang dieses große Bündel auf den Rücken und dann gingen wir, ich voran, auf drei Schritte hinter mir, wie zwei Offiziersburschen, die unechten Bosniaken. Die Torwache salutierte mir und achtete nicht der zwei Infanteristen, die für mich etwas trugen. Bald nachdem wir das Kasernentor verlassen hatten, kam uns mein Kompaniekommandant entgegen. Der hatte ein scharfes Auge und kannte jeden Soldaten seiner Kompanie wie ein Vater sein Kind. Da wurde mir ein wenig bange. Aber Hofmannsthal und F. warfen so stramm die Köpfe und salutierten so vorschriftsmäßig, daß dem Hauptmann nichts auffiel. Bald darauf fanden wir einen freien Fiaker. Ich ließ die zwei Bosniaken einsteigen, nannte dem Kutscher das Hotel, in dem die beiden ihre Sachen deponieren wollten, und sie fuhren davon.
Am nächsten Tag erzählte mir Baron F. freudig, daß ihm am Laaerberg eine Köchin beinahe ein Wiener Schnitzel gezahlt hätte.
Und was Hugo von Hofmannsthal dort erlebt hat, möge man in seiner Selbstbiographie nachschlagen, im Band siebzehn der gesammelten Werke, Seite 672.
Unter den Briefen der Morgenpost auf einem Umschlag die Schrift Hofmannsthals erkennen, bedeutet jedesmal das Aufspringen einer freudigen Stimmung. Schon das Bild dieser Handschrift an sich, dieses Blütenhafte und Perlende in den Zügen, übt auf das Auge eine ähnliche Wirkung wie etwa eine Tonfolge von Mozart auf das Ohr. Nie ist man enttäuscht, wenn man einen Brief von seiner Hand öffnet. Wenn es auch nur ganz wenige Zeilen sind, haben die Worte immer einen ganz eigenartigen Klang und das Alltägliche ist in einer besonderen Wendung mitgeteilt, durch die sich der Empfänger des Briefes ausgezeichnet fühlt.
Findet man in dem Brief eine Einladung zu einem Besuch, so ist dies eine besonders festliche Angelegenheit; diesmal war mir die Einladung um so willkommener, weil ich in der letzten Zeit in der deutschen Presse wiederholt von neuen Arbeitsplänen des Dichters gelesen hatte und mich nun freute, aus seinem Mund darüber Näheres zu erfahren.
Es ist so wohltätig, aus dem Trubel der Großstadt in die Abgeschiedenheit seiner Dichterexistenz in Rodaun zu kommen. Schon dieser Punkt, den er als ständigen Aufenthalt gewählt hat, ist bezeichnend für sein Wesen, und man stellt immer wieder gerne die Verwachsenheit seines Werkes mit der Landschaft, in der er lebt, fest. Da ist dieses Rodaun am Rande des großen Industriebeckens, das die Ebene von Wien bis Wiener-Neustadt ausfüllt, einer jener Orte an dem Auslauf eines Wienerwaldtales, die hier wie aus Füllhörnern die Häuschen gegen die Ebene hinstreuen. Dort, wo der Betrieb der Liesinger Industrie nicht mehr hinbrandet, liegt das liebliche Nest Rodaun an den Talhang geschmiegt, im Hintergrund beherrscht von der Kirche hoch auf dem Hügel, an dessen Fuß das alte Schlößchen aus dem Ende des 18. Jahrhunderts liegt, in dem der Dichter wohnt. Daneben sieht man das altehrwürdige Gasthaus Stelzers, das eine große Tradition aus dem alten Österreich hat, und weiterhin das Jesuitenkonvikt Kalksburg, aus dem so viele leitende Männer des früheren Österreich hervorgegangen sind. Wenn der Weg von der Bahn durch den anheimelnden Ort schon eine angenehme Vorbereitung ist, fühlt man sich bei Betreten des kleinen Hofes mit der hübschen Freitreppe für die Begegnung mit Hofmannsthal noch intimer vorbereitet. Dann geht man durch dieses Haus mit den dicken Mauern, an denen alte Bilder hängen über schönen Truhen.
Schön ist es, wenn es, wie diesmal, die Zeit erlaubt, noch einen Spaziergang mit dem Dichter in das Hügelland hinter Rodaun zu unternehmen. Diese Buchenwälder und welligen Wiesen habe ich oft und oft an seiner Seite durchstreift. Das alte, schöne Haus neben dem Stelzer und diese Landschaft, das alles gehört so innig zum Leben und Werk des Dichters, daß einem hier so recht die große Gabe des Beharrens itn Wesen Hofmannsthals gegenwärtig wird. Man könnte hier fast vergessen, daß sich die Einbildungskraft des Dichters doch auch fremder Welten und Zeiten bemächtigt hat. Trotzdem fällt mir auf einer Höhe, von der aus wir einen weiten Blick über das Wiener Feld haben, ein, ihn über seine marokkanische Reise zu befragen. Offenbar geschieht dies, weil ich durch das sonderbare Aussehen einer fernen Ziegelfabrik angeregt werde,’die in dem violetten Dunst sich ausnimmt wie eine Moschee aus einem orientalischen Märchen. Da erfahre ich, daß die wenigen Berichte von der nordafrikanischen Reise, die ich kenne, nicht vereinzelt bleiben werden, daß schon neue Schilderungen in Vorbereitung sind: über einen zu Gericht sitzenden Pascha, über ein Fest, über Gespräche mit Arabern — je weiter die Erinnerungen im Gedächtnis zurücktreten, um so lebendiger und einfacher bieten sie sich zum endgültigen Ausdruck dar. Zwischen seiner Reise in Griechenland und dem Erscheinen der gesammelten „Augenblicke in Griechenland” waren zwölf Jahre verstrichen.
Wo immer man die Entstehung der Werke dieses verehrungswürdigen Dichters untersucht, stellt man überall die gleiche tiefe Verwurzelung fest und eine Langsamkeit des Reifens, die einen mit unbedingtem Vertrauen erfüllen muß.