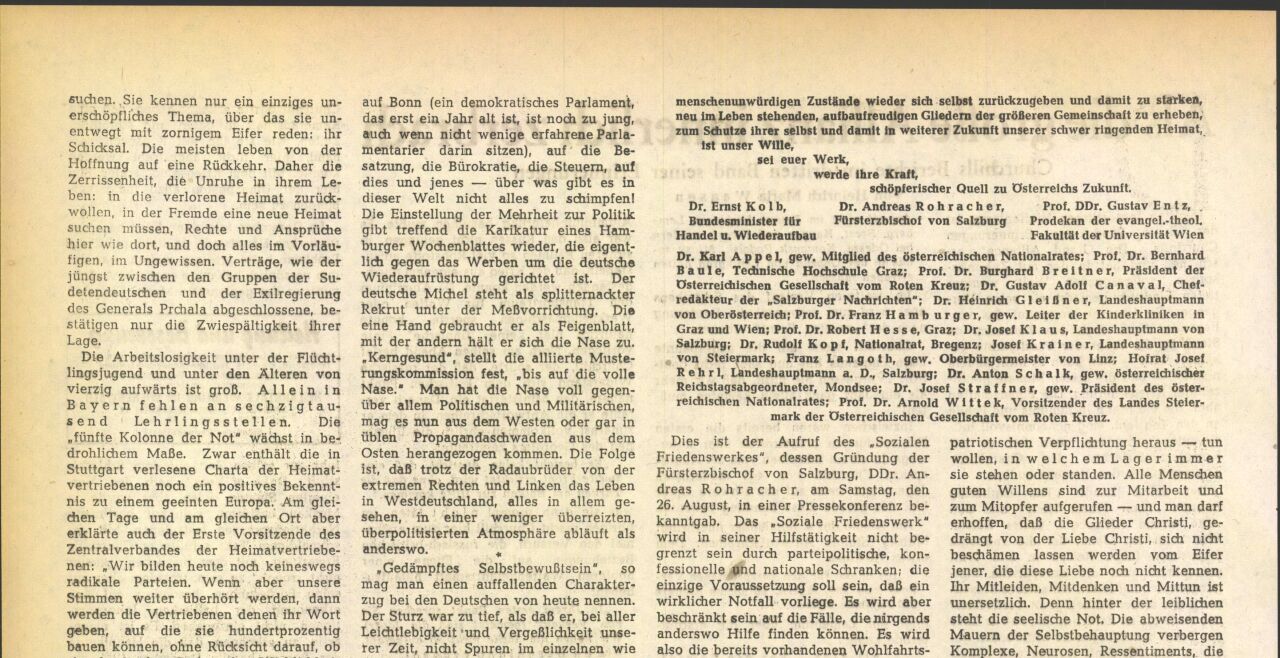
Hochsommer war's. Schwül, heiß, vor einem Gewitter. Ein Freund hatte mich zu einer Fahrt über den Glockner geladen. Drüben im Tirolischen fiel mir ein, daß Du in der Nähe Matreis auf Sommerfrische weiltest. Im Gewitterregen suchten wir Dich im Virgener Tal. Fanden Dich nicht. Schade. Gedachten doch, ein gut freundschaftlich Gespräch zu führen wie oft zuvor.
Herbst wird es; Kühle steigt von den Bergen. Nebel und Angst in die Herzen.
Da sitze ich also und lese, wie immer mit Fleiß und Liebe, den „Volksboten“. Vom 3. September 1950. Ein Leitartikel von Deiner Hand: „Was wir uns nicht leisten können.“ Da schreibt nun Deine bewährte Feder: „Die Furcht aller Tiefersehenden, daß Österreich von einem dritten Weltkrieg verheert und von einer neuen noch schwereren Kirchenverfolgung heimgesucht werden könnte, gründet sich weniger auf die weltpolitische Gefahrenlage als auf die tiefe Un-bekehrtheit weiter Schichten auch deskatholischenVolkes, auf die himmelschreienden Sünden als da sind: die schamlose Ausbeutung der Not des Nächsten...“
Erfreut halte ich einen Augenblick inne. Ja, das freut mich von Dir, daß Du — und Du selbst sperrst die Worte — das Thema anschlägst, das unser aller große Sorge ist: „Die tiefe Unbekehrtheit weiter Schichten auch des katholischen Volkes“ — für mich ein Hauptthema des christlichen Schriftstellers. Ich habe es, wie Du seit langem weißt, in einem Roman behandelt: „Der achte Tag“, der unter dem Namen meiner Mutter erschien, vorwiegend aus zwei Gründen. Zuerst, weil ich glaube, als Wissenschaftler und Schriftsteller das Anliegen Spenglers in seinem „Untergang des Abendlandes“ sauberer angehen zu können, wenn ich es auf zwei methodisch und formal getrennten Bahnen untersuche, die freilich zu innerst konvergieren: als Historiker untersuche ich im „Aufgang Europas“ einen kritischen Punkt in der Geschichte unseres Kontinents, in dem Größe und Gefahr einer mehr denn halbtausendjährigen Entwicklung zum erstenmal deutlich sichtbar werden. Die Ströme, die unser Leben tragen, sind seit langem schon befrachtet mit furchtbaren Lasten .. . Hier sollte, meines Erachtens, mehr die Ratio, die wissenschaftskritische Note, sprechen, wenn auch das Hera nicht schwieg, daher hier der Name des Vaters.
Zum anderen stellt sich mir als katholischem Journalisten, als Publizisten in der Zeit, die Frage: Wohin gehen wir heute, wenn wir uns weitertreiben lassen, ohne radikale, ernst-offene Gewissens-erforschung? Wie weit sind wir noch Christen, wie tief stehen, leben wir noch in der Dimension des Glaubens, in jener Dimension, die uns weithin verlorenging in den Gefechten der Positionstechniker, der Phraseure, der Politikaster, in einem scheinchristlichen und scheinhumanistischen Gerede — Zeuge sind tausend Traktatenen seit 1945 —, das uns abschirmen soll gegen die Sicht der Wirk? lichkeit, gegen die Not des Bruders, des Nächsten — und jeder Mensch ist uns Bruder, heute noch wie zu Kains Zeiten und in der Stunde des Priesters und. Leviten, die am Geschlagenen vorbeigingen ... Dieser Not kann, das wissen wir alle, erst wirklich gesteuert werden, wenn wir es wagen, ihrem innersten Gesicht zu begegnen: der Glaubensschwäche der Christen.
Da setzte ich mich also getrost hin und schrieb den „Achten Tag“ als eine Mahnung, als eine Bitte, als ein inniges Drängen. Brüder, an die Arbeit, solange es Zeit ist! Bekehren wir uns zu Christus, lassen wir jene üblen Spiele, in denen wir das Christentum zu einer Ideologie diverser Machtcliquen verkehren, zu einem Wandschirm, mit dem wir uns bei Gott gegen Gott, bei Gott gegen den Nächsten, beim Nächsten gegen Gott zu versichern streben.
Da mir nun, wie Dir, lieber Ignaz, die hartgesottene, unverfrorene Art wohl vertraut ist, mit der wir Christen immer wieder jegliche Schuld an den Verhältnissen unseren nichtchristlichen Brüdern in die Schuhe schieben, gab ich meinem Roman eben diese literarische Form: ich ge-wandete Satire, Groteske und Höllenbild unserer Zeit in das imaginäre Bild einer auch äußerlich nach- und gegenchristlichen Welt im Jahre 2074 n. Chr., in einem Wien nach dem auch äußerlichen Untergange des Christentums, und suchte zu zeigen, wie in einer' entgötterten und entmenschten Welt — jederzeit, mögen die äußeren Verhältnisse widrig bis zum Letzten sein — ein neuer Tag aufgehen kann durch die neue Aktivität neuer Christen. Ich muß allerdings gestehen, daß ich, um in der Sprache des Barock zu sprechen, der unserer Heimat eo tief verbunden ist und der es, wie bereits das Mittelalter, verstand, in immer neugeformten Höllenpredigten das schlafende Gewissen der Christenheit aufzurütteln, gar erschröckhliche Dinge in bunten Bildern der schlafsatten Sicherheit, der um keine Ausrede verlegenen Raffinesse unserer christlichen Welt vorgestellt habe. Immer in der wohlüberlegten Absicht: liebe Freunde, liebe Brüder — drücken wir uns doch nicht stets und gerade heute vordem, waszu tun ist: dieTat. S c h r e iten wir zur Tat, zur autochthon eigenständigen christlichen Tat tätiger Liebe.
Wie Du selbst als Verfasser des schönsten und kostbarsten literarkritischen Essays, der seit 1945 in Österreich erschienen ist, am besten weißt, haben aberhundert christliche Dichter, Literaten, Prediger, in dem Jahrtausend von der Visio Wettini und von Atto von Vercelli über Hildegard von Bingen und Dante bis zum Barock herauf zahlreiche Panoramen von Höllenschilderungen entwickelt, um die Christen ihrer Zeit zur Besinnung in ihrer Stunde aufzurufen. Helden und Heilige, Stümper und echte Dichter, große und kleine Geister... Die literarische Form, die ich für meine Zeit wählte, steht also in einer tausendjährigen legitimen Tradition — naturgemäß versuchte ich die Hölle unserer Zeit mit jenen Farben und in jenen Formen zu schildern, in denen sie heuteufscheint — nur so ist es vielleicht möglich, aufmerksam zu machen „auf die tiefe Unbekehrt-helt weiter Schichten auch des katholischen Volkes, auf die himmelschreienden Sünden...“, wie Du so schön sagst.
Erfreut lese ich also Deinen Artikel weiter. Was sehen aber da meine staunenden Augen? Der große Feind, den wir Christen und zumal wir Publizisten heute bei uns zu bekämpfen haben, ist gar nicht so sehr diese „tiefe Unbekehrtheit weiter Schichten“ — der große Feind bin eigentlich, genau besehen, ich selbst. So dozierst Du nämlich: „Die Hauptgefahr ist im Augenblick die eines übertriebenen Spiritualismus.“ Und wer ist der Träger dieses Spiritualismus? Ja, eh und nun dieser sattsam bekannte, hier im eigenen Hause mit Namen nicht mehr zu nennende Literat, der in seinem Endzeitroman einen „literarischen Eschatologismus“ predigt — „ein Versuch, gewissermaßen die Endzeit in der Phantasie vorwegzunehmen“ — die Schilderungen der Schrecknisse im „Achten Tag“ erwecken Deiner Ansicht nach „bei vielen Christen der Gegenwart... eine Art Lähmung, vor allem liefern sie den Feigen und Ängstlichen unter uns Christen die willkommenste Ausflucht: die eines christlich getarnten Fatalismus. In der Scheinwirklichkeit des Literarischen kann sich da ein christlicher Radikalismus — ein .existentielles Ernstnehmen' —. austoben, dessen überhitzte Forderungen auch in Zukunft nicht zu verwirklichen sind“.
Lieber Ignaz! Ich dachte denn doch, daß
Du, einer unserer bewährtesten christlichen Literaturkritiker, zu scheiden wüßtest -- auf den ersten Blick, aus Deiner großen Kenntnis der literarischen Tradition im christlichen Raum wie auch aus Deinem Fingerspitzengefühl: Eschatologie ist Eschatologie — und das da ist eben ein Roman. Ebenumjede „Visi oh“, die mittelalterliche literarische Form der Gegenwartsaussage, und um jede G e-schichtsprophetie, ihre modernistische, Sp eh gierische Form klar und deutlich zu vermeiden, wählte ich für meine Gegenwartsschau den Roman.
Ich glaube nun nie und nimmer, daß dieser Roman (der nicht Seelsorge im Beichtstuhl ist) Rücksicht nehmen soll, kann und darf auf die Fußkranken in unseren Reihen, auf die „Feigen“ und „Ängstlichen“. Der Renouveau Catho-lique, die größte geistig-intellektuelle christliche Erneuerungsbewegung im neueren Europa, ruht, wie Du am besten weißt, auf Hello, Peguy, Bloy, Bernanos, Claudel — keine Zeile hätten diese großen Mahner und Rufer schreiben dürfen, wenn sie diese feige' und ängstliche Rücksicht geübt hätten. Gott sei Dank, sie haben geschrieben. Und wir katholischen Intellektuellen, Du und ich und auch jene kleine, aber bedeutende Gruppe, in deren Auftrag Du mich zu „liquidieren“ unternommen hast — wir alle leben von ihrem Korn, ihrem Wort, ihrem Wagnis. Sie nämlich wußten schon vor achtzig Jahren, was seit Hitler jedes christliche Kind weiß: die Fußkranken gehen nicht mit. Sie wollen im Grunde schon längst nicht mehr mit. Die „Feigen“ und „Ängstlichen“ haben jederzeit tausend Vorwände, sich von der Erfüllung ihrer Christenpflicht im Hier und Heute zu drücken — für sie ist der „Achte Tag“ nicht geschrieben, sie erkennen ihn nicht im Heute, weil sie ihn nicht sehen wollen — und lesen ihn auch gar nicht. Geschrieben aber ist er für die innerlich Jungen, für alle jene, die illusionslos wissen wollen: Wo stehen wir wirklich heute in der Christenheit? Welche Froh-ten im inneren Kampf, um den Aufbau christlicher Substanz, halten wir noch? Wo müssen wir heute Hand anlegen? Was in die Hand nehmen: die Atombombe oder vielleicht gar das Evangelium (dessen Gefährlichkeit — für uns selbst — uns so oft nicht sichtbar wird)?
Ich darf es Dir nun sagen: die Jungen verstehen mich.
Gewiß, ich leugne nicht, mein Roman ist diskutabel. Das aber ist ja sein Daseinszweck: zu einer echten innerchristlichen Auseinandersetzung herauszufordern über das, was uns Christen heute not tut.
Du hast sein Manuskript gut ein halbes Jahr vor seinem Erscheinen in der Hand gehabt. Unter Brüdern, nicht nur unter Christen, hätte ich mir also diese Auseinandersetzung etwa so vorgestellt — etwa in der Form eines offenen Briefes: „Lieber Fritz Heerl Dein neuer Roman befremdet mich gar sehr. Ich bin sehr anderer Ansicht als Du: erstens, zweitens ... zwanzigstens .... vierzigstem ... paßt mir dies und jenes nicht. Ich muß Dir das offen sagen...“
Nun hast Du, lieber Ignaz, eine sehr andere Form gewählt, und um dieser Form willen, die mir verhängnisvoll und uns alle, .die wir im ,österreichischen Raum um innere Erneuerung ringen, gefährdend erscheint, schreibe ich diesen offenen Brief an Dich, der Du hier Dein altes Zeichen „Christianus = der Christ“ als Richternömen benützst.
Ich gestehe, daß mich die Form,' in der Du Dich selbst in eine Exekutionsordnung einschaltest, erschüttert.
In diesem Sinne gebe ich Dir als schlichte Frage zurück: Können wir uns das leisten?“ Ist das die neue
Form der so notwendigen innerkatholischen Aussprache in Österreich?
Ich bin in aufrichtiger Ergebenheit — Du weißt, daß ich mir allerhand sagen lasse- Dein alter FrItzHear
