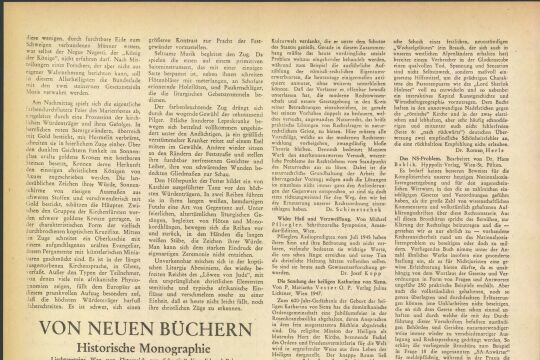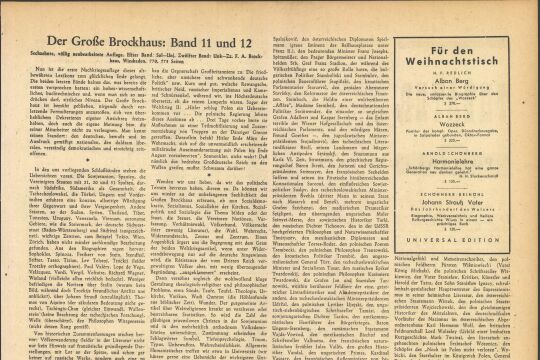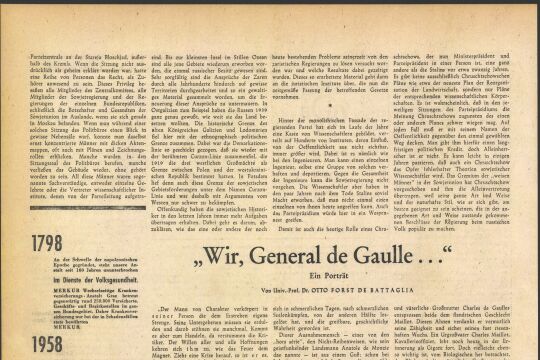Im Herbst 1830 weilte ein vornehmer Gast auf der Durchreise in Innsbruck. Es war der Gubernialrat und Hofrat der Vereinigten Hofkanzlei, Franz Graf Hartig, der, zum Gouverneur der Lombardei ernannt, in Innsbruck bei den maßgebenden Herren der Tiroler Landesregierung Informationen für seine neue Stellung einzog.
In der Tat schien kaum eine andere Persönlichkeit besser geeignet, in dem veui den Wellen der französisdien Julirevolution umspülten, durch innere Gärungen und die Treibereien der Geheimbünde erregten Oberitalien wieder Ruhe herzustellen als Graf Hartig. Einem alten sächsisdi-böhmi-schen Adelsgeschlecht entstammend, war der damals Einundvierzigjährige sdion früh in den österreichischen Verwaltungsdienst getreten und hatte sich im Jahre 1815 als Zivilkommissär in den besetzten Gebieten Frankreichs und zehn Jahre später als Statthalter der Steiermark politische und administrative Erfahrungen erworben.
In Mailand trat aber Hartig nicht so sehr als Mann der starken Hand auf, sondern verstand es, durch sein kluges Eingehen auf die berechtigten Wünsdie der Bevölkerung die Ursachen der Gärung zu beseitigen und eine beruhigte Atmosphäre zu schaffen, in der die geistigen und materiellen Kräfte des Landes neu aufblühten.
Selbst ein Mann von klassisch humanisti-sdier Bildung, Kunstmäzen und künstlerisch begabt, förderte er die großen künstlerischen Traditionen der alten lombardischen Kulturzentren. Die Akademie der schönen Künste in Mailand wurde durch seine Initiative neu organisiert. Italienische Architekten, Bildhauer und Maler erhielten Aufträge von der österreichischen Regierung, das Institut der Wissenschaften in der lombardischen Hauptstadt wurde reich dotiert. Alessandro Manzoni, obwohl ein Gegner der österreichischen Herrschaft, verkehrte im Hause des Gouverneurs, wo er aus seinem eben erschienenen Roman,
Ganz anders bei Richard Strauss, bei dem die Wandlungen offen zutage liegen und der der oberflächlichen Betrachrund daher als der wagemutigere, revolutionärere von beiden erscheinen mochte. Sah man bei Pfitzner oft zu einseitig die konservative Komponente, so übersah man bei Strauss nicht minder häufig die organische Bindung an die Tradition. Ging Pfitzner von Schumann aus, so Strauss vom romantischen Klassizismus eines Brahms und schuf Jugendwerke von erstaunlicher Reife und Formbeherrschung. Damit aber war er, wie er mit der neu deutschen Schule Liszts und deren formrevclutionären Zielen in Berührung kam, zu seiner ersten geschichtlichen Leistung befähigt, die auch wieder eine solche der Synthese ist, nämlich zur Vollendung der Programmusik durch ihre Verschmelzung mit absolutmusikalischer Formung. Hand in Hand damit geht im Dienst des Ausdrucks die letztmögliche Ausweitung und Ausschöpfung des diatonischen Dur-Moll-Systems, die im übrigen auch bei Pfitzner wie auch bei De-bussy, Reger, Mahler und anderen als Generationssymptom festzustellen ist. Dies Entwicklung Straussens vollzieht sich in der Reihe der symphonischen Dichtungen, zu denen wir — als ,.symphonische Dichtungen mit obligater Bühne“ — auch die Einakter „Salome“ und „Elektra“ zählen dürfen. Mit dem „Rosenkavalier“ erfolgt zwangsläufig ein neuer Umschwung, der durch die „Ariadne“ bestätigt wird: Hinwendung zu einem formbetonten, neubarocken Klassizismus, der fürderhin Straussens ganzem Schaffen das Gepräge gibt bis hin zu den letzten kammerorche-stralen Werken.
Nun, nachdem beider Lebenswerk vollendet ist, sehen wohl auch wir zunächst noch mehr das Trennende als das Gemeinsame. Wir erinnern uns, wie jedes neue Werk Straussens seinerzeit alle Erregungen der Sensation erweckte, aber auch wie jede neue Schöpfung Pfitzners zu tief innerlichster Besinnung mahnte. Hie „Salome“, dort „Palestrina“! Aber auch die „Salome“ ist eine Mahnung, wie andererseits der „Palestrina“ kein weniger kühner Vorstoß war. Zwei grundverschiedene Naturen, schicksalhaft sich ergänzend und nur gemeinsam ihre Zeit ganz erfüllend, so stehen heute Hans Pfitzner und Richard Strauss in ihrem Werk vor uns, in dem eine Epoche sich vollendet — um in eine neue einzumünden.
„Promessi Sposi“, vorlas. Oft zog. der Graf inkognito nach Art der fahrenden deutsdien Künstler durch seine Regierungsbezirke, um mit Stift und Pinsel die Landsdiaften Dantes und Paolo Veroneses festzuhalten. Ein Gemälde von Mosteni zeigt den Statthalter an seinem Schreibtisch in biedermeierisdier Kleidung, den sinnenden Blick in die Ferne gerichtet, im Hintergrund eine antike Urne. Als Graf Hartig nach zehnjähriger Tätigkeit die Lombardei verließ, widmeten ihm die Mailänder Künstler eine reich ausgestattete Mappe. Die Bevölkerung wiederum vergaß es ihm nicht, daß er in dem furchtbaren Cholerajahr 1836 mit größter persönlicher Unerschrockenheit die Spitäler aufgesucht und alle sanitären Hilfsmittel, die die damalige Zeit kannte, in Anwendung gebracht hatte.
Im Jahre 1840 wurde Hartig wieder nach Wien berufen und zum Chef der Sektion für innere Verwaltung ernannt, eine Stellung, die ihm den Rang eines Staats- und Konferenzministers eintrug. Außer seiner zweifellosen Begabung und seinen Leistungen verdankte der Graf seinen Aufstieg sicher auch dem Wohlwollen des damals allmächtigen Staatskanzlers Fürsten Metternich, der den jungen Beamten schon von Beginn seiner Laufbahn an gefördert hatte. Die beiden Männer waren durch dire konservative Gesinnung und durch die Ähnlichkeit ihrer Uberzeugungen über die politische Führung des Kaiserreiches verbunden, wenn auch Graf Hartig, in der kühlen und nüchternen Luft des Erzgebirges aufgewachsen, den neuen Geistesströmungen in Europa nicht mit der gleichen harten Ablehnung gegenüberstand wie der alternde Staatskanzler. Dies erhellt aus seiner 1849 anonym erschienenen Schrift: „Genesis der Revolution in Österreich“, in welcher er mit dem größten Freimut die Verhältnisse kritisiert, die den Untergang des veralteten Regierungssystems nach sich zogen. Das Werk, das drei Auflagen und eine englische
Übersetzung erlebte, gilt heute noch als eine der besten Quellen für die Ereignisse des Sturmjahres.
Dennoch bewahrte der Graf dem gestürzten und entmachteten Kanzler eine unerschütterliche Treue und Anhänglichkeit. Sie leuchtet wie ein Stern im Dunkel jener verworrenen Zeit aus den heute wenig bekannten Briefen hervor, die Graf Hartig mit dem in Holland und in England im Exil lebenden Fürsten tauschte. Der Briefwechsel dieser beiden starken Geister zeichnet aber auch en wichtiges Kapitel österreichischer und europäischer Geschichte und wirft so manches prophetische Licht in unsere Gegenwart.
So schreibt Graf Hartig in seinem Glückwunschbrief zum Namenstag des Fürsten am 18. November 1849: .....So oft ich
über den Ballhausplatz gehe, zieht es mich gegen das Haus, in welchem ich einst Lehren der Weisheit und Staatsklugheit zu vernehmen Gelegenheit hatte. Allein ich gehe vorüber, denn zur Hebung der jetzt daselbst verborgenen Schätze habe, ich keine Wünschelrute. Der Gang, in welchen die Staatsmaschine gekommen ist, gleicht einer Pendeluhr, wenn das Pendel aus dem Faden gehoben ist. Das Räderwerk bewegt sich in stürmischer Eile, die Zeiger stimmen aber nicht mehr mit der Tageszeit überein, die Stunde, die sie anzeigen, ist eine Täuschung ...“
In einem, Brüssel, am 29. Jänner 1850, datierten Antwortschreiben setzt der Staatskanzler, vermutlich in Beantwortung einer verlorengegangenen Anfrage Hartigs, seine Ansichten über das Nationalitätenproblem auseinander, wie es durch die vorhergegangenen Ereignisse aktuell geworden war.
„... Es steht mit dem Begriff der Nationalität ähnlich wie mit den Begriffen Liberte, Egalite, Fraternite. Ein Satyriker hat die drei Schllgworte als die Liberte de ma faim (Freiheit zu hungern), Egalit£ de la misere (Gleichheit des Elends) und Fraternite' de Cain ä son frere (die Brüderlichkeit Kains gegenüber seinem Bruder) bezeichnet. Ebenso steht es mit dem Begriff der Nationalität in ihrer schiefen Anwendung und mit dem der Gleichberechtigung der Nationen innerhalb der politischen Grenzen eines Reiches. Alles, was den Begriff der Gleichheit vor den Gesetzen übersteigt, führt ins Blaue und das Blaue paßt nicht auf die Lebensverhältnisse der Staaten und der Individuen in den Staaten, Dehnt man den Begriff der Gleichberechtigung der Nationalitäten über dieses richtige Maß hinaus, so führt er zur Unterdrückung und zum Kampf aller gegen alle. Der Tschechismus sowie der Magyarismus haben sich bereits verkörpert, der erstere auf dem Weg langjähriger Karessen von oben, der andere durch ein Erheben von unten ...“ Und später bricht der Fürst in die prophetische Klage aus: „Welches wird die Zukunft für das herrliche Mittelreich sein? Im naturgemäßen Verlauf der Dinge liegt sein Zerfall in Teile!...“
Im Frühjahr des Jahres 1850 begab sich der Graf, der mittlerweile sein Amt niedergelegt und längere Zeit in Italien geweilt hatte, auf seine nordböhmischen Güter. Im Zug einer Diskussion über zeitgenössische Geschiditswerke klagt Fürst Metternich in einem Brief aus Brüssel über das Unverständnis, das die österreichischen Belange zumeist bei den Historikern gefunden hätten.
„Österreich war und ist eine Terra incognita für die flüchtigen Geister und insbesondere für den Troß aufgeregter Gemüter und oberflächlicher Tintenkonsumenten, welche leider in allen deutschen Zuständen eine hervorragende Stelle einnehmen ... Von sich hat Österreich zu allen Zeiten nur wenig gesprochen, gegen dasselbe hat der bezeichnete Troß seine Kräfte stets angestrengt. Die Zeiten ändern sich aber und die Stunde, wo man die Blicke nach dem Unbekannten und nur' einseitig Besprochenen wenden wird, wird einmal schlagen ...“
In einem Dankschreiben für die Glückwünsche des Grafen zu seinem Geburtstag legt der Fürst seinen Standpunkt über die deutsche Frage nieder:
„... Die deutschen Fragen lassen sich in drei Sätzen auffassen, welche in der kategorischen Form sich folgendermaßen stellen
Soll es im Staatenleben ein Gebiet geben, welches den Namen des deutschen trägt? Ja, das Gebiet ist vorhanden, hört es auf, seinen tausendjährigen Namen zu tragen, so müßte es einen anderen annehmen und dies würde eine Perturbation im gesamten politischen Leben Europas erzeugen!“
Auf die Frage, welches Deutschland nach verständlich sind, der politische Fanatismus — das alles gibt dabei Probleme, die fast unlösbar sind. Dazu kommt die strikte Durchführung der „White Australia Po-licy“ durch den bisherigen „Einwanderungsminister“ Calwell, die die Empörung Her asiatischen Nachbarstaaten heraufbeschwört. Infolge dieser Losung, „Australien für die Weißen“, darf sich kein Farbiger dauernd in Australien niederlassen. Er darf herumreisen und hier studieren, soviel er will. Wenn er sich aber dauernd niederlassen will, dann muß er sich einem sogenannten „Language Test“, einer Sprachprüfung, unterziehen. Das ist wirklich das Lächerlichste, das man sich denken kann. Er wird durchaus nicht in Englisch geprüft, nein, in Gälisch, Finnisch, Serbisch, in irgendeiner Sprache, von der man absolut sicher ist, daß sie der Kandidat nicht verstehen kann. Sogar Mitglieder des britischen Reiches, Inder, Malaien, Philippinos, die während des Krieges in Australien Zuflucht gefunden und sich oft mit Australiern und Australierinnen verheiratet haben, werden - jetzt auf Grund dieses Sprachexamens zwangsweise deportiert. Das macht viel böses Blut; die ganze Presse hat über Calwell kein gutes Wort zu sagen. Es ist nun für das gesamte Ausland von großem Interesse, wie 6ich Gal-wells Nachfolger zu der Frage der Einwanderung von asiatischen und europäischen Ländern einstellen wird.
Der große Kurswechsel
Man kann nur hoffen, daß es der neuen Regierung gelingen möge, durch „incentive peyment“ — durch Arbeitsprämien und durch Steuerermäßigungen — die Produktion zu steigern und so dem ständigen Anschwellen der Preise und Gehälter Einhalt zu gebieten, die Bautätigkeit zu fördern und Streiks zu verhindern. Viel erörtert ist die schwerwiegende Frage, ob die Unterdrückung der Kommunistischen Partei, die die liberale neue Regierung in ihrem Wahlprogramm angekündigt hat, mit der politischen Freiheit vereinbar ist oder nicht. Wird es Men-z i e s, dem klugen Führer der neuen Regierung, gelingen, die ausbeutungswütige Großindustrie weiterhin von Canberra fernzuhalten und gleichzeitig dem Ausbau dieser einzigartigen Bundeshauptstadt, diesem „weißen Elefanten“, wie sie die Australier nennen, die notwendigen großen Summen zuzuwenden? Die Liberalen führen bittere Klage, daß die sozialistische Regierung die einzelnen Bundesstaaten ihrer gesamten Einkünfte und damit auch ihrer Rechte beraubt habe. Diesem Zentralismus soll nun Einhalt geboten und den einzelnen Staaten größere Selbständigkeit zugestanden werden. Es werden dann viele Fragen in fünf verschiedenen Parlamenten verschieden entschieden und gehandhabt werden.
Etwa vier Meilen von Canberra liegt die schloßähnliche Residenz des Generalgouverneurs, des offiziellen Vertreters des britischen Königs. Von 1944 bis 1946 hat der Duke of Gloucester, der Bruder des Königs, dieses Amt innegehabt und vor ihm waren es immer verdiente Vertreter der englischen Aristokratie oder aber auch ein Australier, der sich um Australien besonders hohe Verdienste erworben hatte. Chifley hat unmittelbar nach der Abreise des Duke of Gloucester den Premierminister von New South Wales, einen ehemaligen Kesselschmied, einen Parteikollegen, der noch mitten im Parteigetriebe stand, für diese hohe Stelle vorgeschlagen und der König konnte sich seinem Wunsche nicht widersetzen. Aber es diente dem Ansehen des Gouverneurs nicht, daß er nicht wie der englische König seine Würde durch seine Unparteilichkeit bewahren konnte. Die Liberalen machten von allem Anfang an geltend, daß sie einen Sozialisten nicht als Gouverneur anerkennen und ihn, sobald sie zur Macht gelangen, sofort seines Amtes entsetzen werden. Es fragt sich jetzt, ob der König von England diesem nie dagewesenen Vorschlag zustimmen wird oder ob der arme Gouverneur M c K e 11 weiterhin als Wahrzeichen einer kurzsichtigen Parteiwahl in „splendid isolation“ das Ende seiner Amtszeit abwarten wird.
Der Durchschnittsaustralier hat Humor genug, den Wechsel in den Regierungsstellen von der heiteren Seite zu betrachten. Aber nur wenige sind gegen die ausscheidende Regierung feindlich gesinnt. Nein, Chifley geht noch immer täglich zu Fuß vom Hotel Currajong zum Parlament und jedermann winkt ihm freundlich zu, aber da er nun schon über acht Jahre in der Regierung gewesen ist, denkt sich so mancher, daß es nun wohl an der Zeit ist, auch den anderen eine Gelegenheit zu geben, zu zeigen, was sie können, sonst verlernen sie das Regieren ganz und gar! Und so sieht jeder, wie immer er auch gewählt hat, recht heiter und vertrauensvoll der Zukunft entgegen, denn jeder Australier ist im tiefsten Grund davon überzeugt, daß seine Landsleute, welcher Partei sie auch angehören mögen, ihre Parteiinteressen jederzeit dem Wohl ihres Landes hintanstellen werden.