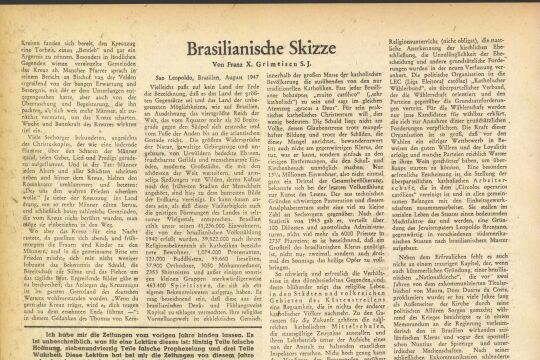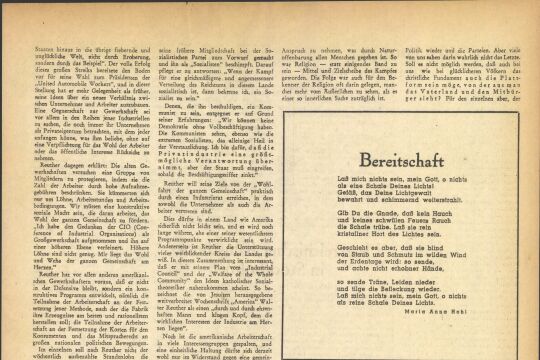Maßnahmen und Vorgehen gewisser Staaten, wie Spanien, Peru, Brasilien, gegen protestantische Sekten und Minderheiten haben in der katholischen Welt in den letzten Jahren eine lebhafte Auseinandersetzung ausgelöst. Wichtig als Zeitdokumente sind in diesem Zusammenhang die Ausführungen P. Cavallis S. J. in der „Civilti Cattolica“ (April 1948), I. Congars O. P.. in „La Revue Nouvelle" (Mai 1948), M. Pribillas S. J. in den „Stimmen der Zeit“ (April 1949) und Erik von Kuehnelt-Leddihns in „Wort und Wahrheit" (Mai 1949). Als bedeutsamer Beitrag zu dieser innerkatholischen Diskussion muß die Arbeit des Schweizer Hochschulseelsorgers Dr. Hermann Seiler im Maiheft 1949 der „Civitas"über dasselbe Thema: „Katholizismus und religiöse Toleranz“ angesehen werden. Seine Gesichtspunkte sind: „Es gibt im Katholizismus eine dogmatische Intoleranz, an der die Kirche immer festgehalten hat und festhalten muß." „Etwas anderes aber ist es um das Verhältnis der Kirche zu den Andersgläubigen.“ Hier hat sich in den letzten nachmittelalterlichen Jahrhunderten ein bedeutsamer großer Wandel der innerkirchlichen Anschauungen vollzogen. Die Kirche ist immer mehr von der mittelalterlichen Auffassung des ketzerrichtenden und -zwingenden Staates abgerückt. Nach Zitierung der neuen, die Toleranz betonenden Anschauungen englischer Kardinale wie Manning und Gibbons verweist der Autor auf eine Rede Pius’ XII. am 6. Oktober 1946 vor dem päpstlichen Kassationsgerichtshof, in der der Papst von einer „politischen, bürgerlichen und sozialen Toleranz gegenüber den Andersgläubigen, die unter diesen Umständen auch für Katholiken eine sittliche Pflicht ist“, spricht (Zitat aus der Rede des Papstes). Der Papst lehnt einerseits, wie seine Vorgänger, jede dogmatische Toleranz ab, fordert aber, und nicht nur wie die Vergangenheit, als Wahl eines „geringeren Übels“, sondern als s i 11- liche Pflicht die Duldung der Andersgläubigen von Seiten der Katholiken! In diesem Zusammenhang verweist Pius XII. auf den Grundsatz des Codex juris canonici, daß niemand gegen seinen Willen zum katholischen Glauben gezwungen werden darf, und Seiler beruft sich auf Thomas von Aquin (S. Th. L, II., Qu. 19 a, 5): „Der Mensch sündigt, wenn er den Glauben an Christus annimmt, wenn sein irriges Gewissen es ihm verbietet." Toleranz gegen Andersgläubige gerade in Staaten mit katholischer Majorität und sogenannten katholischen Regerungen ist nun heute nicht mehr einfach nur aus Opportunitätsgründen, Nützlichkeitserwägungen und mit Rücksicht auf die öffentliche Weltmeinung zu fordern, sondern tiefer, aus innerchristlichen Aspekten, die sich erst heute dem Bewußtsein der Kirche zu erschließen beginnen. Seiler folgt hier Congar O. P.:
Müssen wir nicht lernen, so fragt dieser, „die Toleranz unter einem neuen Gesichtspunkt zu seihen? Nämlich als einen Aspekt oder als eine Konsequenz der Leidenschaft für die Wahrheit? Wird die Toleranz nicht eine Form der Achtung nicht nur für jedes Element der Wahrheit, sondern auch für die Pläne Gottes und die Fristen, die e r setzt? … Ehrfurcht vor der Wahrheit, die uns eines Tages plötzlich im Glanz und der Fülle ihrer Einheit gegeben wird, die ober in dieser Welt gekreuzigt, gespalten und manchmal entstellt und verborgen erscheint…“
Die Fruchtbarkeit dieses neuen Gesichtspunktes erweist nach Seiler eine alte Erfahrungstatsache der Weltgeschichte: „Oportet et haereses esse! Die Zeiten der geistigen Kämpfe und Auseinandersetzungen waren immer die großen Zeiten der Kirche, wo sie zu ihrer wahren inneren und äußeren Lebendigkeit zurückgefunden und ihr christliches Wesen in neuer Gestalt geprägt hat.“
„Christliche Politik“ oder „Politik des Christen?“
„Christliche Politik?“ Mit diesem erregenden Gegenwartsthema setzt sich in Heft 4 1949 des „Hochlands“ sein Herausgeber Franz Josef Schöningh auseinander. Seine Thesen seien hier kurz zusammengefaßt, wir geben sie hier wieder mit Rücksicht auf die Stellung des Verfassers und der Zeitschrift und stellen sie zur Diskussion. Wir identifizieren uns mit ihnen nicht in allem. — Viele Katholiken lassen „in ihre politische Vorstellung Traumbilder eindringen… die zwar die schöne Farbigkeit alter Kirchenfenster haben, aber bar jedes politischen Realismus sind“. Das Scheitern des „christlichen Ständestaates“ in Österreich — „der lautere Wille und die Integrität vieler seiner führenden Männer" will der Autor durchaus anerkannt wissen —. erzwinge nach Schöningh doch, „in aller Nüchternheit die notwendigen Folgerungen zu ziehen und weder das Mittelalter zum politischen Wunschbild noch die päpstlichen Sozialenzykliken zu politischen Instrumenten zu machen". Unter Hinweis auf die Forschungen Michael Seidlmayers erklärt dann Schöningh, daß es nicht angehe, den Begriff des christlichen Staates so zu „verwenden, als sei er bereits geklärt und in der Geschichte eindeutig verwirklicht worden". Wir wissen heute, daß es auch im Mittel- alter keinen „christlichen Staat“, kein „Heiliges Reich" gab!
„Christliche Politik .., ist kein eindeutiger, sondern vielmehr ein höchst vieldeutiger Begriff. Es scheint mir zweifelhaft zu sein, ob man ihn überhaupt anwenden sollte." Es ist „allzu oft geschehen, daß die Verteidigung des Bestehenden als christliche Politik, der Angriff darauf aber als antichristlich bezeichnet wurde. Dies stellt einen Mißbrauch des christlichen Namens dar. Um … den Begriff einer christlichen Politik als gerechtfertigt erscheinen zu lassen, müßte es eine von solcher Art geben, daß sie sich grundsätzlich, eben durch ihr eindeutig christliches Gepräge, von jeder anderen unterschiede. Da eine solche Politik nirgendwo nachweisbar ist, dürfte es ratsam sein, auf diesen Begriff zu verzichten." Immer wieder kann man nun „christliche Politiker beobachten, die sich an schöne Reminiszenzen klammern, um die tatsächliche geistige und soziale Situation nicht sehen zu müssen".
Wenn es nun auch keine „christliche Politik" gibt, so gibt es doch etwas sehr Konkretes: Die Pflicht des Christen, auch in der Politik „das christliche Anliegen zu vertreten“. „Es gibt nämlich eine Politik aus christlichem G e w i s- s e n.“ „Was ist die Aufgabe des christlichen Politikers? Zunächst und vor allem hat er den Namen Christi vor Mißbrauch zu bewahren und eine unberechtigte Berufung auf das Evangelium zu verhindern." „ … alle Versuche, mit dem Evangelium in der Faust Politik zu machen, haben schrecklich geendet.“ Schöningh spricht die „Vermutung" aus, daß die Politik des christlichen Politikers „um so besser sein wird, je weniger er vom Christentum spricht und je mehr er auch auf der politischen Ebene den Satz beherzigt, daß man ihn nicht an seiner Parteiparole, sondern an seinen Früchten erkennen wird".
Schöningh gibt dann ein interessantes Beispiel- für das, was er unter der „Nüchternheit“ und dem „Realismus“, die er in erster Linie vom christlichen Politiker verlangt, versteht: es habe wenig Sinn, etwa im Kulturellen „eine Arche Noah“ bauen zu wollen, während die soziale Sintflut alles überschwemme; eine „christliche Schule" sei ein Unding, wenn die Ekern der Kinder gezwungen sind, in einem sozialen Chaos zu leben, so daß jedes'christliche Samenkorn, in der Schule gesät, zu Hause durch die Wirklichkeit dieses Lebens sofort wieder aus den Herzen der Kinder gejätet wird.
An diesen und anderen Beispielen zeigt Schöningh, „wie schwer die Aufgabe ist, die einem christlichen Politiker gestellt ist. Er darf, in einem Zeitalter der Demagogie, kein Demagoge sein; täglich wird er durch die Macht, die Welt und den Herren dieser Welt versucht". „Er muß bereit sein, Haß und Verleumdung seiner Gegner hinzunehmen, ohne mit gleicher Münze heimzahlen zu wollen. Mehr noch: er muß den Verdacht sogenannter Freunde ertragen, kein Christ zu sein." In dieser unerhörtenBedrohung und Ausgesetztheit kann deshalb der christliche Politiker nur bestehen, wenn er sich als Leit- und Richtmaß das höchst Menschenbild vorstellt, die Gestalt des Heilgen. Schöningh schließt mit den Worten des Staatsmannes in „Maß für Maß“: „Wem Gott vertraut des Himmels Schwert, muß heilig sein und ernst bewährt…"
Die deutsche Restauration
Joseph R o v a n behandelt in „E s p r i t Heft, 5, Mai 1949, die „Restauration“ im gegenwärtigen (West-) Deutschland. „Bia 1948 waren die Deutschen nicht verantwortlich für die Gestaltung ihres Schicksals, dieses lag in den Händen der Alliierten; nun sind sie selbst Träger der Verantwortung geworden und diese Tatsache verdient die Beachtung der ganzen Welt.“ Die offizielle Politik der Alliierten in der Zeit nach der Kapitulation bis zum Frühling 1948 wird symbolisch gekennzeichnet durch vief
Schlüsselworte: Entmilitarisierung, Denazifizierung, Neuerziehung, Demokratisierung. Diese Politik scheiterte aus verschiedenen Ursachen und schon deshalb, weil kein Einstimmung zwischen den vier Mächten zu erzielen war. „Heute geht die Tendenz der drei westlichen Mächte dahin, aus Deutschland einen politischen Verbündeten zu machen." Das wichtigste Phänomen ist nun die Tatsache, daß in allen Sparten des öffentlichen gebens in (West-) Deutschland die Männer von gestern und vorgestern die Oberhand gewinnen, beziehungsweise die Führung bereits übernommen haben.
Die alten Kaders der Beamten- und Professorenschaft, des Klerus und der Industriellen erstanden nahezu unversehrt wieder. Und mit ihnen, die sich mit großer Geschicklichkeit unter allen Regimewechseln zu erhalten wußten, kehren die alten Strebungen wieder: Nationalismus im Politischen, Romantizismus im Geistigen (auf den Universitäten), Konservativismus und Reaktion im Wirtschaftlichen!
Rovan verhehlt auch nicht die Ursachen dieser in vielen bereits heute bedrohliche Aspekte zeigenden „Restauration des Gestrigen“. „Der Fehlschlag der Besatzung macht die Restauration unvermeidlich.“ Nun zeigen sich aber doch auch schon Kräfte echter innerer Erneuerung. Zudem stellt sich dem „Bündnis der Greise und der Gestrigen" die Jugend entgegen, deren vielzitiertes Desinteressement an der Politik im
Grunde oft nichts anderes ist als eine eindeutige Absage an die Männer der Restauration — und dann ist da das Heer der Flüchtlinge, Ausgebombten, des neuen Proletariats, der Arbeitslosen. Noch hält hier die Besatzung manche Entwicklung in ihrer Entfaltung zurück. „Früher oder später wird sich aber eine wirklich revolutionäre sozialistische Bewegung bilden, falls es nicht der Restauration noch einmal gelingen sollte, diese Strömung abzulenken zugunsten eines neuen National-Sozialismus.“ — Rovan begnügt sich jedoch nicht mit der Auf- zeigung dieser düsteren Möglichkeiten. (West-) Deutschland steht heute nicht mehr allein. Frankreich teilt sein Schicksal — die Zukunft beider wird davon abhängen, „ob die Gemeinschaft der Angst und Sorge sich in eine Gemeinschaft des Lebens und der Arbeit wandelt“.
Indonesien: eine Frage an das christliche Gewissen Hollands
Im Chor westeuropäischer Zeitschriften nimmt die in Amsterdam erscheinende Wochenzeitung „De Linie" eine besondere Stellung durch ihre weltweite Zeit- eufgeschlossenheit und kämpferische Haltung ein. Manche Situation sieht sie anders als die Partei, welche den holländischen Katholizismus politisch vertritt und welche heute eine Säule der holländischen Regierungspolitik darstellt; aber bei allen daraus entstandenen Polemiken wahrt „De Linie" die — Linie.
Für die Niederlande ist gegenwärtig das Problem die indonesische Frage. In ihrer Nummer vom 13. Mai 1949 veröffentlicht das Blatt an leitender Stelle einen Brief des ersten javanischen Bischofs von Jogja und apostolischen Vikars von Semarang, Mons. A. Sugijapranata S J., der in Maastricht studiert hatte. Dieser hohe geistliche Würdenträger, ein guter Kenner seines Volkes und der mit ihm lebenden andersvölkischen Splittergruppen, schließt seinen brieflichen Situationsbericht:
„Beinahe ganz Jogja ist durch die niederländischen Truppen besetzt, aber ob sie auch ganz Jogja unter Kontrolle haben, ist eine andere Frage. Nirgends haben sie Kontakt mit den Menschen, es sei denn mit einzelnen, die dazu gezwungen wurden. Denn so wie sich die Dessamenschen anfänglich passiv verhielten, so sind sie jetzt aktiv in ihrem passiven Widerstand geworden. Die einheimischen Verwaltungsbeamten sind untergetaucht, aber sie arbeiten in der Stille weiter. Was mir vor allem leid tut, ist, daß sich nun der Haß der Herzen der einfachen Menschen zu bemächtigen beginnt, die die Masse ausmachen. Mit dem muß sich die Mission auseinandersetzen. Eine vornehme chinesische Dame kam am dritten Tag nach dem Einmarsch in Jogja zu mir gestürzt, um sich mir gegenüber ihr Herz auszuschütten: Monseigneur, laß sie — die Fremden — doch daheimbleiben mit ihrer Predigt über die Liebe! Sie, die Prediger der Liebe, kommen mit ihren Bomben und Tanks, um uns den Gottesdienst der Liebe aufzudrängen. Laßt uns doch Heiden bleiben, dann leben wir zumindest in Frieden untereinander!“