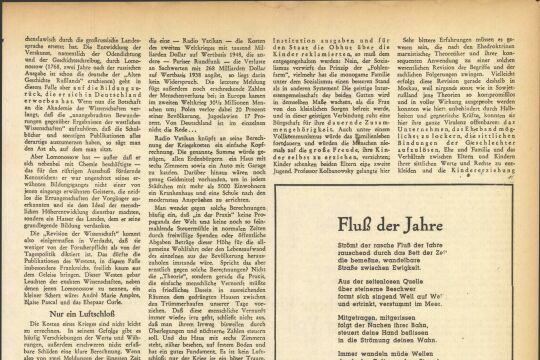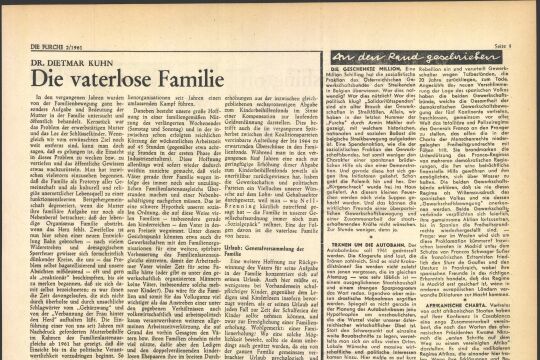Nicht alles, was zusammen lebt, ist eine Familie
Wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte ist „die Familie” einem radikalen Wandlungsprozeß unterworfen. Verdienen die neuen Formen des Zusammenlebens von Partnern und Generationen überhaupt noch den Namen „Familie”?
Wie noch nie zuvor in ihrer Geschichte ist „die Familie” einem radikalen Wandlungsprozeß unterworfen. Verdienen die neuen Formen des Zusammenlebens von Partnern und Generationen überhaupt noch den Namen „Familie”?
Kaum jemand kann übersehen, daß für menschliches Zusammenleben mehr Freiheiten, mehr Chancen, mehr Möglichkeiten der Veränderung geschaffen wurden. Technologie, ein für breite Schichten gehobener Lebensstandard und die Basissicherheiten des Wohlfahrtsstaates haben diese soziale Beweglichkeit und Vereinzelung der Menschen geschaffen. Sie sind bereits in ihre Ansprüche und Lebensgewohnheiten integriert.
Vieles an überlieferten Normen ist brüchig und unglaubwürdig geworden. So wurden auch die Formen des Zusammenlebens zwischen Mann und Frau und die Beziehungen zwischen den Generationen in einen seit der Konstituierung der bürgerlichen Familie im 18. Jahrhundert noch nie so radikalen Wandlungsprozeß gezogen. Die Frage ist, ob wir für diese neuen Strukturen und Lebens-Voraussetzungen des Partnerschafts- und Generationsgebildes sprachlich dasselbe Wort verwenden dürfen und sollen, das im Hervortreten der bürgerlichen Welt in der europäischen Neuzeit „Familie” genannt wurde.
Ich wähle, um den Übergang deutlich zu machen, den paradoxen Begriff der „postfamilialen Familie”.
- Familie - auch das Wort in seiner sozialen Bedeutung stammt aus dem 18. Jahrhundert - brachte Nähe, Vertrauen und Hilfsbereitschaft und baute auf Kontinuität, auf Durchhalten. Die Partner mußten vereinigt bleiben, dazu stehen, daß sie sich einmal entweder für oder auch gegen die Interessen der Eltern füreinander entschieden hatten. Familie bedeutete Dauer. Die postfamiliale Familie hingegen rechnet mit den tatsächlichen oder angeblichen Entwicklungsnotwendigkeiten der einzelnen Frau, des einzelnen Mannes.
- Diese individuellen Entwicklungsmöglichkeiten lassen sich immer schwerer mit einer Kontinuität von Gemeinsamkeit verbinden. Das bedeutet viel Verständnis und Verständigung, Toleranz. Nicht lebenslange, sondern lebensphasengebundene Partnerschaften mit dazwischenliegenden Scheidungen sind die Folge neuer Ansprüche auf eigene Entwicklungen.
- Die Willensbildungen der einzelnen für sich selber und für ihre individuellen Lebenspläne verstärken sich. Daraus entstehen Spannungen, für die es noch kaum Leitgedanken des Krisenmanagements gibt. Der Mann würde sich bald ein Kind wünschen, die Frau macht geltend, daß sie bei einem Karrieresprung im Beruf alles nur keine Schwangerschaft brauchen könne...
Veränderung der Anschauung zum Kind
- Auch die Einstellungen zum Kind haben sich entscheidend gewandelt. Die bürgerliche Familie sah in den Kindern Hoffnungsträger der Gruppe, Verlängerung der Familie in die Zukunft. Auch dort, wo ökonomisch und kulturell, an Vermögen, Kenntnissen, Kunstsinn und Sprachen weniger mitgegeben werden konnte, wie in den kleinbürgerlichen oder proletarischen Familien, wurden die Kinder in der alten bürgerlichen Familie als Fortführer eines sozialen Aufstiegsprozesses angesehen. Man delegierte an sie eigene Zukunftswünsche, mit den Vor- und Nachteilen solcher die Kinder betreffenden und oft im Übermaß belastender Erwartungen. Noch in der kleinbürgerlichen oder proletarischen Familie des 20. Jahrhunderts war das so.
- In der postfamilialen Familie der mittleren und oberen Schichten wird das Kind hingegen zum Projektionsort unmittelbarer Wunscherfüllung für die Eltern. Daher ist es auch für diese Eltern oft so schwer, die Wünsche der Kinder schon ab deren frühestem Alter einzugrenzen. In der postfamilialen Familie wird das Kind zum Glücksträger. Bei alleinerziehenden Eltern verstärkt sich diese Haltung noch. Kinder nehmen in der Welt, in der man sich hüten muß, von der Gesellschaft oder auch vom Partner mißbraucht zu werden (da ja Mißbrauch in unserer Welt ein unterschwelliges soziales Spiel geworden ist), kompensatorische Funktion an. Im Dauerkonflikt von ungelösten Partnerschaftsfragen, bei vereinsamten Großmüttern, die in ausgetrockneten Ehen darben, können Kinder nicht nur strategisch eingesetzt, sondern auch zu Maskottchen werden.
- Hinzu kommt, daß die Kinder, von denen die Elternperson so viel emotionale Belohnung erwartet, kaum so außerordentlich viel persönliche Zuwendung erhalten. Es fehlt an geduldigen und aus der eigenen Phantasie geschöpften Anregungen zum Spielen, an anteilnehmender Haltung auch bei unverständlichem Kummer der Kinder, an gemeinsamen Aktivitäten, die Abstriche von den Freizeitwünschen der Erwachsenen und damit die so ungeliebten Verzichte verlangen. Kindern wird viel eher „etwas geboten”, als daß man sich ihnen, auch ihrer Phantasie folgend, selber anbietet. Und dieses etwas, stamme es aus dem Supermarkt oder dem Fernsehprogramm, aus der Märchenkassette oder dem unübersehbaren Angebot der Spielzeugläden, kommt von außen. Das müssen nicht nur die Miniautos in Match-box-Größe sein, die sehr früh die Phantasie des Kleinkindes mit Schnelligkeit und technologischer Potenz hypnotisieren. Was so angeboten wird, ist dann nicht Produkt einer eigenen, der speziellen Familie angepaßten oder gar von ihr hervorgebrachten Phantasie und Kultur. Es ist Massenprodukt.
- Die Orientierung auf Selbstverwirklichung bei den Eltern - so wichtig Aspekte dieser Orientierung vor allem im Nachholbedarf der Frauen sind, schafft in der postfamilialen Familie eine von der heutigen Soziologie vielfach beschriebene Individualisierung. Aber gerade bei dieser ist die Gefahr, daß die durch Stereotypisierung gekennzeichnete Konsum- und Mediengesellschaft mit ihren Ansprüchen und Belohnungen durch die Hintertür hereinkommt.
- Chancen für die Ausformung von Besonderheiten für die eigene Individualität, höchstpersönliche Ansprüche vom intimen und sexuellen Leben bis zu Beruf und Freizeit, werden mit Intensität gesucht und als quasi-moralisches Becht vertreten und erstrebt. Aber die hochorganisierte und äußerst suggestive Welt des Marktes und der Medien bedient sich vieler mittels wissenschaftlicher Forschung über deren soziale Akzeptanz vorfabrizierter und eingängiger Modelle. Sie reichen vom Gesundheitsverhalten bis zur Liebe, vom Urlaub bis zur Mode, sodaß das, was als eigenster Wunsch oder sogar als „Selbstverwirklichung” erscheint, im Grunde Verwirklichung der plakatierten, der marktgängigen und medial durch Beklame gestützen Modelle ist.
- Man darf auch die Überforderung der oft aus dem Streben nach Selbstverwirklichung und mit großem Mut begonnenen Alleinerziehung von Kindern durch Frauen nicht übersehen. Aber alleinerziehende Mütter sind meist ökonomisch schlechter gestellt als verheiratete. Sie müssen viele Unsicherheiten im Alltag kompensieren. Wer nimmt dann an ihren Schwierigkeiten Anteil? Diese Verunsicherung wird dem Kind fühlbar. Es bemerkt vorwiegend unbewußt das Defizit und kann sich unter Umständen sogar die Schuld für fehlende fa-miliale Strukturen zuschreiben.
Die für sein Leben und Überleben nötige hohe soziale Bereitschaft läßt beim „homo sapiens” die Einsamkeit der Frau und die Einseitigkeit der Erziehung von Einelternfamilien nicht unbemerkt hinziehen. Die Kinder fühlen die Defizite. Für die Buben fehlt bei der Mutterfamilie die für die nötige Konflikt- und Identifikationsfigur „Vater”.
Wandlungen der Familie hängen von vielen gesellschaftlichen Veränderungen außerhalb der Familie ab, so auch von der entscheidenen Verlängerung und den neuen Strukturen des Lebenslaufs. Was ist geschehen?
Generationsfolge hat die Form einer Bohnenstange angenommen
Nach einem Bild amerikanischer Soziologen hat die postfamiliale Konstellation von Eltern, Kindern und Kindes-Kindern die Form einer Bohnenstange angenommen. Einerseits ist das Individual-Leben länger geworden; mit 60 hat eine Frau in Mittel- und Westeuropa 23, ein Mann durchschnittlich weitere 18 Jahre zu erwarten. Auch die Phase gleichzeitigen Lebens mehrerer Generationen hat entscheidend zugenommen. Die Generationsfolge hat so die Form einer langen Bohnenstange erreicht. Aber diese Generationsfolge ist sehr schmal geworden: es gibt wenig Geschwister.
Vor 130 Jahren hatte in Westeuropa ein Sechstel der 50jährigen noch lebende Eltern, heute sind es zwei Drittel. Ein Drittel der Frauen über 75 sind Urgroßmütter. Die sogenannte „empty-nest”-Phase der Eltern, das Zusammenleben der älter gewordenen Partner, nachdem die erwachsenen Kinder aus dem gemeinsamen Haushalt auszogen, beträgt durchschnittlich 25 Jahre.
Nie zuvor in der Geschichte wurde das enge Zusammenleben von Partnern so lange auf die Probe gestellt, da früher der Tod die Gemeinsamkeit oft schon im mittleren Leben von der einen oder anderen Seite her aufhob. Die gleichzeitig lebenden Generationen, mindestens drei, oft vier, manchmal fünf, koexistieren heute aber in doppeltem Sinn nebeneinander: nur Minderheiten - und dies in Europa zunehmend - wohnen in gemeinsamem Haushalt. Allerdings bestehen auf sozialer Ebene vielfältige Austauschund Stützungsbeziehungen. 80 Prozent aller stützungsbedürftigen Alten werden nicht in Heimen oder Spitälern, sondern unter großen zeitlichen und nervlichen Belastungen in deren Wohnungen von Familienangehörigen, zur Zeit meist von Frauen in mittlerem oder selber schon höherem Alter, gepflegt.
Dieser Befund darf freilich nicht in die Zukunft fortgeschrieben werden. Die niedrige Geburtenrate reduziert die Wahrscheinlichkeit nachwachsender familiärer Pflegerinnen. Die zunehmende auch qualifizierte Berufstätigkeit von Frauen mit erwartbar längerer Lebens-Arbeitszeit wird ihre Disponibilität als Pflegerinnen der Angehörigen der ältesten (manchmal: der zwei älteren Generationen) entscheidend herabsetzen. Wechselseitige Hilfe bedeutet auch heute nicht mehr, daß die Generationen einander viel zu sagen haben.
Nebeneinander leben die Generationen auch deswegen, weil die geschichtlichen und kulturellen Welten, an denen sie teilhaben, enorm stark voneinander abweichen. Es gibt auch wenig Verständigung über diese Divergenzen. Die Alten können sich kaum über ihr frühes Leben und das, was zu ihrer Zeit sie persönlich oder politisch bewegte, verständlich und akzeptabel artikulieren. Was die Gesellschaft durch moderne Medizin und Wohlfahrtsstaat hervorgebracht hat, nämlich physische und teils auch soziale Koexistenz der Generationen, kann sie kulturell nicht erfüllen. Die Ideale, die Freizeitwünsche, die Lieblingslektüre, der Musikgeschmack, sie weichen so sehr voneinander ab, daß sich die verschiedenen Generationen in der Familie darüber kaum zu finden verstehen.
Nicht nur hinsichtlich der Jugend, auch für die älteren Generationen zeigt sich: die kulturelle Identifikation wird, eher außen, bei den Altersgenossen oder sonstwo außerhalb der Familie; in Medien- und Konsumangeboten gesucht. Die Identifikation kommt weniger im ambivalenten Bezugsfeld Familie zustande, in dem Ablehnung und Anziehung so stark ineinandergeflochten sind. Dies führt auch dazu, daß viele unbearbeitete Abhängigkeiten, sei es zwischen den Generationen, sei es zwischen den Geschwistern, aus Kindheit und Adoleszenz durchs Leben, oft ungelöst bis in den Tod mitgeschleppt werden. Unsere Familien haben aus sich heraus wenig Versöhnungskraft.
Die Kirchen als versöhnungsspendende Institute sind, besonders was ihre Prediger anlangt, meist weit weg von der verzahnten Gefühlswelt der Intimität, die aus großer Nähe wie durch Sexualität, Pflege und Dauerabhängigkeit entsteht.
Was ergibt sich aus diesem Befund? Intergenerative Befreiungsarbeit -womöglich eine Befreiung zueinander — bildet eine wichtige sozialpsychiatrische und gesellschaftspolitische Forderung. Individualisierung kann nur bei Verbesserung von Konfliktverarbeitung ihre guten Seiten zeigen. Jede Kultur und Epoche muß sich gegen Aggression im intimen und persönlichen Bereich um neue Sicherungen mit den Mitteln dieser neuen Kultur bemühen. Die gestrigen Mittel sind selten die geeigneten, wenn auch die Achtung vor bestehenden Stützen und deren Prüfung auf Tauglichkeit nicht Konservativismus bedeuten muß. „Was gut ist, das behaltet”, auch wenn es von gestern ist. Aber auch neue Haltungen und vor allem Rollenverteilungen können helfen.
Gesprächskultur innerhalb der oft nur schwachen verbliebenen Generationenbeziehungen und Hilfen von außen durch Beratung oder Psychotherapie werden wohl immer mehr zur Übergangsform der „postfamilialen Familie” gehören müssen.
Anm. d. Red.: Von hier aus kann auch die Diskussion über angemessene Formen von Toleranz ansetzen. Darum geht es im „Dossier” der nächsten Woche.