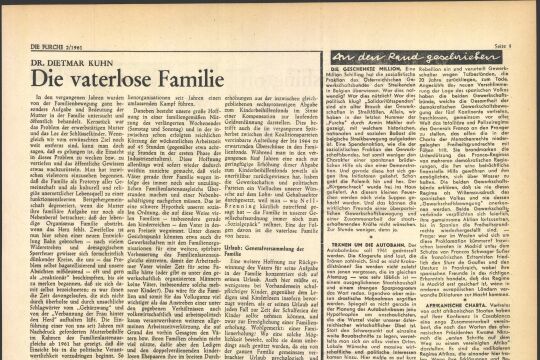Familien, die Narren der Gesellschaft
Kinder und Familie gehören nach wie vor zu den großen privaten Visionen der Österreicher. Doch ökonomischer Druck, die Kurzlebigkeit von Lebensperspektiven, geänderte Werthaltungen und eine teilnahmslose Politik untergraben massiv das Vertrauen in das "Projekt Familie".
Kinder und Familie gehören nach wie vor zu den großen privaten Visionen der Österreicher. Doch ökonomischer Druck, die Kurzlebigkeit von Lebensperspektiven, geänderte Werthaltungen und eine teilnahmslose Politik untergraben massiv das Vertrauen in das "Projekt Familie".
Der Tod der Familie, vor allem der Mehrkindfamilie, löst eine Revolution aus, die zu unabsehbaren ökonomischen, sozialen und kulturellen Erschütterungen führt. Der Generationenvertrag kann in den Archiven des 20. Jahrhunderts abgelegt werden. Symptomatisch für eine Zeit, in der eigentlich niemand das will, was passiert, setzen breit angelegte Verödungs- und Austrocknungsprozesse diese uralte Institution auf die Rote Liste, ganz gegen den Willen der Mehrheit, denn nach wie vor gehören Familie und Kinder zu den großen privaten Visionen.
Die Politik ignoriert diesen Konsens. Es ist ihr gelungen, unnötig, ja mutwillig, die Familienfrage in einen ideologischen Grabenkrieg zu verwickeln. Diese fruchtlosen Gefechte können sich nur auf der Grundlage einer völlig verfehlten Zuordnung der Familienpolitik entladen. Diese wird fälschlich als Teil der Sozialpolitik, nicht als Teil der Ökonomie angesehen. Diesem Verständnis entsprechend sind Familien und Kinder Empfänger von Sozialleistungen und müssen sich vor dem gestrengen Auge der sozialen Gerechtigkeit rechtfertigen, so wie etwa Arbeitslose oder Sozialhilfeempfänger.
Aber was ist schon gerecht, in Zeiten des Diktats der leeren Kassen? Man muß nur die Tochter des Generaldirektors durch die virtuellen Räume reiten lassen und die Vorstellung lancieren, das Karenzgeld für alle wandere direkt in die Futtertröge der Gäule der Reichen, und schon brechen die zarten Pflänzchen einer nicht ideologischen Familienpolitik zusammen. Dazu noch ein paar Bildchen aus verkommenen Altenheimen, und schon ist die Familien- und Generationenfrage wieder im Lot. Nur im Rahmen eines auf Bedürftigkeitsnachweise abzielenden Kontexts macht die Behauptung Sinn, in Österreich würden die Familien luxuriös bedient, liegen wir doch bei den Familienausgaben nach Luxemburg, so der schulungsmäßig eingelernte Stehsatz, am zweiten Platz. Nur auf dieser Linie kann Bernd Marin, ein prominenter Berater der Bundesregierung, die Erhöhung von Familienleistungen als konservativen Familienkommunismus bezeichnen.
Das ideologische Wettrüsten im Bereich der Familienpolitik könnte man schnell beenden, würde man die Familie als Teil der Gesamtökonomie betrachten: Ergebnis wäre: es geht nicht um Moral, sondern darum, wie viel uns das Produktionssystem Familie wert ist. Es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern um die Zumutbarkeitsgrenzen von Dummheit. Es geht nicht um Umverteilung, sondern um angemessene Abgeltung. Es geht nicht um die "heile Welt" als Gegenbild zur Modernisierung, sondern um die höhere Qualität von Non-market-Ökonomien zur Deckung bestimmter Bedürfnisse.
Erst aus der präzeptorialen Warte sozialpolitischer Verteilungs-Großherzigkeit erscheinen die Zumutungen an die Familie nahezu unbegrenzt nach unten elastisch und können ungestraft mit hämischen Ratschläge an die Eltern kombiniert werden, diese sollten doch gefälligst von den Ressourcen der Liebe zu ihren Kindern und ihrem archaischen Hang nach Fortpflanzung zehren. Dieses Denkmuster ist erwartungsgemäß auch weitgehend resistent gegenüber der beklemmenden Daten- und Faktenlage zur Lage der Familie: Weder Kinderarmut noch Berechnungen zum Wert der Gratisleistungen der Familien, weder die Zahlen zu Disparitäten in der sozialen Absicherung zwischen Jung und Alt noch die Auswirkungen auf die Arbeits- und Sozialsituation von Frauen, und schon gar nicht die Zahlenkolonnen, die die unverschämten Beutezüge gegen den Familienlastenausgleichsfonds dokumentieren, haben mehr als ein Achselzucken bewirkt. Die einzige substantielle Maßnahme zugunsten der Familien in den neunziger Jahren, die Anhebung der Familienbeihilfe, hat der VfGH erzwungen.
Kosten, Arbeit, Mühen Familien sind nicht Sozialleistungsempfänger, sondern Produktionsstätten. Sie liefern künftige Zahler, künftige Arbeitnehmer und Unternehmer, künftige Träger von Kultur, politischen Entscheidungen und sozialen Beziehungen. Familien sind Non-market und Non-profit-Unternehmen, deren Leistungen unverzichtbar, hochwertig und nicht ersetzbar sind. Familien haben Kosten, Arbeit und Belastungen. Diese nehmen sie auch im Interesse anderer auf sich. Während nämlich die Kosten des Unternehmens Familie (vor allem die "Arbeitskosten") weitestgehend privatisiert sind, wird der Gewinn abgesaugt, umverteilt und vergesellschaftet. Die Rechtsordnung zwingt dem Unternehmen "Familie" eine universelle Sozialisierung des Nutzens ihrer Investitionen auf. Müßte dieser Nutzen auf Märkten eingekauft werden, dann müßte dafür ein Vermögen ausgegeben werden. Das heute noch immer dominierende und auch rechtlich verfestigte Denken, die Leistungen der Familien und die Kosten sowie Nutzen von Kindern dem privaten Bereich zuzuordnen, ist daher in keiner Weise mehr zeitgemäß.
Familien wären daher so zu behandeln wie andere Unternehmen, die Leistungen an Dritte erbringen. Es ist daher nur rational, die geheiligten Maßstäbe der neoliberalen Effizienz- und Leistungsreligion auch auf sie zur Anwendung zu bringen. Wenn die Leistungsbereitschaft erhalten werden soll, muß "Standortsicherungspolitik" betrieben werden. Wenn Leistungen an Dritte erbracht werden, gebührt dafür eine angemessene Abgeltung. Und wenn Aufwendungen zur Erhaltung künftigen Produktivvermögens anfallen, müssen dafür die Nutznießer zahlen. Eine Familienpolitik nach diesen Maßstäben würde anders aussehen. Sie könnte die Familien nicht mehr als einfältige Narren der Gesellschaft behandeln.
Eine ökonomische Betrachtungsweise offenbar auch, wohin es führt, wenn man die Dummheit der Mehrkindfamilien überfordert. Tatsächlich ist die Dynamik der gegenwärtigen Entwicklung hin zum Tod der Familie und zum Umbau Europas in die größte geriatrische Abteilung des Planeten eine Frage der Dummheitsverträglichkeit der Familien. Was kann Familien zugemutet werden, ohne daß sie aufgeben?
Vergleichen wir im Zuge einer Dummheits-Verträglichkeitsprüfung eine Eltern-Zwei-Kind-Familie mit einem Double-Income-No-Kids-Paar (kurz DINKs genannt). Die einen wenden in die Millionen gehende Beträge zur Aufrechterhaltung des Generationenvertrages auf. Mit ihren Leistungen produzieren sie jene Zahler, die dereinst auch für das Dink-Paar aufkommen werden. Die Gesellschaft bedankt sich dafür auf ihre Weise: die dummen Eltern werden für ihre Investition ordentlich abgestraft. Ihre Einzahlungen in die eigene Zukunftsabsicherung können sie vergessen, die wandern in den unermeßlichen Pott des Umlagesystems. Vielmehr werden auch sie in den Strudel der durch Dinks und Singles mitverursachten Verschlechterung der Relationen zwischen den Aktiven und Inaktiven hineingezogen. Ihr Sozialniveau wird abgesenkt, und das, so wie es sich eben für Dumme gehört, gleich stärker als bei den intelligenten DINKs: also: eine geringere bis gar keiner Eigenpension der Frau, geringere Spielräume für die Eigenvorsorge und Wettbewerbsnachteile am Arbeitsmarkt, mit den bekannten Folgen für die soziale Absicherung. Pech gehabt.
Pech gehabt haben auch deren Kinder. Obwohl ihre Eltern einen happigen Beitrag zur Erhaltung des Generationenvertrages geleistet haben, entkommen sie der Schere des umlagefinanzierten Sozialstaats nicht, wenn sich die demographischen Relationen verschlechtern. Das Ergebnis: mehr zahlen, weniger bekommen, verringerte Möglichkeiten zur Eigenvorsorge.
Während die dumme Mutter 50 Stunden pro Woche ihre unbezahlten Dienste leistet, dabei dem Staat kostspielige Kinderbetreuungseinrichtungen erspart, auf diese Weise ihre Eigenpension verjuxt und nur hoffen kann, daß ihr Mann keine Freundin hat, können die mobilen und flexiblen Dinks und Singles in hochgradig intelligenter Weise die Chancen der neuen Arbeitsmärkte nutzen. Sollte sich die Mutter doch in die Erwerbswelt wagen (müssen), dann dumpen die Dink- und Single-Frauen ihre armen (von der Frauenbewegung dafür verhöhnten) Konkurrentinnen, die sich mit bleiernen Kugeln am Bein durch die deregulierten Arbeitsmärkte kämpfen, mit links aus dem Feld.
Selbst diese Umstände, die wie gesagt allen Regeln von Kostenwahrheit und Leistungsgerechtigkeit Hohn sprechen, schafften es lange Zeit nicht, den ungewöhnlich starken Willen der Menschen zu Familie und Kind zu brechen. Erst jetzt läutet eine neue Dynamik nun wohl unwiderruflich das Ende der Familie ein. Die gesellschaftlichen Trends und eine lässig-teilnahmslos zuschauende Politik verstärken nochmals die Verhöhnung von Mehrkindfamilien als wandelnde Anachronismen, halbperverse Lemminge und pathologische Desperados mit einem unbewältigten Kindertick.
Bruch- und Kippstellen Was nunmehr der Familie das Genick bricht, das ist eine Mischung aus ökonomischem Druck, Faszination der Angebote des neuen Erlebnis-Kapitalismus, Kurzlebigkeit von Lebensperspektiven und vor allem einer Verschlechterung der immateriellen Qualitäten des Familienlebens selbst. Letzteres greift die Motivationressourcen für die bisherige Inkaufnahme von Verzicht und der Selbstausbeutung frontal an.
Die wichtigsten Bruch- und Kippstellen dieser Tendenz, die dann letztlich auch den alten Generationenvertrag aushebelt, sind: n die ungelöste Frauenfrage, die sich bei Destabilisierung der Familienverhältnisse und einem massiv verschärften Wettbewerb am Arbeitsmarkt drastisch zuspitzt; n das neue Exklusions-Inklusionsfeld eines individualisierten Lifestyle-und Eventkapitalismus wird zur Meßlatte von Teilhabe und Sinnerfüllung, und treibt zum Beispiel die jungen Familien in eine durchschnittliche Verschuldung von einer Million; n die Schneisen, welche die postmoderne Risikogesellschaft in die Werthaltungen der Jugend einkerbt, die Entstehung einer sehr gegenwartsbezogenen, illusionslosen, fun-orientierten Haltung; n die Flexibilisierungen, Beschleunigungen, emotionalen Überlastungen, chaotischen Zeitstrukturen, die das Leben in der Familie zum Gegenteil jener Idylle machen, die immer noch maßgeblich das Leitbild der Familiengründungsentscheidungen ist.
Diese Trends zerstören die Voraussetzungen befriedigender und sinnvoller familiärer Beziehungen. Sie veröden die Lebensverhältnisse in den Familien, sie setzen Kinder wie Eltern, vor allem Frauen, einem unzumutbaren Druck aus. Die öffentliche Verhöhnung von Tugenden, Bindungen und langfristigen Verpflichtungsverhältnissen untergräbt die notwendige Vertrauensbasis in so langfristige Projekte. Mit der Zunahme von Lebensabschnittspartnerschaften und Kurzfristkindern nimmt die Bereitschaft, ein halbes (oder bei Frauen ein ganzes eigenes) Lebenseinkommen zu riskieren, verständlicherweise rapide ab.
Zusammenfassend: Der bisherige Widerstand gegen die Ökonomisierung des Denkens im Bereich der privaten Beziehungen nimmt ab, da seine emotionalen und alltagskulturellen Ressourcen ausgetrocknet werden.
Die Politik schaut zu Damit aber stirbt die Familie: Entweder gleich, indem sie schon vor ihrer Gründung aus ökonomischen Erwägungen abgetrieben wird, oder nach ihrer Gründung, indem die ursprünglich motivierende Vision in den ganz banalen alltäglichen Abläufen schlicht zerrieben wird. So wundert es niemanden mehr, wenn vor und nach Weihnachten die Scheidungsberatungsstellen gestürmt werden - ein Symptom unter Tausenden. Die Familienmitglieder werden im besten Fall zu einer Gemeinschaft von eher zufällig zusammengewürfelten Konsumenten unterschiedlichen Alters - im schlimmsten Fall herrschen Gewalt, Zerfall und Depression. "Die Familie ist heute vor allem eine Erwerbsgemeinschaft zur Beschaffung und Bedienung zahlloser steckdosenabhängiger Geräte", meint etwa der Soziologe Reimer Gronemeyer.
Wann wird also die Politik aus ihrer Rolle der teilnehmenden Beobachtung heraustreten?
Inzwischen geht es längst um mehr als nur um den Generationenvertrag, obwohl mit der relativen Verringerung der Zahl der Kinder ein schwerer Konflikt zwischen den Generationen nicht auszuschließen ist.
Diese Entwicklung ist ein Menetekel für die Art von Gesellschaft des nächsten Jahrhunderts, wie sie sich umrißhaft bereits abzeichnet. Wenn selbst eine so starke lebensweltlich-kulturelle Kraft wie der Wunsch nach einer familiären Gemeinschaft, der sich auf so gewaltige achetypische Energien stützt, vor den Märkten, den Arbeits- und Lebensbedingungen und den multimedialen Verführungsindustrien des entfesselten globalen Erlebniskapitalismus in die Knie geht, welche Chancen bestehen dann überhaupt noch für den Weiterbestand nicht marktförmig organisierter Produktions- und Konsumationsprozesse?
Dennoch bleibt eine Hoffnung: Alt und Jung sind in besonderer Weise auf lebensweltliche, weiche Umfelder angewiesen. Beide zahlen für die geschilderten Tendenzen einen unerträglich hohen Preis. Das wäre doch eine Basis für einen neuen Vertrag.
Aber wer führt die Sondierungsgespräche?
Der Autor ist Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Salzburg, Präsident der Robert-Jungk-Stiftung und war zehn Jahre sozialdemokratischer Abgeordneter im Salzburger Landtag.