
Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Pakt gegen die Schwachen
Caritas-Chef Schüller plädiert für eine neue Balance zwischen Ich und Du: „Fürchtet Euch nicht. Schon gar nicht vor Solidarität!”
Caritas-Chef Schüller plädiert für eine neue Balance zwischen Ich und Du: „Fürchtet Euch nicht. Schon gar nicht vor Solidarität!”
Es ist kein Wunder, daß Diskussionen über eine Neugestaltung der Sozialpolitik nicht vom Fleck kommen. Der Ansatz beim Sparstift des Staatsbudgets führt eben nur zu sehr kurzatmigen Einsparungsvorschlägen. Oft von solchen vorgebracht, die sich als ausgenützte Abgaben-Wohltäter empfinden. Abgeschmettert von Verteidigern des Bisherigen. Über dem Ganzen liegt dann nicht selten ein Hauch von altem Klassenkampf. Die Pragmatiker in der Politik hoffen wohl auf den Zwang des Faktischen.
Aber wahrscheinlich ist der Sparstift ein Denkmuster, innerhalb dessen noch Verständigung möglich ist. Denn „soziale Gerechtigkeit”, „gesellschaftlicher Lastenausgleich”, oder gar „Solidarität” stehen eher nur mehr als Schlagworte zur Verfügung. Leitbild für gesellschaftliche Entscheidungen sind sie kaum mehr. Die Individualismus-Starre, von der die westlichen Post-Industriegesellschaften befallen sind, macht aus der Gesellschaft eine Summe von Individuen mit kalten Zwischenräumen. Die überfließende Versorgung mit Gütern und der von vielen sozialen Aufgaben entlastende Staat haben zum großen Ego-Trip verführt. Auf diesem Trip kippt die Balance zwischen Sozialität und Individualität um: zum Individualismus mit Sozialabgaben verpflichtunS:
Die Politik ist auf der Suche nach Mehrheiten dem Druck zur Anpassung an diese Mentalität ausgesetzt. Die Wünsche der Mehrheit regieren und die Interessen der besser Vertretenen siegen („Je mehr wir sind, desto mehr wird's” habe ich unlängst sinngemäß auf dem Plakat einer Interessenvertretung gelesen).
In einer solchen Gesellschaft wird man lautlos arm. Der Lärmpegel der Unterhaltungsindustrie ist zu hoch, der Freizeitbetrieb zu beanspruchend, das Auge zu sensationenverwöhnt, als daß man da genauer hinsehen, aufmerksam werden, sich beunruhigen lassen könnte.
Nur ganz kurz blitzt da etwas auf, wenn etwa die Computer die finanziellen ^icht-Folgen der jüngsten Pensionserhöhung für die Bezieher kleiner und kleinster Pensionen berechnen. Kurzes Kopfschütteln („Hoffentlich haben die wenigstens genug zum Heizen!”), ein keckes Wort gegen die Regierung, und schon ist man wieder bei den entspannenden Plaudereien über Banalitäten. Was aus vielen Frauen, Alleinerziehern, Familien mit mehreren Kindern wird, wäre weniger entspannender Gesprächsstoff.
Die enge Koppelung der sozialen Absicherung an eine möglichst ununterbrochene, gut bezahlte Erwerbstätigkeit war noch nie das Netz für alle. In der Zeit rasanteren Wirtschafts- und Beschäftigungswachstums aber für sehr viele. Doch diese Zeiten sind vorbei. Es genügt nicht mehr, Grundsicherungsmodelle unabhängig von Erwerbstätigkeit als „alt-linke Phantastereien” abzu-tun. Die Zeiten für immer mehr Menschen sind zu ernst dazu.
An die Banalität der Beislplauderei-en schließt auch die zeitgeistige Ironie über „die Familie” nahtlos an. So als wäre sie nicht nach wie vor der wichtigste, täglich vielhundert-tausendfach arbeitende „soziale Dienstleistungsbetrieb” unserer Gesellschaft. Die Familie braucht keine Almosen, sie soll nur in ihrer gesellschaftlich wichtigen Leistung nicht auch noch behindert werden. Sie hat es schwer genug.
Man muß nicht das Familien-Verständnis der Kirche sein eigen nennen. Es genügt schon, Jugendrichtern, Sozialarbeitern, Polizisten und Lehrern zuzuhören, um sich von der sozialpolitischen Bedeutung einer fairen Einkommens- und Steuerpolitik für die Familien zu überzeugen.
Apropos „Familie”: Lautlos für die Öffentlichkeit vollzieht sich auch die beispiellose Erniedrigung von Gastarbeiterfamilien. Wie „Arbeitskräfte mit Ablaufdatum und menschlichem Anhang” werden sie gnadenlos über Quoten-, Fristen-, Lebensunterhalts- und Wohnflächenhürden geschickt. Ganz so, als wären sie nicht davor für den Aufbau und die Sicherung unseres Wohlstandes benützt worden. Der Gesellschaft dreht es den Magen eher von zuviel Gänseleber um (außer es handelte sich um die Abschiebung der eigenen Bedienerin), und sie läßt Politiker die Wahlen eben nur mit „nicht zu viel Ausländerfreundlichkeit” gewinnen oder nicht allzuhoch verlieren.
Wer werden die Nächsten sein? Vielleicht die Eltern, bei deren Kindern man schon vor der Geburt gen-analytisch Behinderung diagnosti-. ziert und die eben selbst werden zusehen müssen, wie sie durchkommen, wenn sie ihr Kind schon unbedingt zur Welt bringen wollten? „Außerdem ist das ja ohnedies kein Leben: als Behinderter ...”
Oder die Pflegebedürftiggewordenen, die wir immer deutlicher spüren lassen, daß wir sie nur mehr mühsam in unser Denken, unsere Freizeit und unser Sozialbudget einzubauen vermögen. Und deren Angst davor, uns zur Last zu fallen, heuchlerisch mit dem „Angebot” aktiver Sterbehilfe beantwortet werden könnte? „Außerdem ist das ja ohnedies kein Leben: als Pflegebedürftiger ...”
„Gelöst” - und zwar mit einer Frist - soll angeblich auch eines der beschämendsten Probleme unserer Wohlstandsgesellschaft sein: daß der Überlebenskampf schon im Mutterleib beginnt. Damit soll auch nebenbei ein wichtiges Stück Frauenbefreiung gelungen sein. Die befreiten Männer lachen sich eins: wenn die Frauen nicht abtreiben wollen, dann sollen sie eben anderweitig dafür sorgen, daß „keine Probleme” entstehen. Und wenn, dann ist es ohnedies das Problem der Frau, der Freundin, der Tochter.
Und Probleme für alleingelassene Mütter gibt es wahrhaftig genug. Nicht zuletzt auf dem Wohnungsmarkt, wo sie oft nur als äußerst schwache „Nachfrager” auftreten können. Das Mutter-Kind-Heim ist auch in unserer Gesellschaft keineswegs überflüssig geworden. Im Gegenteil. Wohnung als Ware, deren Verteilung sich selbst regulieren soll? Oder nicht doch auch als Grundelement menschenwürdigen Lebens? Als sozialpolitische Priorität? Immer mehr Menschen haben ein Wohn-Problem - und bei weitem nicht mehr nur die „klassischen Armen”.
Sind wir noch eine sozial ausgewogene Gesellschaft? Dabei war noch nicht einmal von den Obdachlosen, den Suchtkranken, den Vorbestraften, den Lohngepfändeten die Rede. Auch nicht von den schon lange Zeit Arbeitslosen oder den psychisch Kranken. Auch nicht von den Jugendlichen, die noch nie Arbeit hatten oder von den Flüchtlingen.
Kommt das I^eitbild einer sozial ausgewogenen Gesellschaft unserem Individualismus-Trip zu teuer? Schließlich will ja eine Menge Konsum und Unterhaltung finanziert sein, bevor uns der Staat für die „Nichtstuer” und Leistungsschwachen etwas wegnehmen darf! Der Sparstift bei den Armen ist da schon das beruhigendere Leitbild. „Schließlich ist jeder seines eigenen Glückes Schmied”, denken die Glückskinder unserer Tage und vergessen, daß sie selbst auch eine Menge „Glück” zur Erhaltung ihres Wohlstandes brauchten und sie von den „Pechvögeln” vielleicht nur wenige Monatsgehälter oder ein Stück weniger Gesundheit oder ein weniger verläßlicher Lebenspartner trennen.
Wenn der Wohlstand nicht an äußeren Symbolen darstellbar wäre: aus den Augen dieser Gesellschaft schaut er nicht. Eher schon Anspannung, Wohlstandsverwaltungsstreß, Mißtrauen, Erschöpfung, Konkurrenzangst und trotz allem manchmal immer noch Gier. Tut uns der Ego-Trip am Ende selbst nicht mehr gut? Unserer Politik, unseren Kindern, unserer Umwelt, unserer Gesundheit, unserem Lebenssinn? Ist das noch Selbstliebe oder schon wieder weniger, wenn auch mit mehr Mittelaufwand?
„Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst!” Da wäre sie wieder, die Balance zwischen Individualität und Sozialität, dem Ich und dem Du. Die Balance, die dem lieben Sinn gibt und nicht wegnimmt. Die Balance, die aber auch einen festen Grund braucht: die Gewißheit, daß wir Gott bei uns haben und nicht selbst Gott sein müssen. Werden die Christen das Weihnachtsevangelium in seiner Aktualität für 1994 weitersagen? Es enthält nämlich ein Wort gegen die ängstliche Individualismus-Starre: „Fürchtet Euch nicht!” Vor allem nicht vor der Solidarität.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!




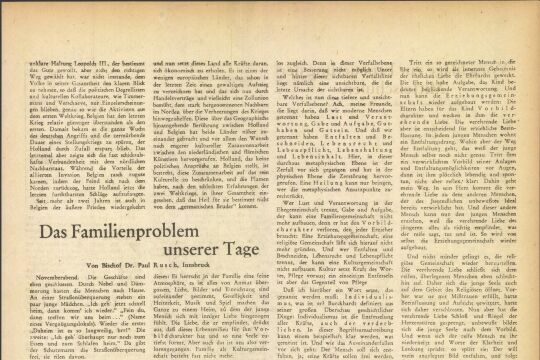
















































































.png)









