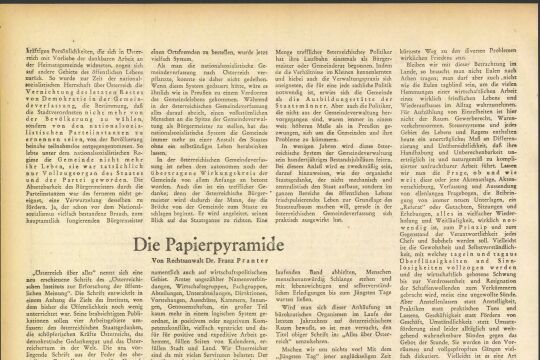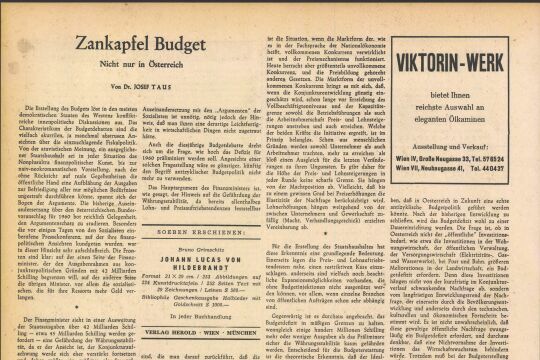Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Geldverteiler haben keine Zukunft
Jahrelang hat der Staat seine Aufgaben und damit auch Ausgaben ausgeweitet, jetzt stößt er an die finanziellen Grenzen: Was ist in Zukunft Aufgabe des Staates, was Sache der Bürger?
Jahrelang hat der Staat seine Aufgaben und damit auch Ausgaben ausgeweitet, jetzt stößt er an die finanziellen Grenzen: Was ist in Zukunft Aufgabe des Staates, was Sache der Bürger?
In der aktuellen Lage wird die Reichweite des Staates vor allem als Finanzierungsproblem gesehen: Er möchte vieles tun, aber es fehlt ihm an Geld. Darüber können sogar Regierungen stürzen. Einige Thesen sollen das Thema „Wieviel Staat, wieviel Privat?" wenigstens anreißen; der politische Konflikt bricht meist ohnehin erst los, wenn es um die detaillierte Anwendung geht.
1. Der Trend zur Ausweitung der Staatsaufgaben und der Staatsausgaben ist bereits seit Jahrzehnten erkennbar, und die rasch zunehmende Verschuldung der Republik steigert das Unbehagen an diesem Kurs. Knapp die Hälfte des Wertes, den die Staatsbürger erarbeiten, fließt mittlerweile in die Kasse des Staates und wird von dort aus weiter verteilt. Auch wenn dies ein unzureichender Indikator für die Eingriffstiefe des Staates in das Leben der Bürger ist, so signalisiert er doch eine sehr dichte Obsorge des Staates, die das tägliche Leben weitgehend durchdringt.
Besonders beunruhigend ist aber, daß die zunehmende Staats Verschuldung die Spielräume für die zukünftige Politik schrumpfen läßt: Schon jetzt gehen die zusätzlichen Schulden nur zur Begleichung der alten Schulden drauf. Dabei wissen wir, daß die großen Herausforderungen (Umwelt, Pensionsversicherung) erst vor uns liegen. Wir befinden uns in einer relativ befriedigenden wirtschaftlichen Situation, keineswegs in einer Notlage, und es ist blanker Leichtsinn, in den guten Jahren den Verschuldungsspielraum aufs äußerste auszunutzen. Eine Verschuldung, die unter diesen Bedingungen laufende Kosten auf die nächste Generation überwälzt, ist eine asoziale Politik: die rücksichtslose Selbstsanierung der gegenwärtigen Generation zu Lasten ihrer Kinder.
2. Während der staatliche Interventionismus in den sechziger Jahren un-befragt hingenommen wurde, weil die meisten an die Steuerungskompetenz des Staates glaubten, regt sich seit den siebziger Jahren zunehmend Kritik. Sie setzt bei dem überzeugend einfachen liberalen Argument an, daß den Bürgern grundsätzlich das, was sie erarbeiten, zur eigenen Verfügung belassen werden soll, und daß es in jedem Fall gute Gründe dafür geben muß, ihnen mit staatlicher Zwangsgewalt etwas von ihrem Eigentum abzunehmen: Straßen müssen gebaut, Schulen unterhalten, Pensionisten versorgt, Polizisten bezahlt werden. Es schleicht sich aber auch der Zweifel ein, ob nicht viel von diesem Geld mittlerweile auch für unnütze oder wenig dringliche Zwecke ausgegeben wird. Aber wenn Steuergeld verfügbar ist, findet sich leicht eine Verwendung dafür. Doch es ist eines liberalen Staates unwürdig, dem Bürger Geld abzunehmen und ihm in der Folge huldvoll ein Taschengeld zu gewähren. Also geht es darum, die leichte Hand des Staates beim Geldausgeben zu bremsen.
3. Es gibt freilich auch liberale Illusionen über einen peripheren Staat, denen die qualifizierten, dynamisehen und wohlsituierten Mitglieder der Gesellschaft gerne nachhängen. Sie übersehen, daß in einer so komplizierten Gesellschaft ein beachtlicher Regelungsbedarf- besteht. Er reicht von der Überwachung der Nahrungsmittel über ein anspruchsvolleres Netz des Öffentlichen Verkehrs bis zu den Voraussetzungen für ein differenziertes Bildungssystem. Staatsintervention ist gleichzeitig freiheitsbe-drohend und freiheitssichernd. Sie kostet viel und mindert deshalb den privat verfügbaren Wohlstand, aber sie schafft und sichert auch Lebensbedingungen, die keiner mehr missen will. Man kann die Liberalität übertreiben, und dann landet man in einem darwinistischen Dschungel. Man kann den Paternalismus übertreiben, und dann produziert man unmündige Bürger. Im Jubel über die Unternehmerwirtschaft darf nicht untergehen, daß dynamische und flexible Entwicklungen Verlierer hervorbringen, denen geholfen werden muß. Das ist ein Gebot der Menschlichkeit. Wenn freilich alle Unterschiede ausgebügelt werden, wird es attraktiv, „benachteiligt" zu sein. Es ist ein Gebot der finanziellen Vernunft, die richtige Balance zu finden.
4. Viel spricht dafür, daß sich der Staat wirtschaftspolitisch und sozialpolitisch übernommen hat. Die Kritik am Leviathan ist dann auch in den letzten Jahren mit ohnehin zurückhaltenden Maßnahmen zur Privatisierung, Ausgliederung und Deregulierung beantwortet worden, mit Reformmaßnahmen, die offenkundige Privilegierungen und Pfründen beseitigt haben, und selbst Anläufe zur Begrenzung der Staatsausgaben und zur Stabilisierung der Defizite wurden - mit kurzfristigem Erfolg - unternommen. Es "gibt keinen Grund, diese richtige Politik nicht fortzusetzen. Wir können uns keine pauschale Fortführung jenes Kurses leisten, der in günstigeren Verhältnissen erschwinglich war. Wir brauchen aber auch keine brutale Demontage von Sozialausgaben, wie dies die Republikaner in den Vereinigten Staaten zugunsten bessergestellter Einkommensschichten mit großer Härte durchziehen. Gerechtigkeit ist eine zweischneidige Sache: Soziale Gerechtigkeit für sozial Schwache heißt auch, daß gegen den Mißbrauch öffentlicher Gelder vorgegangen und die nüchterne Kalkulation mit Sozialtransfer bedacht werden muß. Soziale Gerechtigkeit für die nächste Generation heißt, daß wir den Riemen enger schnallen müssen.
5. Die Ursache für hohe Staatsausgaben und eine hohe Verschuldung ist eine schwache Politik. Sie kann �ich nicht wehren gegen Forderungen von Gruppen, die sich allesamt aus der Staatskasse bedienen wollen. Geldausgeben ist die einfachste Politik. Geldverteiler sind Politiker der sechziger Jahre, nicht der neunziger. Der Ansturm der Interessengruppen gegen die Staatskassen hat im Vorjahr ein erbärmliches Schauspiel geboten: von den Lehrern bis zu den Eisenbahnern, von den Reamten bis zu den Frauen. Jeder ist für das Sparen, aber unbedingt bei den anderen. Jeder verkündet seine Sorge über die Budgetentwicklung, will aber zunächst die eigenen Schäfchen ins Trockene bringen. Jeder fordert von den Politikern einen anderen Kurs, blockiert ihn mit aller Kraft, sobald er einen selbst betrifft. Diese Gesellschaft hat jene Politik, die sie verdient.
6. Die „kulturellen Schäden" der staatlichen „overprotection" werden an der Berechtigungsmentalität sichtbar, die sich verbreitet. Jeder ist eifersüchtig auf seine Rechte bedacht und schiebt die Pflichten an Staat und Behörden ab. Sozialphilosophische Begriffe sind pervertiert. „Freiheit" bedeutet, daß man mehr Geld vom Staat bekommt. „Gleichheit" bedeutet, daß bei der Geldverteilungsaktion alle ihren Jirocken abbekommen. „Solidarität" bedeutet, daß irgendjemand zahlt und ich kassiere. Das „Subsidiaritätsprinzip" ist auf den Kopf gestellt. Es besagt nicht mehr, daß die Gemeinschaft dort helfen muß, wo es kein Amt dafür gibt. Ein soziales Problem löst die spontane Frage nach dem auszufüllenden Formular oder der anzuzapfenden Geldquelle aus. Erst wenn es skandlöser-weise keine öffentliche Problembeseitigung mehr gibt, denkt man daran, selbst die Ärmel aufzukrempeln. Wenn aber der Staat für alles sorgen soll, werden seine Leistungen immer als ungenügend empfunden, und es entsteht jene verdrossene, jammernde Gesellschaft, die politische Leistungen nicht mehr einzuschätzen vermag, ja die nicht einmal mehr weiß, daß sie in einem historisch unvergleichlichen Luxus lebt.
Fassen wir zusammen: Eine hilflose Politik wäre es, weiterzumachen wie bisher, mit steigenden Staatsanteilen, Steuern und Schulden. Eine dumme Politik wäre es, die rasche und radikale Demontage des Sozialstaates auszurufen, der doch eine der großen abendländischen Errungenschaften darstellt. Eine verantwortungslose Politik wäre es, den nächsten Generationen weiter alle Probleme aufzuhalsen, die zu lösen wir zu feige oder zu faul sind. Eine feige Politik wäre es, dem Bürger zu versprechen, daß alle Schwierigkeiten ohne Opfer und im Handumdrehen zu beseitigen sind.
Ein bißchen Mogeln ist auch in der Politik erlaubt; aber wenn politische Parteien sich nur durchschwindeln wollen, sollten sie aufpassen, daß sie nicht letzten Endes in den Augen der Bürger als schwach, dumm, verantwortungslos und feige zu gleicher Zeit dastehen.
Der Autor ist
Professor für Soziologie in Graz (derzeit an der Harvard University, Cambridge, USA).
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!