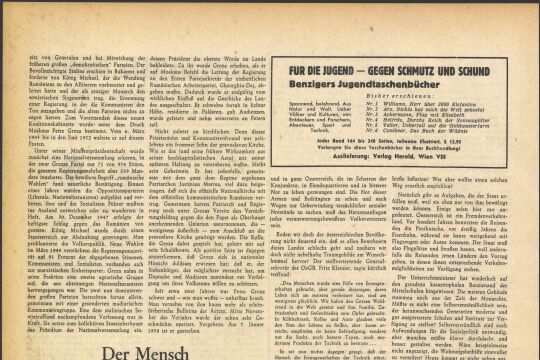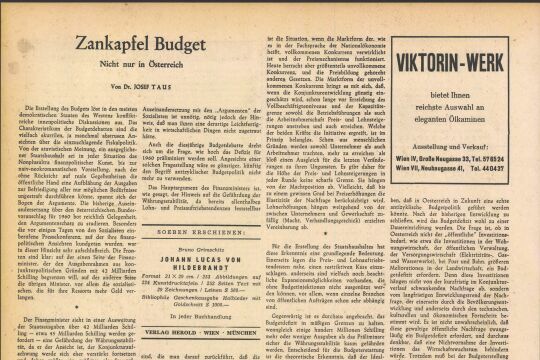Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Der Unfug mit den „unsinkbaren Schiffen”
Soll der Staat zunehmend auch zum Financier der Privatwirtschaft werden? ,JSIein!” argumentiert der bekannte Wirtschaftsjournalist Ronald Barazon („Salzburger Nachrichten”. „Der österreichische Volkswirt”). Wir stellen seine Gedanken zur Diskussion.
Soll der Staat zunehmend auch zum Financier der Privatwirtschaft werden? ,JSIein!” argumentiert der bekannte Wirtschaftsjournalist Ronald Barazon („Salzburger Nachrichten”. „Der österreichische Volkswirt”). Wir stellen seine Gedanken zur Diskussion.
Ein beliebter Begriff in der wirtschaftspolitischen Diskussion ist das Wort von den „unsinkbaren Schiffen”. Man geht von der Annahme aus, daß ein größeres Unternehmen für die Beschäftigungslage derart wichtig ist, daß „man es einfach nicht fallen lassen kann”. Kommt ein als unsinkbares Schiff angesehener Betrieb in Schwierigkeiten, so müssen die Banken, die Regierung, die Interessenverbände und wer sonst noch im öffentlichen Leben eine Rolle spielt, für die Rettung der Firma sorgen.
Diese Auffassung ist weltweit zur Selbstverständlichkeit geworden. Man beschränkt sich hier keineswegs auf Unternehmungen, die dem Staat gehören oder einer öffentlichen Stelle nahestehen. Entscheidend ist allein die Größe der Belegschaft. Eine nicht unwesentliche Rolle spielen auch das Ansehen und vor allem das Alter der jeweiligen Firmen.
Die Großfirmen werden auf diese Weise zu Fetischen, die besonderen Gesetzen unterliegen. Nun zeigt aber gerade die jüngste Entwicklung der Wirtschaft, daß man hier allgemein Illusionen nachhängt. Die größte staatliche Subvention, die günstigste Prolongation eines Kredites und der intensivste Eifer von Gewerkschaftsfunktionären sind nicht in der Lage, den Markt zu verändern.
Es ist nun einmal eine Tatsache, daß die Stahlwerke in den Entwicklungsländern büliger produzieren als die alteingesessenen, renommierten Häuser in Europa. Auch kann man nicht darüber hinwegsehen, daß die Comecon-Staaten in den letzten Jahren eine leistungsfähige Chemieindustrie aufgebaut haben.
Auch der Umstand, daß die Staatshandelsländer ihre Preise unter Vernachlässigung der Kosten bilden, muß zur Kenntnis genommen werden. Die Billigangebote aus dem fernen Osten im Textilbereich und der gigantische Papierausstoß Kanadas und Skandinaviens sorgen ebenso dafür, daß zahlreiche „unsinkbare Schiffe” in jüngster Zeit leck geworden sind.
Der Eifer staatlicher Stellen bei der Rettung der gefährdeten Großunternehmungen ist nur bei oberflächlicher Betrachtung eine Neuerscheinung. Die Konservierung historischer Größen ist in der Wirtschaftsgeschichte schon länger bekannt. Die markantesten Beispiele bieten wohl die in fast allen Staaten künstlich aufrechterhaltenen Bahnverwaltungen. Auch in diesem Sektor nimmt man die Entwicklung des Marktes nicht zur Kenntnis und subventioniert, der Realität des Straßenverkehrs zum Trotz, die ehrwürdige Eisenbahn mit Milliardenbeträgen.
Nun schickt man sich an, neben den Bahnen auch Stahlwerke, Textilfabriken, Faserproduktionen und Papierindustrien zu unterstützen. Schon die Bahn allein kostet etwa in Österreich jährlich über 15 Milliarden Schilling, und das ist immerhin die Hälfte des gesamten, allgemein beklagten Nettodefizits der Republik im Jahre 1978.
Österreich - und dies kann man auch von den anderen Industriestaaten getrost aussagen - ist somit nicht in der Lage, sich den Luxus der Bahnerhaltung im bisherigen Umfang zu leisten. Am Rande sei daran erinnert, daß in Wien die Straßenbahn ebenfalls Defizite in Milliardenhöhe produziert und niemand zur Kenntnis nehmen will, daß die Bevölkerung den Straßenverkehr mit allen Stauungen und Unannehmlichkeiten der „guten, lieben alten Tram” vorzieht.
Man braucht keine große Phantasie, um abschätzen zu können, daß die Unterstützung weiterer Bereiche den Staat nur in noch größere finanzielle Nöte stürzen muß.
Daß dieser Weg in die Katastrophe führt, dürfte angesichts der einprägsamen Tatsachen nicht einmal Gegenstand von Diskussionen sein: Bei einem Bruttonationalprodukt von 800 Milliarden Schilling, das derzeit kaum wächst, erreicht die Verschuldung der Republik allein - ohne alle anderen öffentlichen Stellen - heuer schon fast 200 Milliarden Schilling. Im Jahr 1979 werden es bereits 250 Milliarden sein.
Vor diesem Hintergrund qualifiziert sich der Glaube an die „unsinkbaren Schiffe” als blanker Unfug. Die Wirtschaftspolitik kann nicht darauf abgestellt sein, eine Art ökonomische Denkmalpflege zu betreiben. Langt die Analyse der aktuellen Probleme an dieser Stelle an, so taucht in letzter Zeit unweigerlich das Wort von der Innovation auf. Man müsse einfach die Entwicklung und die Herstellung neuer Produkte fördern, und dann würde sich die Problematik von selbst lösen.
Es sei die ketzerische Feststellung gestattet, daß der Glaube an die „Innovation” ebenso unsinnig 1st wie die Anbetung der „unsinkbaren Schiffe”. Das einzig gültige Kriterium für ein Unternehmen ist der wirtschaftliche Erfolg…
Und dies leitet zu der wichtigen Unterscheidung zwischen Förderung und Unterstützung über. Die Förderung von Unternehmungen durch das Verschenken von Staätsgeldern ist strikte abzulehnen. Zum ersten hat der Staat das Geld überhaupt nicht. Er muß also die Subventionen über Kredite finanzieren oder zusätzliche Steuern einheben. Da die Kredite zurückzuzahlen sind und darüber hinaus noch enorme Zinsenbelastungen verursachen, ist wieder der Steuerzahler betroffen.
Wie man die Dinge auch dreht, die Förderung von Unternehmungen bedeutet einen Griff in die Taschen der ohnehin bereits überbelasteten Bürger. Auch darf man nicht übersehen, daß die Empfänger der Förderung angesichts ihrer mißlichen Lage selbst keine Steuern zahlen. Somit verlagert man gutes Geld zu schlechten Adressen.
Während eine Förderung in Form von Subventionen als schädlich abzulehnen ist, muß die Wirtschaftspolitik sehr wohl die Unternehmungen unterstützen, und zwar durch Bedingungen, die das Gedeihen der Firmen ermöglichen. Von den wirtschaftlich relevanten Gesetzen bis zur Außenhandelspolitik gibt es eine Vielzahl von Ansatzpunkten. Den wesentlichsten Bereich stellen aber die Steuern dar.
Die Belastung der einzelnen wie der Unternehmungen ist in den letzten Jahrzehnten enorm angewachsen. Die Übernahme unzähliger Aufgaben - vom Straßenbau bis zur Sozialversicherung - hat zwangsweise das Mittelerfordernis in die Höhe schnellen lassen.
Die offenkundige Bereitschaft des Staates, nun auch die Wirtschaft in die Sozialfürsorge einzubinden, wird den Mittelbedarf nur zusätzlich vergrößern. Eine wichtige Feststellung zu dieser Entwicklung ist der Hinweis auf die Steuerquellen. Die Empfänger der öffentlichen Leistungen sind heute auch die Financiers. Die früher geltende Konstellation, daß der Staat über die Steuern das Geld von den Reichen zu den Armen verlagert, gehört in das Reich der Theorie. Die Masse der „Durchschnittsverdiener” zahlt die Steuern und sonstigen Abgaben, und genau diese Masse bildet auch die Leistungsempfänger.
Schon an diesem Zusammenhang erweist sich die Absurdität des geltenden Systems.
Die Refinanzierung seiner Ausgaben kann der moderne Staat ohnehin nur mehr in bescheidenem Umfang aus den Gewinnsteuern decken. Er muß sich also an die lohn- und umsatzabhängigen Abgaben halten. Da er aber in immer größerem Maße Löhne und Umsätze selbst durch seine eigenen Subventionen ermöglicht, wird der beliebte Witz zur Wahrheit, daß sich das Finanzamt selbst besteuert.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!