Die Sozialsprecher der vier Parlamentsparteien diskutieren in der Furche mit Vertretern von katholischer und evangelischer Seite den "Sozialbericht" der 14 christlichen Kirchen in Österreich. Bis zum Herbst sollen diese und andere Stellungnahmen, Diskussionen und Debatten in ein "Sozialwort" der Kirchen einmünden.
Die Furche: Die 14 christlichen Kirchen in Österreich arbeiten an einem gemeinsamen Sozialwort. Was wollen die Kirchen damit erreichen?
Bischof Herwig Sturm: Was tun wir selber auf sozialem Gebiet? Mit dieser Frage haben die Kirchen ihre Arbeit begonnen und die Zusammenfassung der Antworten liegt nun im Sozialbericht vor, der die Diskussionsgrundlage für das geplante Sozialwort darstellt. Wir sind davon überzeugt, dass die Einrichtungen, die Gruppen, die im Sozialbericht zu Wort kommen, so nahe bei den Menschen sind, dass sie vielleicht einseitig, aber nie unberührt ihre Berichte geschrieben haben. Die Kirchen verstehen sich damit auch als Seismographen der Gesellschaft. Wir glauben durch unsere Arbeit soziale Schwankungen eher zu spüren als sie im offiziellen oder wissenschaftlichen Bereich wahrgenommen werden.
Margit Appel (ksoe): Mit diesem Bericht ist nicht bloß eine Zusammenfassung guter Werke entstanden, sondern es wird deutlich, dass die Initiativen und Organisationen die im Rahmen der 14 Kirchen im sozialen Bereich arbeiten, selber schon das Bewusstsein haben, dass sie gesellschaftspolitisch tätig sind. Ein Grundrecht auf Teilhabe zu sichern, darum geht es im Sozialbericht. Jetzt und für alle Gruppen dieser Gesellschaft.
Sturm: Das Ziel ist, dass alle Bürger unseres Staates Teilhabe, Zugang zur sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Lebenswirklichkeit erhalten.
Appel: Wenn ich einen Punkt herausgreife, so meine ich, dass die soziale Lage der Frauen ein Indikator dafür sein kann, wie gut es mit dem Gerechtigkeitslevel einer Gesellschaft bestellt ist. Und da zeigt sich unschwer, dass bei uns einiges im Argen liegt. Die Einkommen zwischen Männern und Frauen gehen jetzt wieder deutlich auseinander. Mittlerweile gibt es zwar Frauen, die zu den Leistungsträgern dieses Systems zählen, die auch hohe Einkommen erzielen können, aber viele Frauen, die die gewünschte Flexibilität und Mobilität nicht erbringen, bleiben ganz hinten. Im Sozialbericht kommt klar zum Ausdruck, dass die eigenständige Existenzsicherung von Frauen viel mehr in den Blick kommen muss. Das ist aber immer noch politisch schwierig, weil nach wie vor mit einer bestimmten Familienideologie gearbeitet wird.
Gottfried Feurstein (ÖVP): Vorweg und grundsätzlich: Ich halte diesen Sozialbericht, der in ein Sozialwort einmünden wird, für eine großartige Initiative der 14 Kirchen, weil wieder einmal auf die Wichtigkeit der Nächstenliebe hingewiesen wird. Bei Ihren Ausführungen, Frau Appel, bin ich aber stutzig geworden. Sie sprechen von Familienideologie und interpretieren diese sehr negativ. Gerade bei älteren Frauen halte ich hingegen die Familienideologie für einen sehr wichtigen Gesichtspunkt, der aufrecht erhalten bleiben muss. Das Kinderbetreuungsgeld hat hier einen ganz wichtigen Schritt gemacht, die Familienhospizkarenz war ein zweiter wichtiger Schritt in diese Richtung. Aber das warennoch nicht alle nötigen Schritte. Jedenfalls ist die Familienideologie, die für mich positiv besetzt ist, ein entscheidender Bereich der Sozialpolitik. Ohne Familie kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Sozialpolitik gibt. In diesem Sinn freut mich auch, dass das Ehrenamt im Sozialbericht so stark vorkommt.
Reinhart Gaugg (FPÖ): Wie Kollege Feurstein sehe auch ich im Sozialwort eine Möglichkeit, mehr soziales Bewusstsein in die Politik zu tragen. Mich stört aber generell und auch bei dieser Diskussion, dass man sich beinahe schon für das Wort "Solidarität" entschuldigen muss. In-Worte sind: Wissensgesellschaft, Globalisierung, Shareholder-Value und all das was den Erfolgsmenschen und die Erfolgsgesellschaft auszeichnet. Aber wenn wir als Sozialpolitiker uns schon von der Solidarität distanzieren und "Teilhabe" sagen, dann ist das auch ein Begriff, an dem wir uns orientieren können, aber in Wirklichkeit geht es doch um die Solidarität. Was mein Vorredner gesagt hat, kann ich nur unterstreichen: Die Familie muss im Vordergrund unserer Überlegungen bleiben. Sie ist eine der wesentlichsten Säulen in unserer Gesellschaft. Es kann nicht das Abnormale normal werden.
Heidrun Silhavy (SPÖ): Na ja, wenn ich die beiden Herren richtig verstehe, dann funktioniert der Sozialstaat ohne Familie und Ehrenamt nicht. Da habe ich ein ungemein schlechtes Gefühl dabei. Noch dazu, wo Sie, Kollege Feurstein, das Kinderbetreuungsgeld und die Familienhospizkarenz besonders betont haben. Wohin geht das? Es geht dahin, dass die unbezahlte Arbeit der Gesellschaft die notwendig ist, von Frauen geleistet wird. Sie haben gezielt diese zwei Beispiele im Zusammenhang mit dem Thema Frauen genannt. Aber diese Familienideologie wird nicht halten, solange die Arbeit einseitig einem Geschlecht aufgelastet wird. Dass Ehen immer mehr geschieden werden, dass immer mehr Menschen sich dazu bekennen, nicht zu heiraten, liegt auch daran, dass es eine ungleiche Verteilung von Pflichten und Rechten in unserer Gesellschaft gibt - zu Lasten der Frauen. Und wenn wir hier nicht versuchen, eine Umverteilung herbei zu führen, wird das Muster, auf dem Ihr Modell aufbaut, zunehmend nicht mehr funktionieren.
Karl Öllinger (Grüne): Im Unterschied zum Kollegen Feurstein bin ich sehr dankbar für den sehr offenen Familienbegriff, den die Kirchen hier beschrieben haben. Ich glaube, er hilft uns weiter. Sicher nicht weiter hilft uns eine Ideologie, im Sinne eines Festhaltens an dem was zwar für viele Menschen ein wünschensswerter Zustand ist, aber für sehr viele und immer mehr Menschen eine nicht mehr lebbare Realität darstellt.
Silhavy: Die Frauen werden einfach nicht mehr mitmachen, so schaut's aus. Außer es wird wieder bewusst versucht - und das erleben wir ja gerade - alte Abhängigkeiten herzustellen, damit dieses System weiter aufrecht erhalten werden kann. Aus meinem gesellschaftspolitischen Ansatz heraus ist das der falsche Weg, er wird sich auch nicht bewähren. Eine für alle Seiten befriedigende Lösung kann nur darin bestehen, dass die Leistungen, die freiwillig, gern und unter bestimmten Rahmenbedingungen erbracht werden, nicht einseitig zu Lasten eines Geschlechtes und einer Gruppe gehen. Das ist eine Zielsetzung, die man auch mit diesem Projekt Sozialwort weiter verfolgen sollte. Es ist ja auch ein ureigenstes Problem der Kirchen. Wenn man schaut, wo die Frauen in den Kirchen angesiedelt sind, spiegelt das ja auch ein Gesellschaftsbild wider.
Öllinger: Ich glaube auch, dass da die Kirchen teilweise noch etwas mehr machen könnten. Nicht nur was die Stellung der Frauen betrifft. Ich sehe ebenfalls große Schwierigkeiten, wenn es um das Zusammenleben und auch das familiäre Zusammenleben etwa von gleichgeschlechtlichen Partnern geht und auch um die Anerkennung und Akzeptanz von diesen Gruppen.
Die Furche: Im Sozialbericht wird die Forderung erhoben, der Staat solle als Lobbyist für die Schwachen und Armen auftreten. Heißt das, der Sozialstaat Österreich hat sich schon von dieser Aufgabe verabschiedet?
Appel: Der gängigen Argumentation, in einem rasanten ökonomischen, sozialen, politischen Wandlungsprozess gebe es immer Gruppen, die ein Stück zurück bleiben, wird im Sozialbericht entschieden widersprochen. Das Tempo ist eben an jene anzupassen, die von sozialer Ausgrenzung und Armut betroffen sind. Unser oberstes Ziel muss sein und bleiben: Teilhabe für alle, in jeder Situation, in jeder Entwicklungsstufe dieser Gesellschaft.
Silhavy: Wenn wir vom Staat als Lobbyisten reden, dann ist mir wichtig zu betonen: Der Staat sind wir alle. Die VP-FP-Regierung benutzte das Schlagwort: Wir sparen
Gaugg: Oskar Lafontaine hat in seinem Buch "Das Herz schlägt links" sehr treffend auch die Zukunft der Gesellschaft analysiert. Was ist entscheidend, um eine funktionierende Gesellschaft in einem Land wie Österreich zu haben: Der Respekt vor dem Leben ist einmal das Entscheidendste. Die Frage der Toleranz und der freundschaftliche Umgang kommen dazu. Auch mit den Ausländern. Alle haben wir in unserem Freundeskreis Menschen, die aus dem Ausland kommen. Da pflegen wir an und für sich immer einen recht guten Umgang damit und versuchen auch zu helfen und zu unterstützen. Kaum ist es eine anonyme Gruppe, dann kommen so reflexartige politische Handlungen, die oft weniger sachlich sind, eher Emotionen wecken.
Bei uns haben auch alle Bürger Zugang zu sozialen Leistungen und zu Beschäftigung. Die Frage ist nur, sind genügend Arbeitsplätze vorhanden wie wir sie brauchen, weil die Teilzeitbeschäftigung, die von allen politischen Parteien kritisch betrachtet wird. Aber würden wir die Möglichkeit nicht schaffen, hätten die überhaupt keine Beschäftigung, weil der internationale wirtschaftliche Druck und die Entsolidarisierung in den letzten Jahren da durch wen auch immer einen Boden bereitet hat. Dass die NGOs und die Kirchen sind die einzigen sind, die die sozialen Belange in den Vordergrund stellen, glaube ich nicht, denn auch die politisch Verantwortlichen in diesem Land tragen schon auch sehr viel dazu bei. Daher der Druck auf die Arbeitsplätze wird so lange bleiben, so lange nicht genügend Arbeitskräfte vorhanden sind. Eine soziale Ausgrenzung kann es da und dort vielleicht geben, im wesentlichen der gesellschaft sehe ich sie aber nicht. Es wird korrekt umgegangen.
Furche: Das dürfte ja jetzt genug Futter sein!
Öllinger: Das kann man in einer Wortmeldung gar nicht aufholen. Zum Diskussionsprozess generell: Wir nähern uns dem sehr hohen und entwickelten Diskussionsstandard, den die Kirchen untereinander leben, zumindest dort wo ich das miterlebt haben. Ich würde vermuten, dass sich der Diskussionsstandard zwischen uns Politikern sehr schnell wieder dem Normalstandard annähert, wenn wir dann die tatsächlichen Problemen ansprechen. Unter den tatsächlichen Problemen meine ich, dass in dem was uns jetzt vorliegt, von den Kirchen, schon sehr vieles drinnen ist, sehr konkret teilweise, manchmal etwas zu allgemein, wo ich mir mehr Konkretisierung gewünscht hätte, und manchmal steht auch etwas nicht drinnen. Das hängt ja auch mit den sehr unterschiedlichen Zugängen der einzelnen Kirchen zusammen.
Nachdem gerade die sozialen Bürgerrechte, das Recht auf Teilhabe zentrale Aspekte sind, würde ich meinen, wir müssen uns - das ist auch notwendig beim Sozialstaats-Volksbegehren - irgendwann Prioritäten setzen. Nicht jede positive Antwort auf die Verteilungsfrage - und es gibt positivere Antworten als sie derzeit die Politik gibt - löst das Armutsproblem. Ich finde es wichtig, dass wir uns der Debatte um das Verhältnis zwischen der Verteilungsfrage und der Armutsfrage stellen. Auch im Hinblick auf eine Sozialverträglichkeitsprüfung, die ich für ein wichtiges Instrument halte, und von der ich mir wünschen würde, dass man sich endlich einmal trauen würde, sie auszuprobieren bei bestimmten Gesetzen. Was will man sich prioritär anschauen: Die Armut, die es gibt oder die ungerechte Verteilung, die es auch gibt, die manchmal Konkurrent ist mit der Armut, aber nicht notwendigerweise sein muss.
Ich will gar nicht auf das eingehen, was der Kollege Gaugg zum Integrationsvertrag gesagt hat. Aber warum nicht bestimmte Gruppen befähigen, ihre Rechte wahrzunehmen, die es derzeit nicht können? Wer macht die Vertretung von Arbeitslosen in Österreich? Niemand! Es gibt Gruppen, die sich das irgendwie in ihrem Programm auf die Federn heften, aber eigentlich eine institutionelle Vertretung von Arbeitslosen, auch gegenüber den Institutionen, mit denen diese zu tun haben, die ihre Rechte wahrnehmen, gibt es nicht. Unser Vorschlag war einmal eine Art Arbeitslosen-Anwaltschaft. Warum nicht das selbe auch bei den Migrantinnen? Die Migrantinnen haben in Österreich keine politischen Vertretungsrechte - im Betrieb nicht, in der Arbeiterkammer passives Wahlrecht, in den Gemeinden nicht. Wenn man sich schon nicht drüber traut, Herr Kollege Feurstein, da schau ich natürlich sie an, und den Kollegen Gaugg, Migranten das Wahlrecht zuzugestehen, warum nicht einen beherzten Schritt in Richtung einer besseren Vertretung in diesem Rahmen. Da gibt es ja auch Modelle, die unter dem Wahlrecht liegen, warum nicht in diese Richtung gehen. Warum passiert nichts, seit Jahren. Das ist nicht nur ein Vorwurf an ÖVP-FPÖ, der Stillstand ist ja schon seit Jahren.
Um Arbeitslose kümmert sich in Österreich nicht niemand. Ob es ausreichend ist, ist eine andere Frage. Es gibt das AMS, das ständig versucht sich zu verbessern und im Dialog ist mit den Arbeitslosen. Die Arbeiterkammer gibt es auch noch, wo sie auch ihr Wahlrecht wahrnehme können. Man kann nie genug tun. Die Unternehmer, die heute die Zeitarbeiter beschäftigen, die für mich einen hohen Grad an sozialer Verantwortung haben, weil die Mitarbeiter beschäftigen, die ansonsten auf dem freien Markt keine Chance hätten.
Öllinger: Also doch Wahlrecht!
Silhavy: Verschiedene Gruppen versuchen immer wieder uns zu sagen, dass Solidarität nicht mehr gefragt, nicht mehr modern ist. Wenn man dann im Detail schaut, denk ich mir, und selbst wenn es nur aus Eigennutz ist, müsste eigentlich jedem klar sein, dass Solidarität sich lohnt. Herr Feurstein, sie haben Subsidiarität so beschrieben, den einzelnen zu befähigen, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Da sind wir grundsätzlich einer Meinung. Nur wenn wir permanent die Diskussion führen, und das haben wir ja auch ständig im Parlament, wenn jemand ein Recht, das ihm zusteht, weil er arbeitslos ist und nicht vermittelt wird, weil der andere Job wesentlich schlechter ist oder nur einen Teilzeitjob bekäme, wenn wir dann jedes Mal in die Missbrauchsdiskussion geraten, dann erscheint das ganze in einem schiefen und schrägen Licht. Wenn ich mir etwas von diesem Projekt Sozialwort erwarte, dann ist das der Gesellschaft wieder bewusst zu machen, wie verkehrt unsere Diskussion, nicht nur die interne, auch die veröffentlichte oft läuft. Überall wo es um Sozialtransfers geht, die im Grunde genommen ein Versicherungsrecht sind, und wir große Lettern haben, wer schon wieder Missbrauch betrieben hat, wir aber über Sozialbetrug, den die Firmen machen, wenn sie Leute nicht anmelden, und damit nicht nur den einzelnen Beschäftigten, sondern auch den gesamten Sozialstaat schädigen, ist das überhaupt kein Thema. Das ist eine verkehrte Welt.
am Staat. Woran wird aber dann gespart? Das heißt konkret, wir sparen an uns selber, an unseren eigenen Möglichkeiten. Das Zurücknehmen des Staates bedeutet einerseits weniger Teilhabechancen, andererseits muss der Einzelne ein höheres Risiko tragen und letztlich wird es auch noch teurer. Denn ein solidarisches Versicherungssystem ist sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Volkswirtschaft günstiger als eine private Risikovorsorge. Schlussendlich geht es immer um Verteilungsfragen: Entwickeln wir uns in Richtung eines Staates, in dem die, die es sich leisten können, die Teilhabe haben und die, die es sich nicht leisten können, die Bittsteller sind? Oder entwickeln wir uns in eine Richtung, wo man ein möglichst hohes und ausgeglichenes Wohlstandsniveau für alle zu erreichen versucht. Das ist im Grunde genommen die große politische Auseinandersetzung in Österreich.
Gaugg: In vielen Bereichen funktioniert in Österreich das Solidaritätsprinzip sehr gut, und das sollte auch weiterhin für den Versicherungsbereich gelten. Viele, auch private Gesellschaften, haben versucht, die Versicherungspflicht zu ändern. Aber bei privaten Betreibern steht der Profit des Unternehmens im Vordergrund. Überall dort aber, wo staatliche und politische Mechanismen einen Einfluss ausüben, gilt in erster Linie und vorrangig das Bestreben, Versorgung zu gewährleisten. Zu diesem Prinzip bekenne ich mich, das habe ich auch in innerparteilichen Diskussionen immer wieder eingebracht und verteidigt. Denn für mich kann der politische Mandatar immer noch am ehesten als ein Ausgleich zwischen den Gesellschaftsschichten agieren. Firmen können das nicht, denn die sehen - das liegt in der Natur der Sache - in erster Linie den Profit.
Feurstein: Der Staat muss noch viel mehr als heute Lobbyist werden. Man muss es offen sagen: Mitunter wird der Mensch heute entwürdigt, wenn er staatliche Leistungen für sich in Anspruch nimmt. Das ist ein schwerer Mangel und das sollte man auch als solchen sehen. Was mir noch im Sozialbericht fehlt - aber es ist ja noch kein Sozialwort -, ist das zweite wichtige Prinzip jeder Sozialpolitik: die Subsidiarität. Aber nicht die Subsidiarität von der im politischen Jargon die Rede ist, sondern jene, die vom großen katholischen Sozialethiker Oswald Nell-Breuning formuliert und von den Päpsten aufgegriffen worden ist. Laut deren Definition bedeutet Subsidiarität: Sozialpolitik hat auch die Aufgabe, den Einzelnen zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen.
Furche: Besteht aber nicht gerade bei einer Wirtschaftspartei die Gefahr, dass das Gerede von der Subsidiarität dazu missbraucht wird, die Auslagerung der Zuständigkeit des Staates für soziale Maßnahmen zu rechtfertigen? Subsidiarität sozusagen als Schuhlöffel für "weniger Staat, mehr privat" - auch im sozialen Bereich?
Feurstein: Darum habe ich deutlich gesagt: Subsidiarität nicht in dem Sinne, wie wir das heute landläufig verstehen.
Öllinger: In der Definition von Ihnen, Kollege Feurstein, ist die Subsidiarität schon akzeptabel, aber in der politischen Debatte - und wir bewegen uns nun einmal in der politischen Debatte - wird dieser Begriff ganz, ganz anders verwendet. Sozusagen als Rammbock gegen alles Soziale und alles Solidarische, vor allem gegenwärtig gegen solidarische Versicherungssysteme. In den Stellungnahmen für den Sozialbericht wurde das auch sehr selbstkritisch betrachtet und es wird vor der missbräuchlichen, aber gängigen Verwendung dieses Begriffes gewarnt.Es wird auch versucht, diesem Begriff wieder eine positive Bedeutung zu geben. Um ihn dann mitzunehmen auf die Reise. Auf eine Reise, wo auf der anderen Seite und durchaus nicht im Widerspruch, der Staat als der Lobbyist der Armen eingefordert wird. Das ist in der üblichen politischen Debatte ein Gegensatz, tatsächlich muss und darf es das aber nicht sein.
Sturm: Ich möchte aufgreifen, was zum menschenunwürdigen Anstellen um Sozialleistungen gesagt wurde. Recht nicht Almosen, steht dazu im Sozialbericht. Es geht nicht an, dass Menschen unter uns von Tür zu Tür gehen müssen, um zu betteln. Jeder und jede in unserem Staat, soll ein Recht darauf haben, lebenswert leben zu können. Denn die Bedingung für soziales Handeln ist nicht selbstverständlich. Es gibt Untersuchungen, die sagen, die Solidarität lässt nach. Sich um einander zu kümmern ist für viele nicht mehr selbstverständlich. Gerade aber die Kirchen müssen von ihrem Fundament her, den sozialen Grundwasserspiegel immer wieder mit frischen Wasser anheben.
Öllinger: Vieles im Sozialbericht ist mutiger als das was sich die Parteien trauen. So machen die Kirchen die großen Einkommensunterschiede zum Gegenstand und fragen, was im Unterschied der Einkommen moralisch vertretbar ist. Da verlässt sogar uns manchmal der Mut, solche Fragen jenseits einer politischen Neiddebatte öffentlich und auf seriöse Art zu diskutieren. Andererseits muss ich Ihnen, Herr Bischof, in einem Punkt widersprechen. Ich empfinde die Solidarität nicht als nachlassend. Sie hat sich vielmehr verändert.
Man kann das sehr gut an den bestehenden Sozialversicherungssystemen beschreiben, die immer in bestimmten Risken schützen sollen. Ja, die funktionieren schon, aber sie schließen auch bestimmte Gruppen vom Schutz dieser Solidarsysteme aus. Gerade am Beispiel Migration, am Beispiel Frauen mussten wir in den letzten Jahren lernen, dass die hergebrachten Solidarsysteme sich gegenüber bestimmten Gruppen sehr oft abschotten. Jüngere Menschen, so erlebe ich das, sind aber durchaus bereit, diese Abschottungen und Ausgrenzungen aufzuheben. Da gibt es so etwas wie eine Spaltung innerhalb der Bevölkerung. Die Bereitschaft auf Andersdenkende, Anderslebende, Anderssprechende, Andersaussehende einzugehen, finde ich, ist in der jüngeren Generation wesentlich höher entwickelt und für mich ein starkes Indiz dafür, dass Solidarität vorhanden ist, und dass sie auch von der Politik eingefordert wird. Die alten Solidarsysteme lösen diesen Anspruch auf neue Solidaritäten nur unzureichend ein. Das ist einer der Punkte, den ich von der Debatte der Kirchen mitnehme.
Gaugg: Wenn Öllinger es als positiv betrachtet, dass die Kirchen sich stärker in die politische Debatte einbringen, dann birgt das aber auch das Risiko, dass die Kirchen auch stärker in die politische Ziehung genommen werden. Viele Fragen können nicht losgelöst werden vom Vermögen, von den Möglichkeiten, von den Chancen, sich auch aktiv einzubringen. Wenn die Kirchen sich stärker in die politische Debatte der Armutsbekämpfung einbringen, muss sie natürlich damit rechnen, dass die Politik an sie Forderungen stellt, die dann nicht abgeblockt werden dürfen. Die Kirchen müssen sich dann auch aktiv an der Lösung der Probleme beteiligen. Wir haben das zur Zeit der Flüchtlingsströme aus Jugoslawien sehr intensiv diskutiert.
Sturm: Die Autorität des Sozialberichtes ist dadurch gegeben, dass die Kirchen nicht nur fordern, sondern auch selbst Hand angelegt haben und nach wie vor sehr aktiv in allen sozialen Bereichen tätig sind. Doch die Kirche kann und will nicht nur der barmherzige Samariter sein, der die Ausgeraubten und Liegengebliebenen versorgt. Wir müssen uns auch fragen, was mit der Straße los ist, auf der solche Ungeheuerlichkeiten passieren.
Appel: Der Sozialbericht macht beispielsweise deutlich, dass es große Lücken im Bereich der Teilhabechancen für Migrantinnen und Migranten gibt, egal ob das der Zugang zum Arbeitsmarkt, die Wohnungssituation, der Zugang zu bestimmten Sozialleistungen ist. Und dass es ganz eindeutig ist: Auch Menschen die schon lange hier leben, werden in erster Linie als günstige Arbeitnehmer gesehen. Auch das Themenfeld politische Mitgestaltung lohnt sich vor allem, auf dieser Ebene anzuschauen. So nach dem Motto: Integration beginnt bei politischer Beteiligung und endet nicht bei Sprachkenntnissen.
Gaugg: Generell möchte ich dazu nur sagen, dass Österreich im Vergleich zu vielen anderen Staaten in Europa ein ausländerfreundliches Land ist. Es wird immer so dargestellt, als ob bei uns fürchterliche Zustände herrschen. Ich schau nach Frankreich, nach Deutschland, nach Italien - da ist der Umgang mit Ausländern viel schwieriger. Sozialkonflikte entstehen überall dort, wo nicht versucht wird, die Ausländer ausreichend zu integrieren. Und da ist es in Österreich sicher nicht so, dass nur die NGOs und Kirchen in diesem Bereich vorbildlich arbeiten, sondern auch die politisch Verantwortlichen - siehe Integrationsvertrag - tragen dazu einen wichtigen Teil bei.
Öllinger: Ohne auf den Integrationsvertrag und meine Kritik daran noch einzugehen. Generell möchte ich zur Analyse im Sozialbericht, auch den Punkt Migration betreffend, sagen, dass es eine Stärke der Kirche war und ist, dass sie sich von einem rein caritativen Zugang hin zu einem stärker politisch orientierten weiterentwickelt hat.
Feurstein: Als ich jung war, haben die kirchlichen Sozialbotschaften uns immer wieder gefordert und gesagt: Liebe Politiker, das sind unsere Wünsche. Viele dieser Initiativen sind in der Politik umgesetzt worden. Aber in den letzten 30 Jahren ist ein Vakuum entstanden. Es kam wenig, beinahe gar nichts Koordiniertes mehr von den Kirchen.
Sturm: 1990 gab es doch den viel beachteten Sozialhirtenbrief der katholischen Bischöfe.
Feurstein: Nein, gerade auch der Sozialhirtenbrief war nicht mehr ein solcher Impuls, wie die früheren Sozialschreiben der Kirche. Da ist eine wesentliche Abschwächung entstanden, weil sich die Bischöfe nicht mehr getraut haben, Positionen einzunehmen. Ich bin sehr froh, dass dieses Vakuum durch die Chance, die mit dem Sozialwort besteht, ausgefüllt werden kann. Wenn von den Kirchen auch unangenehme Feststellungen kommen, es muss nicht alles angenehm sein, so ist das doch eine Chance, wieder neue Impulse und neuen Schwung in die Sozialpolitik zu bringen.
Das Gespräch moderierten Wolfgang Machreich und Rudolf Mitlöhner.

















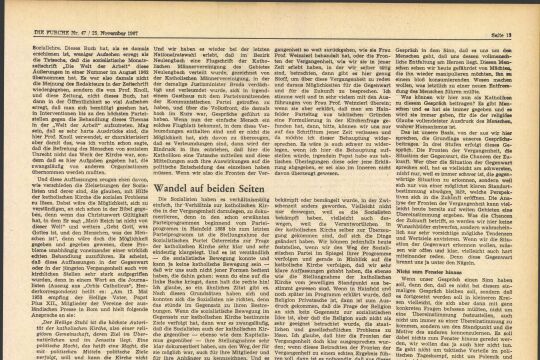
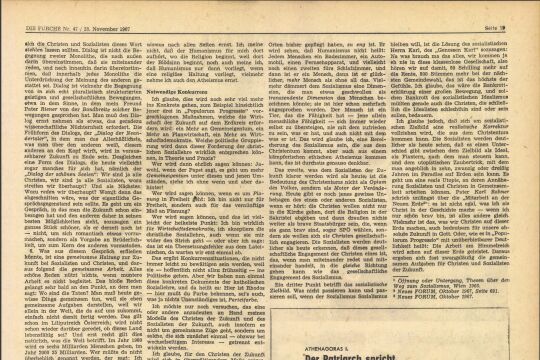













































.png)


























