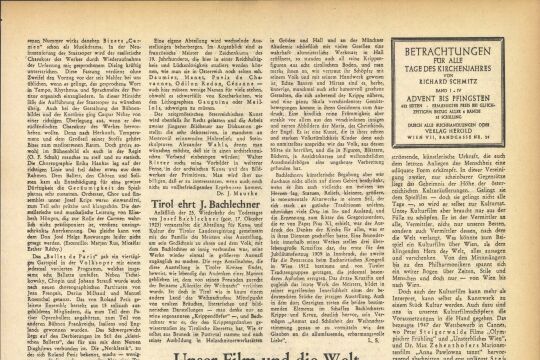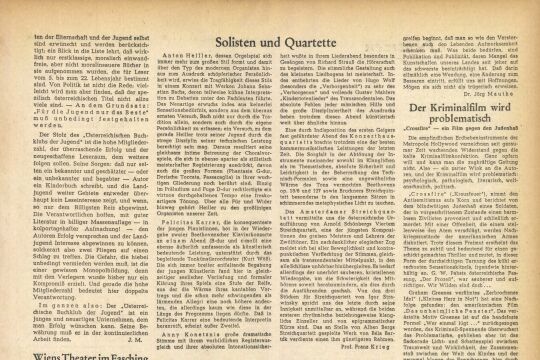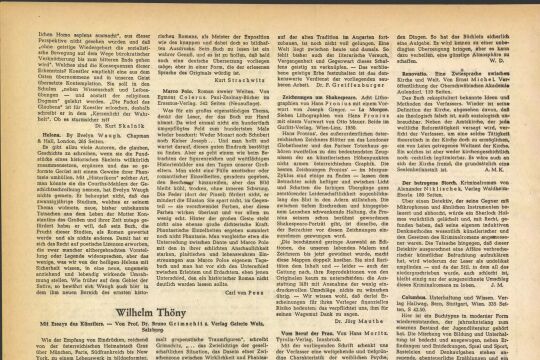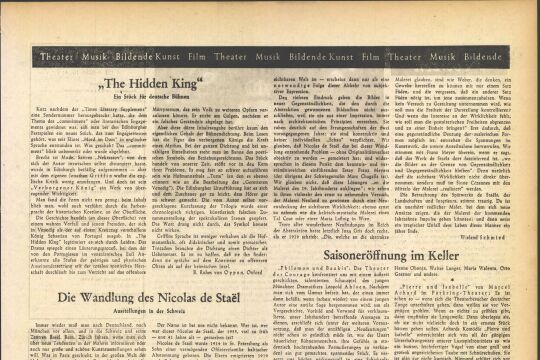Dieser FURCHE-Text wurde automatisiert gescannt und aufbereitet. Der Inhalt ist von uns digital noch nicht redigiert. Verzeihen Sie etwaige Fehler - wir arbeiten daran.
Osterreich und die Moderne
Wenn heute das „Museum des 20. Jahrhunderts“ feierlich eröffnet wird — für Wien und für Österreich ein beinahe säkulares Ereignis — so ist es am Platz, etwas Besinnung und Selbstbesinnung zu üben. Die „Moderne Galerie“, im Jahre 1899 als Projekt vom Kunstrat einstimmig beschlossen, von Otto Wagner ursprünglich entworfen und mit in die Zukunft weisenden Richtlinien versehen, hat nun endlich in anderer Gestalt und vor allem unter gänzlich anderen Voraussetzungen Verwirklichung erfahren. Daß dies so spät geschah, ist ein beinahe tragisches Kapitel österreichischer Kulturgeschichte. Daß es dennoch und unter bedeutenden Anstrengungen Wirklichkeit wurde, ist ein Beweis, wessen Österreich fähig sein kann, „wenn es nur will“ ...
Die Tragik dieser späten Museums-gründung — wohl eine der letzten in Europa — liegt in dem lapidaren Satz des Katalogvorworts von Dr. Werner Hofmann, dem Direktor des Museums,beschlossen: ..... eine ausführliche
und ausgewogene museale Bestandsaufnahme des 20. Jahrhunderts hat aus vielen Gründen keine VerWirklichungs-ehaneen mehr: die Meisterwerke sind rar und vielfach unbezahlbar geworden.“ Das heißt mit anderen Worten, die die Vieldeutigkeit der „rar gewordenen Meisterwerke“ gar nicht in Betracht ziehen, daß die Geschichte des Projektes eine Geschichte versäumter Gelegenheiten ist.
Wenn im folgenden versucht wird, den Umständen auf den Grund zu gehen, so in dem Bewußtsein, daß hier nicht im billigen Sinne nach Schuld oder Unschuld gefragt werden darf, wenngleich auch manches nur mit persönlichem Versagen erklärt werden kann. Das Museumsprojekt, zur Jahrhundertwende,, im Wien der österreichisch-ungarischen Monarchie entworfen, war eine revolutionäre Tat. Mehr noch — Otto Wagner forderte ein Mu-eum, das das „Werdende“ anstrebte. „Nicht um einen Kunstspeicher für Tafelbilder und andere Kunstwerke jetztzeitiger Richtung handelt es sich; der Zweck ist vielmehr, ein klares Bild des jeweiligen Kunstschaffens im kommenden Jahrhundert zu gewinnen. Dieser Zweck ist durch Ankäufe, Widmungen, Aufträge, aber hauptsächlich dadurch zu erreichen, daß alle akqui-rierten Werke der Kunst in Zeitteile, welche ungefähr einem Lustrum entsprechen, vereint in einer Gruppe zusammengestellt werden, und daß die Räume, respektive ihre Ausgestaltung, dem Geschmack und dem Kunstempfinden dieser Periode entsprechen.“ Es war dies im Grunde die Vision eines organisch wachsenden Museums ä lä Corbusier, in dem jede Epoche — wie in der Geologie — ihren Schutt und ihre Findlinge ablagern sollte. Ihren Urspirung hatte sie in einem Vielvölkerstaat, in dem man ohne Paß noch über die Grenzen Europas reisen konnte, und zu einer Zeit, in der keine besonderen Währungsschwierigkeiten bestanden. Zu jener Zeit hatte die österreichische Kunst in ihrem „heiligen Frühling“ Wurzeln und Beziehungen, die sie zumindest mit einem wesentlichen Teil europäischer Gesamtentwicklung verbanden. Der Kontakt mit dem europäischen Norden, mit England, Belgien, Deutschland, der sich in der „Secession“ äußerte, schloß immerhin Österreich an eine internationale Bewegung in der Kunst an.
Der Verlust lag aber in dem weiteren Ausschluß der westlichen Kunsttradition. Es ist eine Tatsache, daß die kontinuierliche Entfaltung der französischen Kunst des 19. Jahrhunderts in Österreich keine Spuren hinterlassen hat. Weder Gericault noch Courbet noch Daumier haben die österreichischen Künstler bewegt. Ihr Blick war nach Norden gerichtet, und durch den Norden erlebten sie erst in den Naza-renern den Süden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und darüber hinaus galt München mehr als Paris. In dieser Haltung, die das tiefe Mißtrauen einer Bürgerkultur gegenüber den Produkten der erfolgreichen Revolution charakterisiert, vollzieht sich das Schicksal der österreichischen Malerei jener Zeit. Während in Frankreich die Welt in den Bildern ihre letzte Fragwürdigkeit zeigt und gleichzeitig in Cezanne ihre geistige Rechtfertigung und Ordnung, begnügt man sich hier mit ihrem sinnlichen Schein. Oder man weicht wie Romako in die persönliche, von Dämonen gehetzte Interpretation aus. Es wäre leicht, zu sagen, daß die österreichische Kunst am Sinnlichen festhält. Im Grunde liegt ihr die In-Frage-Stellung viel mehr, wobei sie aber der plastischen Idealität zu gerne in das Unverbindliche der Dekoration ausweicht.
Vor 1918 gab es in Österreich eine Weltoffenheit, die erst das Schicksal korrigieren sollte. Sie äußerte sich zum Beispiel in dem Ankauf und der Stiftung der Secession von van Goghs „Ebene von Auvers“ für das zu gründende Museum, einer revolutionären Tat, die allerdings bezeichnenderweise von dem Ankauf von Segantinis „Bösen Müttern“ begleitet war. Damals erfolgten auch die Erwerbungen eines Renoir-Aktes, einer Munch-Landschaft, der „Bewunderung“ von Hodler und eines Cezanne-Aquarells. Man war sozusagen auf der Höhe der Zeit, wenn auch nachhinkend, aber doch innerhalb der Aktualität. Dann aber kam die verhängnisvolle Zäsur. Das Museum war nicht Wirklichkeit geworden, es kristallisierte sich in einem verkleinerten Maßstab innerhalb des Belvederes als „Moderne Galerie“ in der Orangerie erst heraus. Österreich, von seinem Koordinatensystem abgeschnitten, reduziert auf sieben Millionen vorwiegend ländlicher Bevölkerung, entmachtet, verarmt, mußte in kargem Rahmen, von inneren Erschütterungen geplagt, haushalten. Die Ankäufe dieser Zeit sprechen ihre eigene Sprache. Kokoschka, Klimt, Archipenko, Corinth, Kirchner und Hof er wurden erworben. Hier aber, will man von Schuld und versäumten Gelegenheiten sprechen, sind die bitteren Tatsachen: Verständlich ist, daß zu jener Zeit nicht an die Gründung eines modernen Museums zu denken war, die Tagessorgen des Staates galten anderen Bereichen; nicht ganz verständlich ist aber etwa der Verkauf eines großen Manet-Bildes, des „Armen Spielmannes“, der an Chestar Dale ging und mit dessen Gewinn der Ankauf österreichischer Provinzmalerei, die heute bereits in das Depot wandert, finanziert wurde. Werner Hofmann drückt es in seinem Vorwort sehr nobel dadurch aus, daß er es die „umständlichen, Jahrzehnt auf Jahrzehnt einer anderen Kompetenz unterworfenen Geschicke der Modernen Galerie“ nennt. Im Grunde war es das Versagen einer Leitung, die, aus der Provinz kommend, das Provinzielle suchte. Dazu kam, daß durch den Schnitt des Jahres 1918 die österreichische Künstlerschaft in ihren partikulären Tendenzen nur bestärkt wurde. Der Blick nach dem Norden wurde zur „völkischen Verpflichtung“, Frankreich, hier noch suspekter als in München, besaß keine Faszination. Und wer von den österreichischen Malern sich nach Vorbildern umsah, suchte sie eher in München oder Prag als in Paris.
In der Tschechoslowakei war das ganz anders. Dort haben, eindeutig nachweisbar, die wesentlichsten Strömungen innerhalb der modernen Kunst bei den Künstlern stärkere Spuren hinterlassen als in Österreich. Man braucht nur an Kupka zu denken oder an die ganze Gruppe der tschechoslowakischen Kubisteh — Kubista, Spala usw. —, die alle zu erstaunlich früher Zeit quer durch Europa die Verbindung mit der Kontinuität der französischen Tradition suchten. Das seit langem bestehende moderne Museum in Prag, mit seinem Besitz, der von Dau-mier-Plastiken über Seurat bis zu den Werken des frühen Kubismus reicht, ist aus diesem Grunde in Mitteleuropa einmalig und einzigartig. Der österreichische Künstler suchte damals sogar in Prag nicht die künstlerische Aktualität, er begnügte sich, mit Derivaten, mit Ableitungen. Als in den frühen zwanziger Jahren ein von Picasso begeisterter Maler aus Paris nach Wien zurückkam, erhielt er von der im Cafe Museum residierenden Künstlerclique den Verweis: „Das kann uns nicht gefallen. “ Damit war die Provinz zu einem Geisteszustand geworden. Es war nicht „gesunder Konservatismus“, der sich in diesem Ausspruch kundtat — es war schlechthin Ignoranz und daraus resultierende Borniertheit, die ihren letzten Grund in der völligen Unkenntnis dessen hatte, was in Frankreich seit etwa 1840 wirklich in der Kunst geschehen war. Hier wirkte sich das Fehlen des Anschaulichen, der Leitbilder, eines Museums aus. Selbstverständlich, das Kunsthistorische Museum war da, aber seine Sammlung, die mit dem 18. Jahrhundert endet, konnte den österreichischen Künstlern, die sich nicht auf dem festen Boden europäischer Tradition bewegten, keine Brücke zur Gegenwart liefern. Die „Moderne Galerie“ fristete in der Orangerie des Belvederes ein kümmerliches und wenig beachtetes Dasein, erst während des letzten Krieges, 1942, wurden wieder Bilder von Monet, Manet, De-gas erworben. Also zutnindest zwanzig Jahre zu spät.
Inzwischen waren die Preise für die Meisterwerke der Impressionisten bereits um ein Vielfaches gestiegen, ein Cezanne, wenn er überhaupt auf den Markt kam, war für Österreich nicht mehr erschwinglich. Wohl aber wäre er es noch in den zwanziger Jahren gewesen, und es wäre besser, statt acht Bildern von Lovis Corinth wenigstens ein Ölbild von Cezanne zu haben. Auch mit relativ bescheidenen Mitteln war es damals noch möglich, Matisse. Braque, Bonnard, Picasso, Juan Gris, Klee, Kandinsky, kurz die ganze Phalanx der zeitgenössischen Kunst in erstklassigen Werken zu erwerben. Da8 es aus den obenerwähnten Gründen nicht geschah, ist das Tragische versäumter und nie mehr wiederkehrender Gelegenheiten. Leider haben wir nicht die geringste Chance, daß sich — wie in der Schweiz oder in den USA — etwa durch ein Legat, das Vermächtnis einer Privatsammlung — diese Lücken schließen könnten: der Österreicher hat der bildenden Kunst nie das gleiche Interesse oder Verständnis entgegengebracht wie der Musik und wenn je, so hat er vorwiegend Graphik gesammelt. Das alles sind Dinge, die wir heute beklagen müssen. Sie sind die Wermutstropfen in dem Freudenbecher, daß das Projekt eines Museums zeitgenössischer Kunst nach 63 Jahren, spät aber doch, seine Realisierung erfahren hat. Und wenn wir heute allen jenen danken, die zu seiner Verwirklichung beigetragen haben, und stolz feststellen können, daß innerhalb der letzten drei Jahre 107 Werke (33 Plastiken und 74 Bilder) für das Museum neu erworben wurden — sicher unter bedeutenden Anstrengungen von Seiten des Unterrichtsministeriums —, so werden wir den Gedanken nicht los, was alles geschehen wäre, hätte man diese An^ sfcrengungen dreißig, vierzig oder gar sechzig Jahre vorher unternommen und damals die Einsicht besessen, die heute am Werke ist.
Die Geschichte des Museumsprojektes'kann uns als Österreichern ntfr eine Lehre sein. Sie zeigt, daß es besser ist früh als zu spät zu handeln, da sich wohl manche, aber nicht alle Dinge, wenn man sie liegenläßt, von selbst erledigen. Sie zeigt weiter, daß gerade für unser Land der Blick weit über die Grenzen hinaus geistige Lebensnotwendigkeit ist, sollen wir nicht in einer Art Selbstamputation im Provinzialismus ersticken, und das Bewußtsein, „ein Kulturvolk“ zu sein, nicht auf Rechten, sondern vor allem auf Pflichten beruht.
Ein Thema. Viele Standpunkte. Im FURCHE-Navigator weiterlesen.
In Kürze startet hier der FURCHE-Navigator.
Steigen Sie ein in die Diskurse der Vergangenheit und entdecken Sie das Wesentliche für die Gegenwart. Zu jedem Artikel finden Sie weitere Beiträge, die den Blickwinkel inhaltlich erweitern und historisch vertiefen. Dafür digitalisieren wir die FURCHE zurück bis zum Gründungsjahr 1945 - wir beginnen mit dem gesamten Content der letzten 20 Jahre Entdecken Sie hier in Kürze Texte von FURCHE-Autorinnen und -Autoren wie Friedrich Heer, Thomas Bernhard, Hilde Spiel, Kardinal König, Hubert Feichtlbauer, Elfriede Jelinek oder Josef Hader!